GmbHG §§ 35, 46, 47 GmbHG; ZPO § 57 1. Zwar vertritt im Falle einer gegen die Bestellung eines Geschäftsführers gerichteten Nichtigkeitsklage derjenige die GmbH im Rechtsstreit, der im Falle des Obsiegens der Gesellschaft als deren […]
Eintrag lesen
GmbHG §§ 35, 46, 47 GmbHG; ZPO § 57 1. Zwar vertritt im Falle einer gegen die Bestellung eines Geschäftsführers gerichteten Nichtigkeitsklage derjenige die GmbH im Rechtsstreit, der im Falle des Obsiegens der Gesellschaft als deren […]
Eintrag lesen| Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| __utma | Performance | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics gesetzt und dient dazu, Benutzer und Sitzungen zu unterscheiden. Das Cookie wird erstellt, wenn die JavaScript-Bibliothek ausgeführt wird und keine __utma-Cookies vorhanden sind. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| __utmb | Performance | 30 Minuten | Das Cookie wird von Google Analytics gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um neue Sitzungen/Besuche zu ermitteln. Das Cookie wird erstellt, wenn die JavaScript-Bibliothek ausgeführt wird und keine __utma-Cookies vorhanden sind. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| __utmc | Performance | Das Cookie wird von Google Analytics gesetzt und wird gelöscht, wenn der Nutzer den Browser schließt. Das Cookie wird von ga.js nicht verwendet. Das Cookie wird verwendet, um die Interoperabilität mit urchin.js zu ermöglichen, einer älteren Version von Google Analytics, die in Verbindung mit dem Cookie __utmb verwendet wird, um neue Sitzungen/Besuche zu bestimmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| __utmt | Performance | 1 Minuten | Das Cookie wird von Google Analytics gesetzt und dient zur Drosselung der Anforderungsrate. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| __utmz | Performance | 6 Monate | Dieses Cookie wird von Google Analytics gesetzt und wird verwendet, um die Verkehrsquelle oder Kampagne zu speichern, über die der Besucher auf Ihre Website gelangt ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| „Sanieren oder Ausscheiden“ – Grenzen der gesellschafterlichen Treuepflicht | Urteil des BGH vom 25.01.2011, II ZR 122/09Der BGH hat mit Urteil vom 25.01.2011 Folgendes entschieden:Regelt der Gesellschaftsvertrag einer Publikumspersonengesellschaft, dass eine Kapitalerhöhung auch im Krisenfall nur einstimmig beschlossen werden kann und das Nichterreichen der Einstimmigkeit zur Folge hat, dass die zustimmenden Gesellschafter berechtigt sind, ihre Einlagen zu erhöhen, während die nicht zustimmenden Gesellschafter eine Verringerung ihres Beteiligungsverhältnisses hinzunehmen haben, so sind die zahlungsunwilligen Gesellschafter nicht aus gesellschaftlicher Treuepflicht verpflichtet, einem Beschluss zuzustimmen, dass ein nicht sanierungswilliger Gesellschafter aus der Gesellschaft ausscheidetDem Urteil lag folgender Sachverhalt zu Grunde:1.Die Beklagte war ein geschlossener Immobilienfonds in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (im Folgenden auch „Gesellschaft“). Gesellschaftszweck war die Errichtung und Vermietung eines Wohn- und Geschäftshauses sowie zweier weiterer Wohnhäuser auf gesellschaftseigenem Grundstück.2.Der Kläger und seine Ehefrau waren an der Gesellschaft mit einer gemeinsamen Einlage beteiligt. Die Beklagte geriet in eine finanzielle Schieflage und beauftragte die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts. Das Sanierungskonzept stellte die Sanierungsbedürftigkeit der Beklagten fest, weil sie eine wachsende strukturelle Unterdeckung erwirtschaftete. Ohne Umsetzung geeigneter Sanierungsmaßnahmen drohte der Gesellschaft spätestens 2009 die Zahlungsunfähigkeit. Als Sanierungsmaßnahme wurde vorgeschlagen, das Fremdkapital auf einen geringeren, leichter bedienbaren Valutenstand zu reduzieren. Das finanzierende Kreditinstitut stimmte der vorgeschlagenen Sanierung unter der Voraussetzung einer Kapitalerhöhung von 10.225.837,62 € um insgesamt 2.700.000,00 € auf 12.925.837,62 € zu. Daraufhin fasste die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft mit der im Gesellschaftsvertrag für Satzungsänderungen vorgesehenen Stimmenmehrheit, jedoch ohne die Stimmen des Klägers und seiner Ehefrau, einen dahingehenden Kapitalerhöhungsbeschluss und beschloss des Weiteren eine Neufassung des § 18 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages, wonach ein Gesellschafter, der nicht spätestens bis zu einem festgelegten Stichtag einen seiner bisherigen Beteiligungshöhe entsprechenden Anteil am Neukapital von 2.700.000 € gezeichnet habe, aus der Gesellschaft ausscheide, ohne dass es einer weiteren Erklärung seitens der Gesellschaft bedürfe.3.Der Gesellschaftsvertrag enthält darüber hinaus folgende Bestimmungen:§ 1 Abs. 2:Halten mehrere Personen einen Anteil gemeinschaftlich, so gelten sie als ein Gesellschafter im Sinne dieses Vertrages. Sie können ihre Rechte nur einheitlich ausüben und haften gesamtschuldnerisch. Jeder von ihnen ist zur Abgabe und zum Empfang von Willenserklärungen für den anderen bevollmächtigt.§ 4 Abs. 5:Die Erhöhung des Gesellschaftskapitals ist nur mit Zustimmung aller Gesellschafterstimmen zulässig, sofern bei Überschreitung der Gesamtkosten für das gesellschaftseigene Bauvorhaben Eigengelder soweit zu erhöhen sind, wie es die Beendigung des Bauvorhabens erforderlich macht. Kommt ein einstimmiger Beschluss nicht zustande, so sind die zustimmenden Gesellschafter berechtigt, ihre Einlagen - soweit erforderlich - zu erhöhen. Die nicht zustimmenden Gesellschafter haben in diesem Fall eine Verringerung ihres Beteiligungsverhältnisses hinzunehmen.§ 12:(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt übere) die Änderung des Gesellschaftsvertrages;f) die Auflösung der Gesellschaft,g) die Festsetzung eventuell notwendiger Nachschusszahlungen sowie…(2) Beschlüsse gemäß Abs. 1 e) und f) bedürfen einer qualifizierten Mehrheit. Die qualifizierte Mehrheit beträgt 75 % aller in der Gesellschaft vorhandenen Stimmen. Für Beschlüsse gem. Abs. 1 g) gilt die Regelung des § 4 Abs. 5 entsprechend.4.Der Kläger und seine Ehefrau zeichneten die Kapitalerhöhung nicht wie ihnen angeboten. Die Ehefrau des Klägers unterzeichnete die Kapitalerhöhungsvereinbarung mit dem Hinweis, dass sie die Erklärung allein für sich und auch nur für den hälftigen Geschäftsanteil abgebe. Der Kläger gab keine Zeichnungserklärung ab.5.Nach dem Stichtag betrachtete die Beklagte den Kläger und seine Ehefrau als ausgeschieden, da die Kapitalerhöhung nicht für den gesamten von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteil gezeichnet worden sei. Mit der Ehefrau des Klägers traf die Beklagte eine „Wiederaufnahmevereinbarung" im Umfang der Hälfte der ursprünglich gemeinsam mit ihrem Ehemann gehaltenen Beteiligung. Insoweit nahm dann auch die Ehefrau an der beschlossenen Kapitalerhöhung teil.6.Das Landgericht hat auf Antrag des Klägers festgestellt, dass der gefasste Gesellschafterbeschluss zur Neufassung des § 18 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages unwirksam sei und das Gesellschaftsverhältnis der Beklagten zu dem Kläger und seiner Ehefrau unverändert fortbestehe. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Die zugelassene Revision der Beklagten beim BGH ist ebenfalls erfolglos geblieben.Der BGH gelangt zu diesem Ergebnis auf folgendem Weg:1.Die Prozessführungsbefugnis des Klägers war gegeben.Grundsätzlich ist nur der Inhaber eines Rechts befugt, dieses in eigenem Namen einzuklagen. Ausnahmsweise darf derjenige ein Recht einklagen, das nicht ihm selbst zusteht, dem dazu von Gesetzes wegen (sog. „gesetzliche Prozessstandschaft“) oder durch Ermächtigung des Rechteinhabers (sog. „gewillkürte Prozessstandschaft“) die Befugnis erteilt worden ist. Diese Befugnis zur Führung des Prozesses muss dargetan und erforderlichenfalls bewiesen werden.Vorliegend stand dem Kläger das Mitgliedschaftsrecht in der Gesellschaft nur gemeinsam mit seiner Ehefrau zu. Der Kläger war in Bezug auf das streitige Rechtsverhältnis folglich nur teilberechtigt und verfolgte mit seiner Klage somit (auch) die Feststellung des Bestehens eines sog. „Drittrechtsverhältnisses“, nämlich das seiner Ehefrau zu der Gesellschaft.Die Ehefrau des Klägers hatte die Kapitalerhöhungsvereinbarung mit dem Hinweis unterzeichnet, dass sie die Erklärung allein für sich und auch nur für den hälftigen Geschäftsanteil abgebe. Darauf kam es nach der Ansicht des BGH jedoch nicht an.Nach feststehender Rechtsprechung können auch Drittrechtsverhältnisse Gegenstand einer Feststellungsklage sein, wenn diese für die Rechtsbeziehungen der Parteien (hier: der Kläger, seine Ehefrau und die Gesellschaft) untereinander zumindest mittelbar von Bedeutung sind und ein rechtliches Interesse an alsbaldiger Klärung besteht. Weil gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages (siehe oben) der Kläger und seine Ehefrau gegenüber der Beklagten gesamtschuldnerisch haften und von der Beklagten einzeln in Anspruch genommen werden können, hängt die Frage, ob und mit welchem Inhalt Rechtspflichten des Klägers und seiner Ehefrau gegenüber der Beklagten bestehen, vom Fortbestand ihrer gemeinsamen Mitgliedschaft in der Beklagten ab. Daraus folgt das erforderliche rechtliche Interesse des Klägers, den Fortbestand des Gesellschaftsverhältnisses der Beklagten zu dem Kläger und seiner Ehefrau feststellen zu lassen. Ein dem Vorgehen des Klägers entgegenstehender Wille seiner Ehefrau war in entsprechender Anwendung von § 744 Abs. 2 BGB unbeachtlich, da die vom Kläger erhobene Feststellungsklage zur Erhaltung der gemeinsam begründeten Mitgliedschaft in der Beklagten notwendig war.Der Kläger war also prozessführungsbefugt.2.„Sanieren oder Ausscheiden“ – die Ursprungs-Entscheidung des BGH vom 19.10.2009In seiner Entscheidung vom 19.10.2009, II ZR 42/08, hat der BGH wie folgt entschieden:„Beschließen die Gesellschafter einer zahlungsunfähigen und überschuldeten Publikumspersonengesellschaft mit der im Gesellschaftsvertrag für Änderungen des Vertrages vereinbarten Mehrheit die Gesellschaft in der Weise zu sanieren, dass das Kapital „herabgesetzt” und jedem Gesellschafter frei gestellt wird, eine neue Beitragspflicht einzugehen („Kapitalerhöhung”), dass ein nicht sanierungswilliger Gesellschafter aber aus der Gesellschaft ausscheiden muss, so sind die nicht zahlungsbereiten Gesellschafter aus gesellschafterlicher Treuepflicht [Hervorhebung durch den Verfasser] jedenfalls dann verpflichtet, diesem Gesellschafterbeschluss zuzustimmen, wenn sie infolge ihrer mit dem Ausscheiden verbundenen Pflicht, den auf sie entfallenden Auseinandersetzungsfehlbetrag zu leisten, finanziell nicht schlechter stehen, als sie im Falle der sofortigen Liquidation stünden.“Nach Ansicht des BGH war es den „risikobereiten” Gesellschaftern nicht zumutbar, die Gesellschaft mit den nicht zur Investition weiteren Kapitals bereiten Gesellschaftern fortzusetzen. Zwar mussten diejenigen Gesellschafter, die sich nicht an der freiwilligen Kapitalerhöhung beteiligten, dadurch zwar - wie stets bei einer nur von einigen Gesellschaftern gezeichneten Kapitalerhöhung - eine Verringerung ihrer quotalen Beteiligung am Gesellschaftsvermögen hinnehmen (sog. „Verwässerung” des Geschäftsanteils). Der an der Kapitalerhöhung nicht teilnehmende Gesellschafter wäre aber - sobald die Sanierung erfolgreich sein würde und die Gesellschaft in die Gewinnzone gelangte – nicht nur (wenn auch im Vergleich zu vorher in geringerer Höhe) an dem Gewinn beteiligt.„Die nicht zum Einsatz neuen Kapitals bereiten Gesellschafter wären obendrein bei erfolgreicher Sanierung vor allem ohne jeden eigenen über die ursprüngliche Einlage hinausgehenden finanziellen Beitrag allein aufgrund der Tatsache, dass ihre Mitgesellschafter das Sanierungsrisiko auf sich genommen und das Gesellschaftsvermögen durch eigene – weitere – finanzielle Mittel aufgefüllt haben, zusätzlich – zumindest teilweise – von den auf sie entfallenden Gesellschaftsschulden frei geworden.“Eine solche Finanzierung der Schuldenfreiheit unter gleichzeitiger Ermöglichung einer Gewinnteilnahme hat der BGH für die finanzierenden Gesellschafter im Verhältnis zu den nicht zahlungsbereiten Gesellschaftern für nicht zumutbar gehalten.3.Grenzen der gesellschafterlichen TreuepflichtAn die vorgenannte Entscheidung knüpft nunmehr die Entscheidung des BGH vom 25.01.2011 an und verneint im konkreten Fall eine gesellschafterliche Treuepflicht des an der Sanierung der Gesellschaft nicht teilnehmenden Gesellschafters, einem Beschluss zu seinem Ausscheiden aus der Gesellschaft zu zustimmen. Der BGH begründet dies wie folgt:„Grundlage solcher Treuepflichten eines Gesellschafters kann jedoch stets nur die auf dem konkreten Gesellschaftsverhältnis beruhende berechtigte Erwartungshaltung der übrigen Gesellschafter sein. Der Gesellschaftsvertrag bildet die Grundlage der gesellschafterlichen Treuepflicht und bestimmt damit auch deren Inhalt und Umfang; der einzelne Gesellschafter ist nur insoweit verpflichtet, wie er es im Gesellschaftsvertrag versprochen hat. […] Erlaubt das eingegangene Gesellschaftsverhältnis keine berechtigte Erwartungshaltung gegenüber einzelnen Gesellschaftern, besteht auch keine Treuepflicht, diese zu erfüllen.“Nach dem BGH ist in dem vorliegenden Fall eine Erwartungshaltung dahin gehend, dass jeder Gesellschafter in der Schieflage der Gesellschaft weiteres Risiko auf sich nimmt und sich an einer Kapitalerhöhung beteiligt, durch das eingegangene Gesellschaftsverhältnis nicht begründet worden. Der BGH stellt dafür auf die Bestimmungen der § 4 Abs. 5 und § 12 Abs. 1, 2 des Gesellschaftsvertrages (siehe dazu oben) ab. Diesen Bestimmungen sei zu entnehmen, dass eine eventuell zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft notwendig werdende Kapitalerhöhung oder Nachschusszahlung einstimmig beschlossen werden müsse, wenn sie alle Gesellschafter verpflichten solle. Für den Fall, dass eine solche Einstimmigkeit nicht erzielt würde, sollten die zustimmenden Gesellschafter berechtigt sein, ihre Einlagen zu erhöhen, während die nicht zustimmenden Gesellschafter unter Verringerung ihres Beteiligungsverhältnisses in der Gesellschaft verbleiben können sollten.Mit dieser ausdrücklichen gesellschaftsvertraglichen Regelung habe sich, so der BGH, jeder Gesellschafter bei seinem Eintritt in die Gesellschaft einverstanden erklärt. Somit dürfe er nicht darauf vertrauen, einen Mitgesellschafter, der im Falle einer Schieflage der Gesellschaft zu weiteren Einlagen nicht bereit sei, unter dem Gesichtspunkt der gesellschafterlichen Treuepflicht mit einer anderen als der vertraglich vorgezeichneten Rechtsfolge – hier dem Ausscheiden aus der Gesellschaft - in Anspruch nehmen zu können. Jeder Gesellschafter müsse vielmehr damit rechnen, dass ein ggf. notwendiger zusätzlicher Kapitalbedarf der Gesellschaft nur von einem Teil der Gesellschafter aufgebracht würde, sich andere Gesellschafter dagegen nicht an der Kapitalerhöhung beteiligten und sich für den Verbleib in der Gesellschaft unter Verwässerung ihrer Gesellschaftsanteile entschieden.Eine die Grundlage für eine gesellschafterliche Treuepflicht bildende Erwartungshaltung, ein nicht an der Sanierung teilnehmender Gesellschafter werde aus der Gesellschaft ausscheiden, hat sich im vorliegenden Fall also gerade nicht bilden können.Auch der eingetretene Krisenfall habe, so der BGH, eine über diese vertraglichen Regelungen hinausgehende Treuepflicht des einzelnen Gesellschafters nicht begründet, da die Bestimmungen der § 4 Abs. 5 und § 12 Abs. 1 Buchstabe g, Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages auch einen solchen Krisenfall regelten. Stelle sich die wirtschaftliche Schieflage der Gesellschaft nicht - wie in dem in § 4 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages explizit geregelten Fall - durch eine unvorhergesehene Erhöhung der Gesamtkosten, sondern durch den Wegfall geplanter Einnahmen ein, so bestehe eine sowohl für die Gesellschaft als auch für ihre Gesellschafter vergleichbare Interessenlage. Für diesen Sanierungsfall seien diejenigen Bestimmungen, die § 4 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages für den Fall einer unerwarteten Kostenerhöhung trifft, gemäß § 12 Abs. 1 Buchstabe g, Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages entsprechend anzuwenden.Auf das Eingreifen dieser Regelungen der §§ 4 Abs. 5, 12 Abs. 1 Buchstabe g, Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages haben der Kläger und seine Ehefrau vertrauen dürfen. Sie waren nicht aufgrund seiner gesellschafterlichen Treuepflicht verpflichtet, einer diesem Vertrauen gerade widersprechende Regelung zuzustimmen, und sind dem zu Folge nicht als Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden.Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Erfurt/ Thüringen April 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abberufung des GmbH-Geschäftsführers und Beendigung des Anstellungsvertrags | Klagen im Zusammenhang mit der Abberufung von Geschäftsführern und der Beendigung des Anstellungsvertrages ... Verhältnis von Organstellung und Anstellungsvertrag ... Trennungstheorie ... Trennungsgrundsatz ... 1. Möglichkeiten der Abberufung
2. Beendigung des Anstellungsvertrages
Löffler I www.K1.de I www.gesellschaftsrechtskanzlei.com I Gesellschaftsrecht I Abberufung Geschäftsführer I Erfurt I Thüringen I Sachsen I Sachsen-Anhalt I Hessen I Deutschland 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG Brandenburg, Urteil vom 31. März 2021 – 31 C 189/19 | Gleichbehandlungsgrundsatz § 68 Abs 1 S 1 GenG, Art 3 Abs 1 GG Auch wenn gemäß der Satzung einer Genossenschaft ein Grund zum Ausschluss eines Genossenschaftsmitglieds gemäß § 68 GenG vorliegt, muss die Genossenschaft bei ihrer Ermessensentscheidung doch den„Gleichbehandlungsgrundsatz“ hinsichtlich ihrer Mitglieder mit beachten. Tenor1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist ihre Mitgliederliste zu berichtigen und den Kläger wieder als Mitglied der Beklagten zu führen, da hier festzustellen ist, dass der Beschluss des Vorstandes der Beklagten vom 24.06.2019 unwirksam ist. 2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 3. Dieses Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 3.200,00 Euro vorläufig vollstreckbar. Beschluss Der Streitwert des Rechtsstreits wird auf 2.500,00 Euro festgesetzt. TatbestandDie Beklagte – die …genossenschaft F… e.G. mit Sitz in … – ist eine im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Potsdam unter der Nummer: … P eingetragene …genossenschaft, die durch Umwandlung entstanden ist. Gegenstand des Unternehmens sind u.a. die gemeinschaftliche Bewirtschaftung des Bodens und die gemeinschaftliche Haltung der Tiere, die gemeinschaftliche Erzeugung und die gemeinschaftliche Aufbereitung von tierischen und pflanzlichen Produkten sowie deren Verkauf auf gemeinschaftliche Rechnung, der Kauf und die Pacht von Grund und Boden sowie der Kauf und die Pacht von Grundstücken, soweit diese zur Zweckerzielung der Genossenschaftsinteressen benötigt werden etc. pp.Randnummer2 Diese Genossenschaft hat sich am 06.04.2009 eine Satzung gegeben, wegen deren Einzelheiten auf die zur Gerichtsakte gereichte Ablichtung – Anlage K 3 (Blatt 14 bis 36 der Akte) – Bezug genommen wird.Randnummer3 Der Kläger war seit dem 01.11.2013 bei der Beklagten beschäftigt. Mit Beschluss vom 10.12.2013 wurde der Kläger gemäß § 18 Abs. 2 der Satzung der Klägerin vom Aufsichtsrat der Beklagten zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Genossenschaft bestellt und zwischen der Beklagten und dem Kläger am 28.03.2014 ein Dienstvertrag geschlossen.Randnummer4 Aufgrund des Beschlusses des Vorstandes der Beklagten vom 10.01.2014 wurde der Kläger zudem dann auch unstreitig Genossenschaftsmitglied der Beklagten.Randnummer5 Im März 2019 wurde der Dienstvertrag des Klägers dann unstreitig aufgehoben.Randnummer6 Am 19.06.2019 übersandte die Beklagte dem Kläger dann ein Schreiben vom 19.06.2019 – Anlage K 5 (Blatt 42 bis 44 der Akte) – zur Anhörung seiner Person hinsichtlich seines Ausschluss aus der Genossenschaft.Randnummer7 Mit Beschluss vom 24.06.2019 – Anlage K 6 (Blatt 45 bis 47 der Akte) – hat der Vorstand der Beklagten dann auch beschlossen, den Kläger aus der Genossenschaft auszuschließen.Randnummer8 Unstreitig wurden im Übrigen andere Genossenschaftsmitglieder nach Beendigung ihres jeweiligen Beschäftigungsverhältnisses bei der beklagten Genossenschaft (wie z.B. Herr E… S…, D… B…, R… E…, S… J…, R… L…, K…-D… N…, H…-D.. S…, H… T…, E… T…, S… W…, P… W… und S… W…) nicht aus der Genossenschaft ausgeschlossen.Randnummer9 Der Kläger war bisher das erste Genossenschaftsmitglied der Beklagten, dass aufgrund der Beendigung des Dienst-, Arbeits- oder Auftragsverhältnisses dann auch als Genossenschaftsmitglied durch den Vorstand der beklagten Genossenschaft ausgeschlossen wurde.Randnummer10 Der Kläger trägt vor, dass sein Ausschluss rechtswidrig sei, da dieser Ausschluss gegen den Gleichheitsgrundsatz des Genossenschaftsrechts verstoßen würde.Randnummer11 Gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung sei der Ausschluss eines Mitglieds eine Ermessensentscheidung. Der Vorstand habe bei der Ausübung seines Ermessens ihn – den Kläger – gegenüber den anderen nicht tätigen Mitgliedern aber benachteiligt.Randnummer12 Dies sei ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Den anderen Mitgliedern werde im Vergleich zu ihm – dem Kläger – ein Mehr eingeräumt. Dies sei willkürlich und sachfremd und begründe den Anspruch seiner Person, denselben Vorteil ungekürzt zu erlangen. Es sei seiner Meinung nach weder ein sachlicher Grund vorgetragen noch überhaupt ersichtlich, der eine solche Ungleichbehandlung rechtfertigen würde.Randnummer13 Der Satzungsgeber der Satzung einer Genossenschaft sei in den Formulierungen von Ausschlussgründen insofern auch nicht frei. Vielmehr habe sich der Satzungsgeber nach den §§ 6 und 7 GenG, §§ 134 und 138 BGB und dem Gebot der Verhältnismäßigkeit, der Treuepflicht, dem Gleichbehandlungsgrundsatz sowie dem Demokratieprinzip zu richten. Vom Gesetz abweichende Reglungen seien somit nur dann zulässig, wenn das GenG diese Möglichkeit ausdrücklich eröffne.Randnummer14 Zulässige Abweichungen vom GenG seien jedoch abschließend aufgelistet. Hiernach seien abweichende Reglungen vom GenG auch nach § 68 Abs. 2 GenG zulässig. Die Genossenschaft sei berechtigt, unterschiedlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen und zwischen den Mitgliedern nach sachlichen Kriterien in angemessener Weise zu differenzieren. Von dieser zulässigen Abweichung habe die Beklagte jedoch keinen Gebrauch gemacht.Randnummer15 Die Festlegung eines Ausschlussgrundes sei nur wirksam, wenn er zur ungestörten Verwirklichung des Förderzwecks der Genossenschaft und zur Sicherung der Funktionsfähigkeit sachlich gerechtfertigt und erforderlich sei.Randnummer16 Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Gesellschafts- und Genossenschaftsrecht verbietet eine willkürliche, sachlich nicht gerechtfertigte, unterschiedliche Behandlung der Gesellschafter/Mitglieder. In jedem Fall ist bei der Prüfung von Ausschlusstatbeständen ein ermessensfehlerfreies Vorgehen der betreffenden Organe sicher zu stellen. Nach der Rechtsprechung des BGH kann das Ermessen der zuständigen Organe auch auf null reduziert werden. Der Grundsatz der Gleichbehandlung verbietet eine Ausschließung, wenn ein anderes Mitglied bei Vorliegen desselben Sachverhalts nicht ausgeschlossen wurde und auch keine besonderen Gesichtspunkte vorliegen, die eine unterschiedliche Behandlung im Übrigen rechtfertigen würden.Randnummer17 Auch bei einer Genossenschaft sei es zwar Ermessenssache, ob im Einzelfall von einem Ausschlussgrund Gebrauch gemacht wird; aber hinsichtlich des Ausschlusses eines Mitglieds darf das eine Mitglied in gleichliegenden Fällen nicht schlechter behandelt werden als andere Mitglieder, da sonst eine rechtsfehlerhafte Ausübung des Ermessens vorliege, die den Ausschluss zu einer offenbar unbilligen und damit rechtlich unwirksamen Maßnahme mache. Eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes führe dazu, dass der benachteiligte Genosse so zu stellen sei, wie bevorzugte Mitglieder gestellt worden sind.Randnummer18 Im vorliegenden Fall seien andere Mitglieder aus der Genossenschaft nicht ausgeschlossen worden, deren Beschäftigungsverhältnisse, ganz gleich aus welchem Grund, beendet wurden. Auch er – der Kläger – habe sich, mit Ausnahme der Beendigung, des Anstellungsverhältnisses nichts Nachteiliges zu Schulden kommen lassen. Sein Verhalten habe die Genossenschaft weder beeinträchtigt, noch der Genossenschaft einen Schaden zugefügt. Es würden keine rechtfertigenden Umstände für einen Ausschluss vorliegen.Randnummer19 Die Entscheidung des Vorstandes Mitglieder, deren Beschäftigungsverhältnis endete, nicht auszuschließen und im vorliegenden Fall ein Ausschluss vorzunehmen, sei somit rein willkürlich und nur nach Gusto erfolgt. Allein die Begründung, dass langjährige Mitglieder einen Sonderstatus, d.h. eine Privilegierung genießen, die ein Mitglied, welches nur kürzer in der Genossenschaft Mitglied war, nicht besitze, sei aber nicht hinreichend für die Begründung besonderer Umstände.Randnummer20 Zwar sei es sachlich zulässig, dass Genossenschaften sich Satzungen geben, welche das Recht zum Ausschluss nach Dauer der Mitgliedschaft differenziert regeln. Es verstoße insofern auch nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und das Demokratiegebot, wenn die Satzung regeln würde, dass Aufnahmevoraussetzung ein Beschäftigungsverhältnis sei. Auch sei eine Regelung sachgerecht, dass nach Wegfall der Aufnahmevoraussetzung (Beschäftigungsverhältnis), ein Ausschluss möglich sei. Zudem dürften auch Satzungen von Genossenschaften Regelungen enthalten, die Mitglieder für sich genommen ungleich behandeln (relative Gleichbehandlung). Voraussetzung für eine sachlich gebotene relative Gleichbehandlung sei aber die Einhaltung der aufgeführten Gebote, Prinzipien und Grundsätze. Eine relative Gleichbehandlung setze somit voraus, dass vergleichbare Mitglieder gleich behandelt werden und nicht vergleichbare Mitglieder in Kenntnis der relativen Gleichbehandlung Ihr Tun oder Unterlassen entsprechend einrichten könnten. So könnte die Beklagte die Satzung so gestalten, dass Mitglieder, die beispielsweise länger als 5, 10 oder 15 Jahre Mitglied der Genossenschaft waren, nicht mehr ausgeschlossen werden dürfen, nur weil das Beschäftigungsverhältnis weggefallen ist. Mit einer solchen Regelung wären das Demokratieprinzip, das Willkürverbot und der Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt.Randnummer21 Er – der Kläger – rüge hier aber ausdrücklich, dass die Satzung der Beklagten eine derartige begründete Privilegierung oder relative Gleichbehandlung von Mitgliedern nicht enthalte und jede Entscheidung über den Ausschluss dadurch gegen das Willkürverbot verstoßen würde. Umgekehrt verstoße mangels einer derartigen Satzungsregelung, der Verbleib von Mitgliedern, die das Beschäftigungsverhältnis beendet haben, im Verhältnis zum Ausschluss des Klägers gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, das Willkürverbot und das Demokratiegebot. Der Genossenschaft stehe es frei, Privilegierungstatbestände Gesetzeskonform zu regeln. Mache die Genossenschaft von dieser Möglichkeit jedoch keinen Gebrauch, so dürfe sie Privilegierungen von Mitgliedern nur Rahmen der eigenen Satzungsreglungen vornehmen. Dagegen habe die Beklagte vorliegend aber ohne Not seiner Ansicht nach massiv verstoßen.Randnummer22 Bei der Wahl der Sanktionen gegen Mitglieder sei immer die Angemessenheit zu beachten. Auch seien stets die schonendsten Mittel zu ergreifen. Sofern Produktivgenossenschaften verhindern wollten, dass nicht mehr im Unternehmen beschäftigte Mitglieder die Stimmenmehrheit erlangen, gebe es deutlich schonendere Mittel als den Ausschluss indem diese Mitglieder, die nicht mehr im Unternehmen tätig sind, als investierende Mitglieder zugelassen und ihnen gleichzeitig die Stimmrechte beschränkt werden. Dabei würden diese Stimmrechte zum Teil auf null reduziert. Auch dies ist nach dem GenG, insbesondere § 8 Abs. 2 GenG zulässig. Mit einer solchen Regelung verhindere man in Produktivgenossenschaften, dass sich die Stimmrechte Mehrheitlich auf nicht mehr tätige Mitglieder vereinigen. Mitgliedern ohne Beschäftigungsverhältnis das Recht einzuräumen, als stimmrechtslose oder stimmrechtsbeschränkte investive Mitglieder in der Genossenschaft zu verbleiben, stelle aber ein wesentlich milderes und verhältnismäßigeres Mittel für die Lösung eines solchen Konfliktes dar. Der Ausschluss stelle hingegen den stärksten Eingriff in die Eigentumsrechte eines Mitglieds dar. Ein milderes Mittel sei der Verweis auf stimmrechtslose oder stimmrechtsbeschränkte Mitgliedschaften, die von denjenigen eingegangen werden können, die das Beschäftigungsverhältnis zur Genossenschaft beenden.Randnummer23 Mit dem Verlust der Mitgliedschaft verliere, gerade in einer …Genossenschaft, ein Mitglied sein erworbenes Eigentumsrecht an einer überwiegenden vermögenden Genossenschaft. Der Kläger beklage daher nicht nur den Verlust seiner mitgliedschaftlichen Rechte, sondern auch den Verlust eines Anspruchs auf Beteiligung am Vermögen der Genossenschaft. Derzeit sei ein rigoroser Strukturwandel bei Agrar-Genossenschaften festzustellen. Immer mehr Agrar-Genossenschaften würden nämlich in die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft wechseln.Randnummer24 Im Falle der Umwandlung sei den Mitgliedern ein Barabfindungsangebot zum Verkehrswert zu unterbreiten. Die Barabfindungsangebote würden sich nicht selten auf mehreren 100.000,00 Euro pro Mitglied belaufen. Würde sein Ausschluss greifen, hätte er – der Kläger – aber nur einen Anspruch auf den Nennwert seines Geschäftsguthabens in Höhe von 2.500,00 Euro.Randnummer25 Der zurzeit häufigste Weg in der Praxis zur Lösung des Generationswechsels, sei die Veräußerung der Geschäftsguthaben an einen Dritten zum Verkehrswert. Bei Veräußerung aller Geschäftsguthaben könnten die Mitglieder hier aber seiner Ansicht nach insgesamt einen Kaufpreis von mindestens 10.000.000,00 € (zehn Millionen Euro) realisieren. Durch den Ausschluss wäre er – der Kläger – aber gehindert, den tatsächlichen Wert seiner Geschäftsanteile zu realisieren. Der Ausschluss stelle daher für ihn auch einen erheblichen wirtschaftlichen Eingriff dar.Randnummer26 Dagegen sei sein Verbleib in der Genossenschaft für die Genossenschaft mit keinerlei Nachteilen verbunden. Jedes Mitglied habe nur eine Stimme. Er allein könne keine Mehrheitsentscheidung beeinflussen. Solange die Genossenschaft in ihrem Bestand fortbestehe, nehme er als Mitglied am genossenschaftlichen Leben teil und erhalte bestenfalls anteilig seine Gewinnausschüttung. Bei Abwägung der wechselseitigen Interessen sowie der Vor- und Nachteile, gebe es unter Berücksichtigung der genossenschaftlichen Treuepflichten und des Gleichheitsgrundsatzes somit hier keinen Grund, ihn aus der Genossenschaft auszuschließen, während dessen andere Mitglieder, die faktisch den gleichen rechtlichen Status wie er genießen, in der Genossenschaft verbleiben können. Die Interessen der Mitglieder am Fortbestand ihrer Mitgliedschaft müssten aber stets eine angemessene Berücksichtigung finden.Randnummer27 Allein die Begründung, dass langjährige Mitglieder einen Sonderstatus d.h. eine Privilegierung genießen, die ein Mitglied, welches nur kürzer in der Genossenschaft Mitglied war, nicht besitze, sei nicht hinreichend für die Begründung besonderer Umstände.Randnummer28 Da nach § 9 Abs. 7 der Satzung der verklagten Genossenschaft der Rechtsweg dann ausgeschlossen sei, wenn das ausscheidende Mitglied von der Beschwerdemöglichkeit nach § 9 Abs. 6 der Satzung gebraucht mache, würde er nunmehr vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit Klage erheben.Randnummer29 Der Kläger beantragt,Randnummer30 die Beklagte zu verurteilen, ihre Mitgliederliste zu berichtigen und ihn – den Kläger – wieder als Mitglied der Beklagten zu führen.Randnummer31 Die Beklagte beantragt,Randnummer32 die Klage abzuweisen.Randnummer33 Die Beklagte behauptet, dass zwar mit Begründung des Dienstverhältnisses zwischen ihr und dem Kläger dessen Mitgliedschaft in der Genossenschaft begründet worden sei. Bei dessen Begründung habe jedoch dahingehend Einigkeit bestanden, dass die Aufnahme des Klägers als Genosse ausschließlich im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die beklagte Genossenschaft erfolgen solle und enden werde, so die Tätigkeit des Klägers für die Genossenschaft – aus welchem Grund auch immer – enden würde.Randnummer34 Diese Abrede sei auch von ihr in der schriftlichen Anhörung vom 19.06.2019 – Anlage K 5 (Blatt 42 bis 44 der Akte) – zitiert worden. Ein Schriftformerfordernis für Nebenabreden habe der Dienstvertrag im Übrigen nicht vorgesehen.Randnummer35 Hinsichtlich der Beendigung des Engagements des Klägers bei ihr – der Beklagten – und dessen Vollzug sei es ihr ausdrückliches Ziel gewesen, auch die Mitgliedschaft des Klägers in der Genossenschaft zu beenden. Dieses Ziel sei ausdrücklich und mehrfach gegenüber dem Kläger unmissverständlich geäußert worden.Randnummer36 Im Zuge der weiteren Beratungen sei dann auch eine Klärung hinsichtlich des Dienstverhältnisses und der Organstellungen des Klägers erfolgt, eine abschließende Klärung der Mitgliedschaft sei jedoch nicht erfolgt. Zwar sei dem Kläger im Zuge der Vereinbarung eines Aufhebungsvertrages auch eine Vereinbarung zum Ausscheiden als Mitglied der Genossenschaft angetragen worden, im Gegensatz zum Aufhebungsvertrag sei aber die Vereinbarung zum Ausscheiden als Mitglied nicht vom Kläger gezeichnet worden.Randnummer37 Mit dem streitgegenständlichen Beschluss vom 24.06.2019 – Anlage K 6 (Blatt 45 bis 47 der Akte) – sei nach einer ausführlichen Anhörung mit Gelegenheit zur Stellungnahme der Ausschluss des Klägers beschlossen worden. Die Bekanntgabe an den Kläger sei satzungsgemäß per Einschreiben erfolgt. Da der Zugang zunächst scheiterte sei ein weiteres Schreiben von ihr an den Kläger vom 05.07.2019 erfolgt, welches den Kläger auch nicht erreicht habe.Randnummer38 Unstreitig sei zwar, dass andere Genossenschaftsmitglieder nach dem Ende ihrer Beschäftigung nicht aus der beklagten Genossenschaft ausgeschlossen worden seien. Dies mache den Beschluss vom 24.06.2019 – Anlage K 6 (Blatt 45 bis 47 der Akte) – indes ihrer Meinung nach nicht rechtsfehlerhaft.Randnummer39 Die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes setze nämlich eine willkürliche Ungleichbehandlung von Gleichen voraus. Dem sei vorliegend aber nicht so. Der Kläger setze insofern schlicht Genosse gleich Genosse. Würde allein die Unterscheidung zwischen Genosse und Nichtgenosse ausreichend sein, wären weitere Begründungen und Darlegungen von vornherein denklogisch unerheblich. Dem sei hier aber gerade nicht so. Kein Genosse, den der Kläger genannt habe, sei mit dem Kläger tatsächlich vergleichbar, bis eben auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, dass sie alle Genossen der Beklagten sind bzw. waren.Randnummer40 Die Unvergleichbarkeit ergebe sich zum einem aus der Begründung der Mitgliedschaft der vom Kläger genannten Genossen, deren Tätigkeit während der tatsächlichen beruflichen Tätigkeit, deren Beendigung der Tätigkeiten, deren Fortwirken auf die Genossenschaft und deren Ziele auch nach dem Ausscheiden aus der aktiven, bezahlten Tätigkeit für die Genossenschaft.Randnummer41 Das Mitglied E… S… sei Gründungsmitglied der Genossenschaft gewesen und von 2004 bis 2014 Geschäftsführer der Genossenschaft und stehe der Genossenschaft nach wie vor beratend zur Seite. Herr D… B… sei auch ein Gründungsmitglied der Genossenschaft gewesen und nunmehr Alters-Renter. Er biete ihr – der Genossenschaft – als Verpächter die Grundlage dafür, den satzungsgemäßen Gegenstand der Genossenschaft auch weiterhin erfüllen zu können. Herr R… E… sei ebenso Gründungsmitglied der Genossenschaft sowie Vorsitzender des Aufsichtsrats der Genossenschaft gewesen und derzeitig Verpächter. Auch Herr S…J… sei Gründungsmitglied der Genossenschaft gewesen und nunmehr Rentner sowie Verpächter. Herr R… L… ebenso.Randnummer42 Herr K… D… N… sei Gründungsmitglied der Genossenschaft gewesen, nunmehr Rentner und stehe wie die vorstehenden Genossen mit seiner Erfahrung nach wie vor der Genossenschaft zur Verfügung. Dies sei auch bei Herrn H…-D… S… und Herrn H… T… der Fall. Auf Frau E… T… würden vorstehende Tatsachen ebenso zutreffen. Darüber hinaus sei sie auch Verpächterin. Herr S… W… sei ebenso Gründungsmitglied der Genossenschaft gewesen und habe viele Jahre der Genossenschaft vorgestanden und seine Tätigkeit als Rentner beendet. Frau P… W… sei auch ein Gründungsmitglied der Genossenschaft und jetzt Rentnerin und Verpächterin. Herr S… W… sei ebenso Gründungsmitglied der Genossenschaft und nunmehr Rentner und Verpächter. Frau D… A… sei ebenfalls Gründungsmitglied der Genossenschaft und darüber hinaus auch Verpächterin.Randnummer43 Soweit der Kläger vortragen lasse, dass die vorgenannten Genossen mittlerweile in Rente gegangen seien und nicht durch sie – die beklagte Genossenschaft – ausgeschlossen wurden, stehe damit unstreitig eine Tatsache fest, nämlich der Eintritt in das Rentenalter. Dies mache den Kläger mit den vorgenannten Personen aber gerade nicht vergleichbar, sondern würde ihn zwingend und objektiv von diesen Personen unterscheiden. Der Kläger sei unstreitig nämlich nicht ins Rentenalter eingetreten. Der Kläger habe darüber hinaus nicht - wie vorstehende Genossen - seine gesamte berufliche Tätigkeit, seine Kraft und sein Können bis ins Rentenalter der Genossenschaft zur Verfügung gestellt.Randnummer44 Alle zum Vergleich ins Feld geführten Genossen hätten maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass die Genossenschaft für den Kläger überhaupt als Arbeitgeber interessant geworden sei. Diese Genossen hätten das mit ihrer Lebensleistung geschaffen, was der Kläger verwalten, beschützen und mehren sollte. Keiner der Vorgenannten habe sich mit einer Vereinbarung verabschiedet, über deren Inhalt Schweigen vereinbart worden sei. Dies sei somit noch ein Kriterium, dass den Kläger maßgeblich von vorgenannten Genossen unterscheiden würde.Randnummer45 Möge der Kläger darlegen, inwieweit er mit den vorgenannten Genossen vergleichbar sei und inwieweit durch die Genossenschaft in dessen Person eine Ungleichbehandlung vorliege.Randnummer46 Die Klage sei somit unbegründet.Randnummer47 Der Ausschluss des Klägers aus der Genossenschaft sei formell und materiell rechtmäßig. Nur Genossen hätten einen Anspruch, in der Mitgliederliste geführt zu werden.Randnummer48 Vorliegend würde es sich ausschließlich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit handeln, da das Interesse des Klägers ausschließlich von Vermögensinteressen geprägt sei. Ein Interesse an der Förderung des Genossenschaftszwecks behaupte nämlich noch nicht einmal der Kläger.Randnummer49 Mit dem Wesen der Genossenschaft ist es grundsätzlich aber nicht vereinbar, dass die Mitgliedschaft lediglich aus Gründen der rentablen Geldanlage erstritten und beibehalten werden soll. Andere Schlüsse lasse der Klagevortrag aber nicht erkennen.Randnummer50 Der Kläger habe auch den satzungsgemäßen Ausschließungsgrund nach § 9 Absatz 1 Buchstabe f) der Satzung erfüllt; dies werde auch nicht vom Kläger bestritten.Randnummer51 Ihre Satzung siehe im Übrigen zwar vor, dass eine erworbene Mitgliedschaft unverzüglich in die Mitgliederliste einzutragen sei (§ 3 Absatz 4 der Satzung). Im umgekehrten Falle bestehe eine solche Verpflichtung aber nicht zwingend.Randnummer52 Der Beschluss vom 24.06.2019 sei somit wirksam und rechtmäßig. Das angerufene Gericht habe zwar sowohl die formelle Rechtmäßigkeit als auch die sachliche Berechtigung des Beschlusses zu prüfen. Es sei aber nicht berufen, die Zweckmäßigkeit des Ausschlusses und die Ermessensausübung des zuständigen Organs der Genossenschaft zu beurteilen.Randnummer53 Die richterliche Nachprüfung beschränke sich daher auf die Frage, ob der Ausschluss gesetzeswidrig, sittenwidrig oder offenbar unbillig war bzw. ob der dem Ausschluss zu Grunde gelegte Sachverhalt unter Berücksichtigung von Gesetz, Satzung sowie Treu und Glauben und des zwischen der eG und dem Mitglied bestehenden genossenschaftlichen Treueverhältnisses die Ausschließung rechtfertigen würde.Randnummer54 Der Ausschluss sei hier aber gerechtfertigt; der Beschluss sei weder gesetzeswidrig, noch sittenwidrig oder unbillig.Randnummer55 Grundsätzlich bestehe auch nicht die Pflicht der Genossenschaft, ein Mitglied auszuschließen, so ein Ausschließungsgrund erfüllt sei. Das zuständige Organ sei gehalten, im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens zu prüfen, ob eine Ausschließung erfolgen soll und eine solche gerechtfertigt ist. Eine Pflichtverletzung des Organs läge aber nur dann vor, wenn dieses Organ die Prüfung nicht vornimmt oder eine Entscheidung trifft, die nicht mehr im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens liegt.Randnummer56 Unterschiedliche Sachverhalte würden aber unterschiedliche Behandlungen rechtfertigen.Randnummer57 Soweit der Kläger die Behauptung aufstelle, dass Privilegierungen von Mitgliedern in der Satzung geregelt sein müssten, sei dieser Einwand, wenn denn überhaupt, nur dann relevant, wenn es sich tatsächlich um Privilegierungen handeln würde. Bislang werde dies durch den Kläger aber nur behauptet.Randnummer58 So es sich sodann um Privilegierungen handeln sollte, sei die Notwendigkeit, solche in einer Satzung ausdrücklich zu regeln, in dieser Absolutheit dem in § 8 GenG geregelten fakultativen Satzungsvorbehalt für einzelne Bestimmungen nicht zu entnehmen.Randnummer59 Gleichwohl – selbst wenn dem so sein sollte – habe sie keine Privilegierungen geschaffen, sondern das ihren Organen satzungsgemäß eingeräumte Ermessen nur ausgeübt.Randnummer60 Einwände gegen die formelle Rechtmäßigkeit des Ausschlusses werden nicht erhobenRandnummer61 Das handelnde Organ habe vor Beschlussfassung die Sachverhalte ermittelt, abgewogen und nach ausführlicher Anhörung des Klägers sodann den angegriffenen Beschluss gefasst. Hierbei sei auch berücksichtigt worden, dass die anderen Mitglieder - s.o. - im Rahmen des Grundsatzes von Treu und Glauben und dem sich hieraus ergebenen Treueverhältnis einen anderen Treueanspruch gegenüber der Genossenschaft für sich in Anspruch nehmen könnten, als dies der Kläger für sich beanspruchen könne.Randnummer62 Der Kläger könne sich nur mit Erfolg auf eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes berufen, so in jeder Einzelfallprüfung jeder einzelne Fall der anderen Genossen mit dem Kläger deckungsgleich gewesen sei und er willkürlich ungleichbehandelt wurde.Randnummer63 Das Recht der Mitglieder auf Gleichbehandlung durch die Genossenschaft bestehe absolut lediglich hinsichtlich der Höhe des Geschäftsanteils, einer satzungsmäßig festgelegten Höchstzahl der freiwillig übernehmbaren Geschäftsanteile, der Höhe der Haftsumme, des Rechts zur Kündigung der Mitgliedschaft und der Frist für die Kündigung freiwillig übernommener Geschäftsanteile.Randnummer64 Außerhalb dieses abschließenden Kataloges gebe es lediglich ein Recht der relativen Gleichbehandlung. D.h., jedes Mitglied habe bei gleichen Voraussetzungen das Recht auf Gewährung gleicher Rechte und auf Auferlegung lediglich gleicher Pflichten. Bei ungleichen Voraussetzungen sei eine sachlich angemessene Differenzierung der Rechte und Pflichten gerechtfertigt. Das Gleichbehandlungsgebot räume damit einen Ermessensspielraum ein, der seine Schranken erst im Ermessens-Missbrauch finde.Randnummer65 Die hier unstreitige Tatsache, dass die Genossen in „Rente gegangen sind“ sei aber ein Merkmal, dass tatsächlich nicht auf den Kläger zutreffen würde. Im Rahmen dessen sekundärer Beweislast sei daher der Kläger gehalten, darzulegen und unter Beweis zu stellen, warum er gleichwohl ebenso behandelt werden wolle bzw. warum die Genossenschaft gehalten sein soll, den Kläger diesen Genossen gleich zu behandeln.Randnummer66 Selbiges gelte für Mitglieder, die als Verpächter und / oder Berater den Unternehmensgegenstand der Genossenschaft fördern würden.Randnummer67 Eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes - schon gar nicht willkürlich oder / krass – sei tatbestandsmäßig. Der Vortrag des Klägers erschöpfe sich letztlich in der nicht erwiesenen Behauptung, es lägen Privilegierung vor, die satzungsrechtlich nicht geregelt und von daher per se willkürlich und krass seien. Eine gerichtliche Entscheidung sei aber z.B. erst dann willkürlich, wenn sie unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar sei und sich daher der Schluss aufdränge, dass sie auf sachfremden Erwägungen beruhe. Fehlerhafte Auslegung eines Gesetzes allein mache eine Gerichtsentscheidung allerdings nicht willkürlich. Willkür liege vielmehr erst vor, wenn eine offensichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt oder der Inhalt einer Norm in krasser Weise missdeutet werde. Das sei anhand objektiver Kriterien festzustellen. Schuldhaftes Handeln sei nicht erforderlich.Randnummer68 Werde dieser Maßstab auf Beschlüsse von Organen einer Genossenschaft angewendet, sei vorliegend Willkür nicht erkennbar.Randnummer69 Da nach dem klägerischen Vortrag offenbar willkürliches Handeln der Beklagten für dessen Klageziel erforderlich sei, ein solches Handeln an Hand des zitierten Maßstabes hier aber ihrer Ansicht nach nicht vorliege, scheitere das Begehren des Klägers bereits an dieser Voraussetzung.Randnummer70 Der Gleichbehandlungsgrundsatz verbiete eine Ausschließung, wenn ein anderes Mitglied wegen desselben Sachverhalts nicht ausgeschlossen wurde und auch keine besonderen Gesichtspunkte vorliegen, die eine unterschiedliche Behandlung im Übrigen rechtfertigen. Hierbei seien alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Das GenG und die auf diesem Gesetz beruhende Satzung würden eine unterschiedliche Behandlung aber gerade nicht verbieten.Randnummer71 Zu den Umständen des hier zu beurteilenden Einzelfalles würde sie – die Beklagte – ausführen, dass die Gründungsmitglieder mit der Gründungsversammlung vom 18.12.1990 die Gründung der …genossenschaft „F…“ e.G. mit Sitz in K… beschlossen hätten. Als Mitglieder der Gründungsgenossenschaft seien auch die vom Kläger genannten Mitglieder in die Mitgliederliste eingetragen worden. Diese Gründungsmitglieder seien zuvor Mitglieder in der Pflanzenproduktion D… oder der Tierproduktion K… gewesen und hätten u.a. ihre Arbeitsjahre in die neu gegründete PG eingebracht und auf Abfindungen verzichtet.Randnummer72 Der Kläger sei aber unstreitig kein Gründungsmitglied der Beklagten und daher diesen ungleich. Diese Ungleichheit liege in der Natur der Sache und nicht in der Willkür der Beklagten.Randnummer73 Die Beendigung der Tätigkeit des Klägers sei zudem durch aktives Handeln verursacht worden. Eine willkürliche Ungleichbehandlung ergebe sich auch nicht daraus, dass die Tätigkeit der anderen Mitglieder für die Genossenschaft geendet habe. Die vom Kläger genannten Mitglieder hätten ihre Arbeitsverhältnisse nicht durch Kündigung, Aufhebung oder anderweitig – also nicht durch eine willentliche Rechtshandlung – beendet. Vielmehr endeten die Arbeitsverhältnisse mit Eintritt in das gesetzliche Rentenalter.Randnummer74 Anders hingegen beim Kläger. In Kenntnis der Satzung - insbesondere angesichts des klaren und unmissverständlichen Ausschließungstatbestand des § 9 Absatz 1 Buchstabe f) - habe der Kläger dessen tatbestandlichen Voraussetzungen willentlich herbeigeführt. Am 27.03.2018 habe der Kläger ausdrücklich erklärt, das Dienstverhältnis mit Ablauf des 30.06.2018 beenden zu wollen. Diese Erklärung sei formgerecht mit Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrages erfolgt, in dessen Ergebnis das Dienstverhältnis mit Ablauf des 30.06.2018 enden sollte und auch geendet habe.Randnummer75 Die zum Vergleich herangezogenen Mitglieder hätten ihre Tätigkeit aber nicht willentlich beendet; der Kläger schon.Randnummer76 Auch liege hier keine Ungleichbehandlung durch Ausschluss „anderer“ Mitglieder vor. Soweit der Kläger behaupten würde, sie – die Beklagte – belasse „Altmitglieder in der Genossenschaft und schließe andere Mitglieder aus“, sei auch dies unzutreffend. Streitgegenständlich sei allein der Ausschluss des Klägers.Randnummer77 Darüber hinaus seien die Gründungsmitglieder und der Kläger aufgrund der Umstände und den Bedingungen der Beendigung ihrer jeweiligen Tätigkeiten zur Beklagten nicht vergleichbar. Die Gründungsmitglieder seien aus dem Beschäftigungsverhältnis in den Rentenbezug gewechselt. Der Kläger sei mit Aufhebungsvertrag u.a. unter Fortzahlung der Bezüge und Urlaubsgewährung vom 09.03.2018 bis 30.06.2018 unwiderruflich von der Verpflichtung zur Erbringung der vertraglichen Dienstleistung freigestellt worden. Ferner sei dem Kläger eine Abfindung in erheblicher 5-stelliger Höhe von ihr – der Beklagten – gezahlt worden. Derartige Leistungen hätten die nicht ausgeschlossenen Mitglieder von der Beklagten aber nicht erhalten.Randnummer78 Auf einen Nichtausschluss anderer Mitglieder könne sich der Kläger - wenn überhaupt - jedenfalls zum Zeitpunkt seines Ausschlusses auch nicht (mehr) berufen. Laut Satzung könne ein Ausschluss aus der Genossenschaft zum Schluss des Geschäftsjahres aus satzungsgemäßen Gründen beschlossen werden. Relevant sei hier das Geschäftsjahr von 01.07.2018 bis 30.06.2019 (vgl. § 41 der Satzung). Ihr zuständiges Organ sei daher zunächst gehalten gewesen, die Prüfung eines Ausschließungstatbestandes vorzunehmen, da anderenfalls sich dieses Organ ihr – der Beklagten – gegenüber pflichtwidrig verhalten hätte. Diese Prüfung sei auch vorgenommen worden.Randnummer79 Hätten zu diesem Zeitpunkt mehrere vergleichbare Mitglieder einen entsprechenden Tatbestand verwirklicht, wär in der Tat ein Ausschluss nur des Klägers pflichtwidrig, wenn die Ausübung des pflichtgemäßen Ermessen den Ausschluss mehrerer verlangt hätte.Randnummer80 Unterstellt, die vom Kläger genannten Mitglieder hätten den Tatbestand des § 9 Abs. 1 Buchstabe f) der Satzung erfüllt und seien - Vergleichbarkeit ebenso unterstellt - zwingend auszuschließen, so würde deren Ausschluss aber am Geschäftsjahr scheitern. Unstreitig dürfte insoweit nämlich sein, dass bei keinem der genannten Mitglieder der Grund des § 9 Abs. 1 Buchstabe f) der Satzung im Geschäftsjahr 2018/2019 eingetreten sei.Randnummer81 Ihr zuständiges Organ habe vielmehr im betreffenden Geschäftsjahr geprüft und die streitgegenständliche Entscheidung getroffen. So sich das Organ in den vergangenen Jahren nicht satzungsgemäß verhalten haben sollte und auch andere Mitglieder hätte ausschließen müssen, könne sich der Kläger hierauf nicht berufen; eine Gleichbehandlung im Unrecht kenne die Rechtsordnung nicht.Randnummer82 Einzig der Kläger habe zum Zeitpunkt der pflichtgemäßen Prüfung ihres Organs den streitgegenständlichen Ausschließungstatbestand im relevanten Geschäftsjahr erfüllt.Randnummer83 So versucht werden sollte, durch nicht erfolgte Ausschlüsse eine Ermessungsreduzierung auf Null zu konstruieren, hätte dies zur Konsequenz, dass sie – die Beklagte – auch zu keinem anderen Zeitpunkt mehr ein Mitglied gestützt auf den hier angewendeten Ausschließungstatbestand ausschließen könnte. Selbst eine Änderung der Satzung würde in der Endkonsequenz zu keinem anderen Ergebnis führen.Randnummer84 Alle Besonderheiten könnten im Übrigen schon rein praktisch nicht im Einzelnen satzungsrechtlich geregelt werden. Genau für diese Einzelheiten sei dem entsprechenden Organ ein Ermessen – „kann“ – eingeräumt worden.Randnummer85 Der Vorstand als ihr zuständiges Organ habe sich in seiner personellen Besetzung verändert. Es sei dem Vorstand zuzugestehen, eigene Erwägungen anzustellen. Ein vorheriger Vorstand habe bislang nicht über ein Mitglied zu entscheiden gehabt, das mit dem Inhalt und der Leistung des vorzitierten Aufhebungsvertrages aus seinem Dienstverhältnis ausgeschieden ist. Andere Verhältnisse - andere Entscheidungen immer bezogen auf die Umstände des Einzelfalls.Randnummer86 Soweit der Kläger die Beendigungstatbestände a) bis d) zitieren lasse, sei klarzustellen, dass die Beteiligten diese kennen. Allerdings seien in der Vergangenheit unter Leitung des Klägers regelmäßig derartige Vereinbarungen geschlossen worden. Unter dem 17.02.2015 habe ihr Vorstand – handelnd durch den Kläger – und Herrn S… mit Frau K… T… eine Vereinbarung getroffen. Auch am 20.02.2015 habe der Vorstand in gleicher Besetzung mit Herrn R… W… eine diesbezügliche Vereinbarung geschlossen. Ebenso am 25.02.2015 mit Frau C… H….Randnummer87 Auf eben jene Verfahrensweise sei der Kläger mit der Anhörung vom 19.05.2019 verbunden mit dem Hinweis - wie besprochen – erinnert worden. Dem Kläger sei eine gleichlautende Vereinbarung dieses Inhalts mit Schreiben vom 13.03.2019 in Vollzug der getroffenen Vereinbarungen auch übersandt worden.Randnummer88 Hätte der Kläger ihr gegenüber erklärt, er werde diese Vereinbarung nicht vollziehen, wäre der Aufhebungsvertrag mit dem Kläger durch sie – die Beklagte – nicht geschlossen worden. Sie – die Beklagte – habe davon ausgehen dürfen, dass dann eine rechtliche Beratung erteilt worden wäre, die die Möglichkeit anderweitigen rechtlichen Handelns aufgezeigt hätte, so der Kläger nicht die „Rückübertragung“ dessen Anteils an die Genossenschaft auf eben jenen Weg der „Vereinbarung“ ausdrücklich in Aussicht gestellt hätte.Randnummer89 Im Ergebnis habe sich der Kläger an die getroffene Vereinbarung jedoch ohne jede Begründung nicht gehalten, und zwar nachdem er erlangt habe, was er begehrte. Soweit sich der Kläger nunmehr gegen den Ausschlussbeschluss aus der Genossenschaft wehre, sei diese Rechtsausübung nach dem Grundsatz venire contra factum proprium nach Treu und Glauben unzulässig, da dieses im krassen Widerspruch zu eigenem früheren Verhalten stehe.Randnummer90 Unzulässig ist die Rechtsausübung auch nach der dolo agit Einrede.Randnummer91 Die Differenzierung der Mitglieder sei nämlich durch Tatsachen begründet; es seien nicht Altmitglieder - wo beginnt „alt“??? – sondern Gründungsmitglieder.Randnummer92 Sie – die Beklagte – sei in ihrer bisherigen Praxis nicht veranlasst gewesen, von Ausschließungstatbeständen Gebrauch zu machen. Insoweit sei die Behauptung der Klägerseite: „Mitglieder hingegen, die nur fünf oder sieben oder zehn Jahre, oder welche Zeit auch immer Mitglied gewesen sind, werden dagegen ausgeschlossen“ schlicht falsch.Randnummer93 In Ermangelung der Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sei der Beschluss vom 24.06.2019 somit wirksam; eine Berichtigung der Mitgliederliste unter Eintragung des Klägers als Mitglied der Beklagten unbegründet und die Klage daher abzuweisen.Randnummer94 Der Kläger verkenne hier, dass die Behandlung eines einzigen Mitgliedes - und es handelt sich nur einzig um den Kläger - nicht deshalb treuwidrig werde, weil dieses einzige Mitglied anders behandelt worden ist. Der Kläger ist nämlich ihrer Ansicht nach - und insbesondere zu den von ihm genannten Mitgliedern - aus den ausführlich geschilderten Gründen objektiv anders.Randnummer95 Es sei aber nicht treuwidrig, sich auf Satzung und Genossenschaftsgesetz zu berufen. Treuwidrig sei es allerdings, wenn die Erfüllung getroffener Vereinbarung einseitig angenommen und eigene Verpflichtungen nicht erfüllt werden.Randnummer96 Weder eine Umwandlung noch eine Liquidation der Genossenschaft würden auf der Tagesordnung stehen. Insoweit verbiete sich die Diskussion über das eine als auch das andere Szenario. Im Streit stehe vorliegend auch nicht § 45 der Satzung, der kein Ermessen oder Ausnahmetatbestände ermögliche. Im Streit stehe § 9 der Satzung, der den handelnden Organen ein solches ausdrücklich einräumen würde und wovon sie – die Beklagte – pflichtgemäß Gebrauch gemacht habe.Randnummer97 Der Kläger verkenne offenbar seinen Beitrag, mit denen er seine Pflichten gegenüber der Genossenschaft zu erfüllen gedacht habe. Dessen Verständnis habe zur Beendigung des Dienstverhältnisses und der Organstellungen geführt. So der Kläger Wert auf eine ausführliche Darstellung der Gründe der Trennung lege, könne dies durchaus schriftlich unter Beweisantritt nachgeholt werden. Auch hieraus würde sich ergeben, dass eine krasse und willkürliche Ungleichbehandlung nicht tatbestandsmäßig sei; vielmehr der Ausschluss des Klägers in der Historie der Genossenschaft der einzige und insoweit notwendige gewesen sei.Randnummer98 Sie – die Beklagte – habe genau derartige Auseinandersetzungen auch und im Interesse des Klägers vermeiden wollen, um dessen beruflichen Fortkommen nicht hinderlich zu sein.Randnummer99 Das Gericht hat nach Maßgabe des Beweisbeschlusses vom 06.10.2020 Beweis erhoben. Hinsichtlich der Vernehmung der Zeugen E… O…-S… und E… S… wird auf den Inhalt des Sitzungsprotokolls vom 06.10.2020 verwiesen.Randnummer100 Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird im Übrigen auf die unter Angabe der Blattzahl der Akte angeführten Schriftstücke ergänzend Bezug genommen. Zudem wird auf die zwischen den Prozessparteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird darüber hinaus auch auf den Inhalt der Sitzungsniederschriften vom 06.10,2020 und vom 23.02.2021 Bezug genommen. EntscheidungsgründeRandnummer101 Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Amtsgerichts ergibt sich aus § 23 Nr. 1 GVG in Verbindung mit § 12 und § 17 ZPO.Randnummer102 Die Feststellungsklage (§ 256 ZPO) ist zulässig. Sie ist das zulässige Rechtsmittel um die Unwirksamkeit gesellschaftsrechtlicher Beschlüsse im Wege einer Feststellungsklage desjenigen Mitglieds feststellen zu lassen, dessen Mitgliedschaftsverhältnis durch sie betroffen wird. Ausschließungsbeschlüsse sind nämlich Rechtsverhältnisse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO, weshalb unmittelbar auf die Feststellung der Unwirksamkeit derartiger Beschlüsse geklagt werden kann (BGH, Urteil vom 21.10.1991, Az.: II ZR 211/90, u.a. in: NJW-RR 1992, Seite 227; BGH, Urteil vom 24.10.1988, Az.: II ZR 311/87, u.a. in: NJW 1989, Seiten 1724 ff.; OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; OLG Brandenburg, Urteil vom 03.07.2012, Az.: 11 U 174/07, u.a. in: „juris“; OLG Schleswig, Urteil vom 18.04.2008, Az.: 14 U 95/07, u.a. in: BeckRS 2008, Nr. 21671 = „juris“; OLG Hamm, Urteil vom 25.04.2001, Az.: 8 U 139/00, u.a. in: NJW-RR 2001, Seiten 1480 ff.; OLG Köln, Urteil vom 15.01.1992, Az.: 11 U 161/91, u.a. in: OLG-Report 1992, Seiten 136 f.; LG Bonn, Urteil vom 08.01.2013, Az.: 18 O 63/12, u.a. in: BeckRS 2013, Nr. 5886 = „juris“; LG Landau/Pfalz, Urteil vom 30.12.2003, Az.: 1 S 178/03, u.a. in: BeckRS 2003, Nr. 17401 = „juris“).Randnummer103 Die gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstandes gerichtete, grundsätzlich nicht fristgebundene Feststellungsklage ist auch gemäß § 256 ZPO statthaft. Eine Verwirkung des Klageerhebungsrechts kommt hier nicht in Betracht. Zwar muss eine gegen die Ausschließung eines Mitglieds gerichtete Klage innerhalb einer angemessenen Frist nach Kenntnis des Ausschließungsbeschlusses erfolgen. Hinsichtlich des hierfür erforderlichen Zeitraums gibt es aber unterschiedliche Ansätze, die - unter Heranziehung entsprechender Regelungen in § 626 Abs. 2 BGB, § 51 Abs. 1, § 67a Abs. 2 GenG, § 242 AktG - zwei Wochen bis zu einem halben Jahr umfassen (OLG Hamburg, Beschluss vom 25.06.2018, Az.: 11 U 13/18, u.a. in: ZMR 2018, Seiten 966 ff.). Hierauf aufbauend ist die Frage der Verwirkung im Falle des Schweigens der Satzung regelmäßig eine im Einzelfall zu treffende Wertungsfrage (OLG Hamburg, Beschluss vom 25.06.2018, Az.: 11 U 13/18, u.a. in: ZMR 2018, Seiten 966 ff.).Randnummer104 Die von dem Kläger etwa zwei bis drei Wochen nach Erhalt des Beschlusses am 24. Juni 2019 unter dem 24. Juli 2019 erhobene und bei dem Landgericht Potsdam auch an diesem Tage eingegangene Klage überschreitet das vorstehende Zeitfenster insofern nicht. Im Übrigen kommt eine Verwirkung wohl auch schon deshalb nicht in Betracht, weil der Kläger zu keiner Zeit den Eindruck erweckt hat, den Ausschluss als rechtswirksam anzuerkennen.Randnummer105 Zwar hat die Beklagte hier zudem behauptet, dass bei Begründung der Mitgliedschaft des Klägers als Genossenschaftsmitglied am 10.01.2014 zwischen den Prozessparteien Einigkeit darüber bestanden habe, dass diese Mitgliedschaft in der Genossenschaft mit der Beendigung der Tätigkeit des Klägers in der Genossenschaft ebenso enden solle, jedoch hat die von der Beklagten hierzu benannte Zeugin E… O…-S… ausgesagt, dass sie bei keinem Gespräch zwischen dem Vorstand der Genossenschaft und dem Kläger dabei war, als der Kläger Genossenschaftsmitglied wurde.Randnummer106 Die Zeugin E… O…-S… hat zudem zwar auch noch bekundet, dass mit dem Kläger dann am 27.03.2018 im Rahmen des Aufhebungsvertrages auch darüber gesprochen worden sei, was mit seiner Mitgliedschaft in der Genossenschaft passieren solle und der Kläger mündlich erklärt habe, dass er dann auch in der Genossenschaft als Mitglied ausscheiden würde mit einem Aufhebungsvertrag. Jedoch sagte sie auch aus, dass der Kläger an diesem Tag dies nicht schriftlich bestätigt habe.Randnummer107 Der Zeuge E… P… S… hat im Übrigen nur bekunden können, dass er bei keinem Gespräch oder dergleichen dabei war, als der Kläger im Jahre 2014 bei der Genossenschaft anfing und es gegebenenfalls um die Beendigung der Mitgliedschaft bei seinem etwaigen späteren Ausscheiden gehen sollte. Ein derartiges Gespräch sei ihm nicht bekannt. Er sei auch bei keinem Gespräch dabei gewesen als der Kläger dann aus der Genossenschaft ausschied und es eventuell um seine Mitgliedschaft ging. Auch bei einem solchen Gespräch war er nicht mit dabei.Randnummer108 Zwar wurde dem Kläger im Zuge der Vereinbarung eines Aufhebungsvertrages auch unstreitig dann eine Vereinbarung zum Ausscheiden als Mitglied der Genossenschaft durch die Beklagte angetragen, im Gegensatz zum Aufhebungsvertrag hat der Kläger aber die Vereinbarung zum Ausscheiden als Mitglied ebenso unstreitig nicht unterzeichnet.Randnummer109 Dass hier somit bereits bei Begründung der Mitgliedschaft des Klägers als Genossenschaftsmitglied am 10.01.2014 zwischen den Prozessparteien Einigkeit darüber bestanden hat, das diese Mitgliedschaft in der Genossenschaft mit der Beendigung der Tätigkeit des Klägers in der Genossenschaft endet, ist durch die Beklagtenseite vorliegend nicht bewiesen worden.Randnummer110 Im Übrigen wäre aber eine derartige (mündliche bzw. konkludente) tatsächlich erfolgte Vereinbarung, dass der Kläger mit Beendigung seiner Tätigkeit bei der Beklagten zugleich auch aus der beklagten Genossenschaft ausscheidet, auch unwirksam gewesen, weil eine derartige Vereinbarung gegen zwingende gesetzliche Vorgaben verstoßen hätte. Eine solche Vereinbarung hätte nämlich gegen die aus den §§ 65 ff. GenG insgesamt zu entnehmenden Einschränkungen verstoßen, denen das Ausscheiden aus einer Genossenschaft unterliegt. Derartige Vereinbarungen knüpfen nämlich die Auflösungswirkung an den Eintritt einer Bedingung und erweisen sich aus diesem Grund als unwirksam. Der Abschluss eines bedingten Auflösungsvertrages ist darauf gerichtet, dass die Mitgliedschaft nach dem Eintritt der Bedingung von selbst endet, auch wenn das zu diesem Zeitpunkt dem Willen des Mitglieds nicht mehr entsprechen sollte. Damit ist die Frage berührt, ob in einer Genossenschaft im Voraus für den Fall des Eintritts oder des Ausbleibens bestimmter Umstände die dann ohne weiteres Zutun der Beteiligten von selbst eintretende Beendigung der Mitgliedschaft vereinbart werden kann (BGH, Urteil vom 15.05.2018, Az.: II ZR 2/16, u.a. in: NJW-RR 2018, Seiten 933 ff.; OLG Hamm, Urteil vom 09.12.2015, Az.: 8 U 26/15, u.a. in: BeckRS 2015, Nr. 124802 = „juris“).Randnummer111 Derartige Regelungen, die das Mitgliedschaftsverhältnis unmittelbar berühren, sind aber grundsätzlich in der Satzung zu treffen, nach der sich gemäß § 18 Satz 1 GenG das Rechtsverhältnis der Genossenschaft und ihrer Mitglieder zunächst richtet. Unabhängig davon, ob in der Satzung bedingungsabhängig eintretende Ausscheidenstatbestände normiert werden können, scheidet nämlich jedenfalls die Festlegung eines solchen Beendigungsgrundes durch eine schuldrechtliche Vereinbarung zwischen der Genossenschaft und dem Mitglied aus. Denn damit würde nicht nur ein weiterer, vom Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehener, Ausscheidensgrund zugelassen, sondern es würden auch die aus § 18 Satz 1, §§ 65 ff. GenG ableitbaren Beschränkungen außer Acht gelassen, denen Beendigungstatbestände genossenschaftsrechtlich unterliegen (BGH, Urteil vom 15.05.2018, Az.: II ZR 2/16, u.a. in: NJW-RR 2018, Seiten 933 ff.; OLG Hamm, Urteil vom 09.12.2015, Az.: 8 U 26/15, u.a. in: BeckRS 2015, Nr. 124802 = „juris“).Randnummer112 Beschlüsse eines Vorstands einer Genossenschaft über den Ausschluss eines Mitgliedes unterliegen aufgrund der durch Art. 9 GG und den §§ 25 ff. BGB geschützten Autonomie jedoch grundsätzlich nur einer beschränkten gerichtlichen Nachprüfung (BGH, Urteil vom 09.06.1997, Az.: II ZR 303/95, u.a. in: NJW 1997, Seiten 3368 f.; BGH, Urteil vom 24.10.1988, Az.: II ZR 311/87, u.a. in: NJW 1989, Seiten 1724 ff.; BGH, Urteil vom 19.10.1987, Az.: II ZR 43/87, u.a. in: NJW 1988, Seiten 552 f.; BGH, Urteil vom 30.05.1983, Az.: II ZR 138/82, u.a. in: NJW 1984, Seiten 918 f.; OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; KG Berlin, Beschluss vom 22.02.2005, Az.: 5 U 226/04, u.a. in: KG-Report 2005, Seiten 590 ff.; OLG Koblenz, Urteil vom 26.06.2003, Az.: 5 U 1621/02, u.a. in: OLG-Report 2003, Seiten 361 f.; OLG Hamm, Urteil vom 25.04.2001, Az.: 8 U 139/00, u.a. in: NJW-RR 2001, Seiten 1480 ff.; OLG Saarbrücken, NJW-RR 1994, Seiten 251 f.; OLG Hamm, NJW-RR 1993, Seiten 1535 f.; OLG Köln, Urteil vom 15.01.1992, Az.: 11 U 161/91, u.a. in: OLG-Report 1992, Seiten 136 f.; OLG Nürnberg, Urteil vom 27.03.1980, Az.: 8 U 81/78, u.a. in: VersR 1980, Seiten 1137 f.; LG Bonn, Urteil vom 08.01.2013, Az.: 18 O 63/12, u.a. in: BeckRS 2013, Nr. 5886 = „juris“; LG Landau/Pfalz, Urteil vom 30.12.2003, Az.: 1 S 178/03, u.a. in: BeckRS 2003, Nr. 17401 = „juris“; AG Essen, Urteil vom 11.05.2010, Az.: 11 C 549/09, u.a. in: „juris“).Randnummer113 Es ist aber andererseits auch anerkannt, dass die Gerichte jedenfalls nachprüfen können, ob die verhängte Maßnahme eine Stütze im Gesetz oder in der Satzung hat, ob das satzungsmäßig vorgeschriebene Verfahren beachtet ist, sonst keine Gesetzes- oder Satzungsverstöße vorgekommen sind und ob die Maßnahme nicht grob unbillig oder sogar willkürlich ist (BGH, Urteil vom 09.06.1997, Az.: II ZR 303/95, u.a. in: NJW 1997, Seiten 3368 f.; BGH, Urteil vom 24.10.1988, Az.: II ZR 311/87, u.a. in: NJW 1989, Seiten 1724 ff.; BGH, Urteil vom 30.05.1983, Az.: II ZR 138/82, u.a. in: NJW 1984, Seiten 918 f.; OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; KG Berlin, Beschluss vom 22.02.2005, Az.: 5 U 226/04, u.a. in: KG-Report 2005, Seiten 590 ff.; OLG Köln, Urteil vom 15.01.1992, Az.: 11 U 161/91, u.a. in: OLG-Report 1992, Seiten 136 f.; LG Bonn, Urteil vom 08.01.2013, Az.: 18 O 63/12, u.a. in: BeckRS 2013, Nr. 5886 = „juris“; LG Landau/Pfalz, Urteil vom 30.12.2003, Az.: 1 S 178/03, u.a. in: BeckRS 2003, Nr. 17401 = „juris“).Randnummer114 In Weiterentwicklung dieser Rechtsprechung hat die herrschende Rechtsprechung zudem entschieden, dass die Gerichte auch darüber zu befinden haben, ob die Tatsachen, die der Ausschließungsentscheidung zugrunde gelegt wurden, bei objektiver und an rechtsstaatlichen Grundsätzen ausgerichteter Tatsachenermittlung zutreffend festgestellt worden sind (BGH, Urteil vom 24.10.1988, Az.: II ZR 311/87, u.a. in: NJW 1989, Seiten 1724 ff.; BGH, Urteil vom 30.05.1983, Az.: II ZR 138/82, u.a. in: NJW 1984, Seiten 918 f.; OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; KG Berlin, Beschluss vom 22.02.2005, Az.: 5 U 226/04, u.a. in: KG-Report 2005, Seiten 590 ff.); die Subsumtion des festgestellten Sachverhalts unter die herangezogene Vorschrift gehöre hingegen zu den Maßnahmen, die eine Genossenschaft in Ausübung ihrer Eigenverantwortlich zu treffen habe und die gerichtlich daher nur in den genannten engen Grenzen nachprüfbar ist (BGH, Urteil vom 09.06.1997, Az.: II ZR 303/95, u.a. in: NJW 1997, Seiten 3368 f.; BGH, Urteil vom 24.10.1988, Az.: II ZR 311/87, u.a. in: NJW 1989, Seiten 1724 ff.; BGH, Urteil vom 30.05.1983, Az.: II ZR 138/82, u.a. in: NJW 1984, Seiten 918 f.; OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; KG Berlin, Beschluss vom 22.02.2005, Az.: 5 U 226/04, u.a. in: KG-Report 2005, Seiten 590 ff. OLG Koblenz, Urteil vom 26.06.2003, Az.: 5 U 1621/02, u.a. in: OLG-Report 2003, Seiten 361 f.; OLG Köln, Urteil vom 15.01.1992, Az.: 11 U 161/91, u.a. in: OLG-Report 1992, Seiten 136 f.; LG Bonn, Urteil vom 08.01.2013, Az.: 18 O 63/12, u.a. in: BeckRS 2013, Nr. 5886 = „juris“; LG Landau/Pfalz, Urteil vom 30.12.2003, Az.: 1 S 178/03, u.a. in: BeckRS 2003, Nr. 17401 = „juris“).Randnummer115 Das wegen eines Ausschließungsbeschlusses angerufene staatliche Gericht hat dem entsprechend sowohl die formelle Rechtmäßigkeit als auch die sachliche Berechtigung des Beschlusses zu überprüfen. Es ist nur nicht berufen, die Zweckmäßigkeit des Ausschusses und die Ermessensausübung des zuständigen Organs der Genossenschaft zu beurteilen (OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; OLG Hamm, Urteil vom 26.05.1999, Az.: 8 U 17/99, u.a. in: NZG 1999, Seiten 1234 f.; LG Bonn, Urteil vom 08.01.2013, Az.: 18 O 63/12, u.a. in: BeckRS 2013, Nr. 5886 = „juris“).Randnummer116 Diese Prüfung führt hier aber zu dem Ergebnis, dass der Ausschluss des Klägers durch die Beklagte nicht rechtmäßig erfolgt ist.Randnummer117 Voraussetzung für die Wirksamkeit eines Beschlusses ist es zunächst, dass er durch das zuständige Organ auf wirksamer satzungsmäßiger Grundlage formell ordnungsgemäß, ohne Gesetzesverstoß und unter Beachtung allgemeiner rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsätze ergangen ist und dass die Maßnahme auf richtiger Tatsachengrundlage ergriffen wurde und nicht grob unbillig oder willkürlich war (OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; AG Essen, Urteil vom 11.05.2010, Az.: 11 C 549/09, u.a. in: BeckRS 2011, Nr. 22534 = „juris“).Randnummer118 Im Genossenschaftsrecht gilt – ähnlich dem Vereinsrecht – der Grundsatz, dass der Verstoß gegen zwingende Vorschriften des Gesetzes oder der Satzung einen Beschluss nichtig machen können (BGH, Urteil vom 09.11.1972, Az.: II ZR 63/71, u.a. in: NJW 1973, Seite 235; OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; OLG Köln, Beschluss vom 04.02.2009, Az.: 2 Wx 56/08, u.a. in: FGPrax 2009, Seiten 82 ff.; BayObLG, Beschluss vom 18.09.2002, Az.: 3Z BR 148/02, u.a. in: NJW-RR 2002, Seiten 1612 f.). Zu den zwingenden Vorschriften gehören aber auch die Bestimmungen der Satzung über den Ausschluss eines Genossenschaftsmitgliedes (OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; OLG Köln, Beschluss vom 04.02.2009, Az.: 2 Wx 56/08, u.a. in: FGPrax 2009, Seiten 82 ff.).Randnummer119 In formeller Hinsicht hat der Kläger keine Mängel geltend gemacht; eine Überprüfung insoweit ergibt auch keinen Fehler.Randnummer120 Der Kläger hatte vor der Entscheidung des Vorstandes mittels Beschluss vom 24.06.2019 bereits mit Schreiben vom 19.06.2019 – Anlage K 5 (Blatt 42 bis 44 der Akte) – gemäß § 9 Abs. 3 der Satzung das rechtliche Gehör erhalten. Insofern ist ihm die beabsichtigte Maßnahme - der Ausschluss - und deren tragende Gründe somit schon vor der Beschlussfassung vom 24.06.2019 durch den Vorstand eröffnet worden, so dass insoweit die rechtsstaatlichen Grundsätze durch den Vorstand der Beklagten bei seiner Beschlussfassung am 24.06.2019 in dieser Hinsicht eingehalten wurden. Die Gewährung rechtlichen Gehörs ist nämlich ein Gebot der natürlichen Gerechtigkeit, das zu den grundlegenden Wertvorstellungen in unserer demokratischen Gesellschaft gehört und auch die interne Gerichtsbarkeit der beklagten Genossenschaft bindet (BGH, Urteil vom 26.02.1959, Az.: II ZR 137/57, u.a. in: NJW 1959, Seite 982; OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; OLG München, Urteil vom 25.09.1972, Az.: 21 U 1553/72, u.a. in: MDR 1973, Seite 405; LG Gießen, Urteil vom 22.02.1995, Az.: 1 S 403/94, u.a. in: NJW-RR 1995, Seiten 828 f.).Randnummer121 Die strafprozessualen Grundsätze der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit gelten hier im Übrigen nicht (OLG München, Urteil vom 25.09.1972, Az.: 21 U 1553/72, u.a. in: MDR 1973, Seite 405; LG Gießen, Urteil vom 22.02.1995, Az.: 1 S 403/94, u.a. in: NJW-RR 1995, Seiten 828 f.), so dass es deshalb auch nicht zu beanstanden ist, dass der Vorstand der beklagten Genossenschaft dem Kläger vor der Beschlussfassung vom 24.06.2019 über die Ausschließung keine Gelegenheit zur persönlichen Stellungnahme gewährte. Der Kläger hätte sich nämlich schriftlich vorab, d.h. vor der Beschlussfassung vom 24.06.2019 äußern können. Rechtliches Gehör wurde dem Kläger somit hier vor der Beschlussfassung vom 24.06.2019 gewährt.Randnummer122 Mit dem Vorstand hat das nach § 9 Absatz 2 S. 1 der Satzung zuständige Organ den angefochtenen Ausschließungsbeschluss gefasst, dem Kläger ist vor Beschlussfassung mit der Ankündigung des Ausschlusses und seiner Gründe in dem Schreiben vom 19.06.2019 – Anlage K 5 (Blatt 42 bis 44 der Akte) – das rechtliche Gehör gewährt worden und die Ausschließung ist dem Kläger dann unstreitig mit Schriftsatz vom 24.06.2019 mitgeteilt worden, so dass in formeller Hinsicht hier keine Mängel vorliegen.Randnummer123 In materiell-rechtlicher Hinsicht ist jedoch zu prüfen, ob der hier der Ausschließung zugrunde gelegte Sachverhalt unter Berücksichtigung von Gesetz, Satzung, Treu und Glauben und des zwischen der Genossenschaft und ihren Mitgliedern bestehenden Treueverhältnisses die Ausschließung tatsächlich rechtfertigt (OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.).Randnummer124 Diese Frage ist vorliegend aber nach Überzeugung des erkennenden Gerichts zu verneinen.Randnummer125 Zwar kann eine Genossenschaft ein Mitglied gemäß § 68 GenG ausschließen, jedoch müssen nach § 68 Abs. 1 Satz 1 GenG die Gründe, aus denen ein Mitglied ausgeschlossen werden kann, in der Satzung bestimmt sein. Die Gründe, die typischerweise für ein bedingungsabhängiges Ausscheiden in Betracht gezogen werden, wie etwa der Wegfall der statutarischen Mitgliedschaftsvoraussetzungen, können insofern aber auch als Ausschließungsgründe festgelegt werden (BGH, Urteil vom 15.05.2018, Az.: II ZR 2/16, u.a. in: NJW-RR 2018, Seiten 933 ff.).Randnummer126 Aus diesem Grunde konnte die hiesige Satzung der beklagten Genossenschaft grundsätzlich auch in § 9 Abs. 1 Buchstabe f) regeln, dass wenn „die Voraussetzungen für die Aufnahme in der Genossenschaft“ (gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung) „…nicht mehr vorhanden sind“ ein Mitglied aus der Genossenschaft zum Schluss des Geschäftsjahres auch durch den Vorstand (§ 9 Abs. 2 der Satzung in Verbindung mit § 68 GenG) mittels Beschluss ausgeschlossen werden kann.Randnummer127 Die Ausschließung eines Mitglieds aus der beklagten Genossenschaft ist insofern hier unter § 9 Abs. 1 Buchstabe f) der Satzung der beklagten Genossenschaft somit näher bestimmt worden (OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.01.1988, Az.: 23 U 222/87, u.a. in: NJW-RR 1988, Seiten 1271 f.), der zufolge ein Mitglied aus der Genossenschaft zum Schluss des Geschäftsjahres ausgeschlossen werden kann, wenn „die Voraussetzungen für die Aufnahme in der Genossenschaft …nicht mehr vorhanden sind“.Randnummer128 Gemäß § 3 Abs. 2 dieser Satzung sind aber „natürliche Personen nur aufnahmefähig, wenn sie in einem Dienst-, Arbeits- oder Auftragsverhältnis mit der Genossenschaft stehen“.Randnummer129 Zwar muss der jeweilige Ausschlussgrund konkret bezeichnet werden (BGH, Urteil vom 10.07.1989, Az.: II ZR 30/89, u.a. in: NJW 1990, Seiten 40 ff.; BGH, Urteil vom 19.10.1987, Az.: II ZR 43/87, u.a. in: NJW 1988, Seiten 552 f.; LG Karlsruhe, Urteil vom 31.07.2009, Az.: 6 O 250/08, u.a. in: BeckRS 2009, Nr. 27246 = „juris“) und ist dies hier unstreitig gegeben, jedoch unterliegt dieser Grund der gerichtlichen Nachprüfung mit dem Inhalt und der Begründung, auf die er im genossenschaftsrechtlichen Verfahren gestützt worden ist.Randnummer130 Das „Nachschieben“ von Ausschließungstatsachen (wie ggf. von der Beklagten mit dem vermeintlichen Wohnsitzwechsel des Klägers aufgrund der zunächst nicht erfolgreich erfolgten Zustellung des Beschlusses vom 24.06.2019 wohl angedeutet), die im Ausschließungsverfahren nicht festgestellt worden sind, würde im Übrigen nach dieser herrschenden Rechtsprechung auf eine nachgeschobene Begründung des Ausschließungsbeschlusses hinauslaufen, die jedoch unzulässig ist (BGH, Urteil vom 10.07.1989, Az.: II ZR 30/89, u.a. in: NJW 1990, Seiten 40 ff.; BGH, Urteil vom 19.10.1987, Az.: II ZR 43/87, u.a. in: NJW 1988, Seiten 552 f.; OLG Schleswig, Urteil vom 18.04.2008, Az.: 14 U 95/07, u.a. in: BeckRS 2008, Nr. 21671 = „juris“; LG Karlsruhe, Urteil vom 31.07.2009, Az.: 6 O 250/08, u.a. in: BeckRS 2009, Nr. 27246 = „juris“; LG Düsseldorf, Urteil vom 28.09.2010, Az.: 9 O 82/10, u.a. in: BeckRS 2010, Nr. 25151 = „juris“; LG Landau/Pfalz, Urteil vom 30.12.2003, Az.: 1 S 178/03, u.a. in: BeckRS 2003, Nr. 17401 = „juris“).Randnummer131 Entscheidend für das erkennende Gericht ist demnach die Frage, ob der in dem Beschluss vom 24.06.2019 angegebene Grund den Ausschluss des Klägers rechtfertigt bzw. ob der Ausschluss des Klägers aus diesem Grund als offenbar unbillig oder willkürlich angesehen werden kann.Randnummer132 Zwar lag hier – sogar unstreitig – gemäß der Satzung der verklagten Genossenschaft ein Ausschließungsgrund hinsichtlich des Klägers gemäß § 9 Abs. 1 Buchstabe f) in Verbindung mit § 3 Absatz 2 vor, jedoch musste der Vorstand der beklagten Genossenschaft bei seiner diesbezüglichen Ermessensentscheidung auch den Gleichbehandlungsgrundsatz (BGH, Urteil vom 06.07.1970, Az.: V ZR 110/67, u.a. in: NJW 1970, Seiten 1917 f.; BGH, Urteil vom 20.04.1967, Az.: II ZR 142/65, u.a. in: NJW 1967, Seiten 1657 ff.; BGH, Urteil vom 11.07.1960, Az.: II ZR 24/58, u.a. in: NJW 1960, Seiten 2142 f.; Fandrich, in: Pöhlmann/Fandrich/Bloehs, 4. Aufl. 2012, Genossenschaftsgesetz, § 68 GenG, Rn. 14; Schulte, in: Lang/Weidmüller, 39. Aufl. 2019, Genossenschaftsgesetz, § 68 GenG, Rn. 14; Geibel, in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 5. Aufl. 2021, § 68 GenG, Rn. 2) mit beachten.Randnummer133 Der Satzungsgeber einer Satzung einer Genossenschaft ist in der Formulierung von Ausschlussgründen aber nicht frei, sondern muss seine Bestimmungen vor allem an dem Gebot der Verhältnismäßigkeit, an der genossenschaftlichen Treuepflicht, am Gleichbehandlungsgrundsatz, am Willkürverbot, an die §§ 134 und 138 BGB sowie am Demokratieprinzip ausrichten. Insbesondere ist die Festlegung eines Ausschlussgrundes nur wirksam, wenn er zur ungestörten Verwirklichung des Förderzwecks der eG und zur Sicherung ihrer Funktionsfähigkeit sachlich gerechtfertigt und erforderlich ist (BGH, Beschluss vom 10.11.1992, Az.: KVR 26/91, u.a. in: NJW 1993, Seiten 1710 ff.; OLG Hamm, Urteil vom 26.05.1999, Az.: 8 U 17/99, u.a. in: NZG 1999, Seiten 1234 f.).Randnummer134 Die Genossenschaft und ihre Organe sind daher zwar berechtigt, unterschiedlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen und zwischen den Mitgliedern nach sachlichen Kriterien in angemessener Weise zu differenzieren (BGH, Urteil vom 14.10.2009, Az.: VIII ZR 159/08, u.a. in: NJW-RR 2010, Seiten 226 f.; BGH, Urteil vom 11.07.1960, Az.: II ZR 24/58, u.a. in: NJW 1960, Seiten 2142 f.).Randnummer135 Das Ermessen des Organs kann in bestimmten Einzelfällen aber gebunden oder sogar auf Null reduziert sein. Das ist z.B. der Fall, wenn bislang alle Mitglieder, die einen bestimmten Ausschlusstatbestand erfüllt haben, auch ausgeschlossen wurden und gegen ein jetzt den Ausschlussgrund ebenfalls erfüllendes Mitglied ohne sachlichen Grund ein Ausschluss nicht ausgesprochen wird. Bei der Ausübung des Ermessens dürfen jedoch auch generalpräventive Gesichtspunkte dergestalt berücksichtigt werden, dass andere Mitglieder durch den Ausschluss von einem gleichartigen Verhalten abgehalten werden sollen (OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 12.12.2000, Az.: 11 U (Kart) 28/00, u.a. in: NZG 2001, Seiten 904 ff.).Randnummer136 Die Interessen der Mitglieder am Fortbestand ihrer Mitgliedschaft müssen jedoch stets eine angemessene Berücksichtigung finden (OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 12.12.2000, Az.: 11 U (Kart) 28/00, u.a. in: NZG 2001, Seiten 904 ff.). Der Ausschlusstatbestand muss im Übrigen mit der notwendigen Bestimmtheit und Transparenz gefasst sein, so dass jedes Mitglied ihn als solches verstehen und ihn vermeiden kann (OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 12.12.2000, Az.: 11 U (Kart) 28/00, u.a. in: NZG 2001, Seiten 904 ff.).Randnummer137 Dem Mitglied muss der Ausschlussgrund zugerechnet werden können, d.h. das Mitglied muss dafür im weitesten Sinne „verantwortlich gemacht“ werden können. Den Ausschluss muss eine Satzung aber nicht zwingend an ein Verschulden knüpfen (BGH, NJW 1963 Seiten 1152 f.).Randnummer138 Ist ein Ausschlussgrund erfüllt, besteht in der Regel aber noch keine Pflicht zum Ausschluss; dieser steht vielmehr im pflichtgemäß auszuübenden Ermessen des zuständigen Organs. Hierbei sind jedoch alle Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung des genossenschaftlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Treuegebots zu prüfen. Sachfremde Erwägungen sind unzulässig.Randnummer139 Ein Ausschluss ist insofern auch dann unzulässig, wenn er gegen das auch den Mitgliedern gegenüber zu beachtende Treuegebot und den Gleichheitsgrundsatz verstößt (BGH, Urteil vom 06.07.1970, Az.: V ZR 110/67, u.a. in: NJW 1970, Seiten 1917 f.; BGH, Urteil vom 20.04.1967, Az.: II ZR 142/65, u.a. in: NJW 1967, Seiten 1657 ff.; BGH, Urteil vom 11.07.1960, Az.: II ZR 24/58, u.a. in: NJW 1960, Seiten 2142 f.; Fandrich, in: Pöhlmann/Fandrich/Bloehs, 4. Aufl. 2012, Genossenschaftsgesetz, § 68 GenG, Rn. 14; Schulte, in: Lang/Weidmüller, 39. Aufl. 2019, Genossenschaftsgesetz, § 68 GenG, Rn. 14; Geibel, in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 5. Aufl. 2021, § 68 GenG, Rn. 2).Randnummer140 Ein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot kann somit bereits darin liegen, dass die Genossenschaft das Genossenschaftsmitglied ausgeschlossen hat, während sie bei anderen Genossen, die sich vergleichbar verhielten, von einem Ausschluss abgesehen hat. Auch bei einer Genossenschaft ist es zwar Ermessenssache, ob sie im Einzelfall von einem Ausschlussgrund Gebrauch machen will; aber auch hinsichtlich des Ausschlusses eines Genossenschaftsmitglieds darf das eine Mitglied in gleich liegenden Fällen nicht schlechter behandelt werden als andere Mitglieder, da ansonsten eine rechtsfehlerhafte Ausübung des Ermessens vorliegt, die den Ausschluss zu einer offenbar unbilligen und damit rechtlich unwirksamen Maßnahme macht (BGH, Urteil vom 06.07.1970, Az.: V ZR 110/67, u.a. in: NJW 1970, Seiten 1917 f.; BGH, Urteil vom 20.04.1967, Az.: II ZR 142/65, u.a. in: NJW 1967, Seiten 1657 ff.; BGH, Urteil vom 11.07.1960, Az.: II ZR 24/58, u.a. in: NJW 1960, Seiten 2142 f.).Randnummer141 Der Ausschluss eines Mitglieds ist somit offenbar unbillig und deshalb auch unwirksam, wenn die Genossenschaft andere Mitglieder, die unter denselben Umständen ebenso ausgeschlossen werden müssten, ohne sachlichen Grund, der eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigt, nicht ausschließt (Verstoß gegen den Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung; BGH, Urteil vom 20.04.1967, Az.: II ZR 142/65, u.a. in: BGHZ Band 47, Seiten 381 ff. = NJW 1967, Seiten 1657 ff. = MDR 1967, Seite 908).Randnummer142 Eine Satzung darf aber nur aus sich heraus und nur einheitlich ausgelegt werden, da sie in ihren körperschaftlichen Regelungen für einen unbestimmten Personenkreis, insbesondere für die künftigen Mitglieder, bestimmend und für das Verhältnis der Genossenschaft zu Dritten maßgebend ist. Nur objektive Gesichtspunkte - zum Beispiel Zweck- und Sinnzusammenhang einzelner Satzungsbestimmungen - und das objektiv als Ziel Erstrebte, dürfen berücksichtigt werden, nicht aber subjektive Vorstellungen der Beteiligten und für die Allgemeinheit nicht übersehbare Erwägungen und Absichten (BayObLG, Beschluss vom 12.05.1971, Az.: BReg 2 Z 74/70, u.a. in: DB 1971, Seite 1428 = Rpfleger 1971, Seite 311 = WM 1971, Seiten 1405 ff.; LG Braunschweig, Urteil vom 19.05.1995, Az.: 1 O 113/94, u.a. in: MDR 1995, Seiten 754 f.). Die Auslegung einer Satzung hat insofern unter Anwendung der §§ 133, 157 BGB zu geschehen.Randnummer143 Zwar hätte die Beklagte insoweit in ihrer Satzung aufnehmen können, dass z.B. „Gründungsmitglieder“ nicht ausgeschlossen werden und somit noch Mitglied der Genossenschaft bleiben, selbst wenn die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft irgendwann nicht mehr vorhanden sind; jedoch fehlt in der hiesigen Satzung eine derartige Ausführung. Der § 9 der Satzung enthält hier nämlich keinerlei ausdrückliche Ausführungen zu „Gründungsmitgliedern“ (vgl. analog hierzu bei „Kriegsdienstverweigerern“: LG Braunschweig, Urteil vom 19.05.1995, Az.: 1 O 113/94, u.a. in: MDR 1995, Seiten 754 f.).Randnummer144 Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung sind die das Genossenschaftsleben bestimmenden Grundentscheidungen als „Verfassung“ der Genossenschaft in die Satzung aufzunehmen. Das von der Beklagtenseite hier wohl ins Feld geführte Argument, die durch die Satzung zu leistende Integration der Mitglieder werde durch eine weniger in die Einzelheiten gehende Satzung erleichtert und die Eröffnung eines Spielraums für außerhalb der Satzung erfolgte Regelungen der Rechtsstellung der Mitglieder der Genossenschaft erscheine wegen der hiermit gegebenen Möglichkeit einer flexiblen Reaktion gegenüber wechselnden Herausforderungen sinnvoll, berücksichtigt nicht die Zielsetzung des GenG unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze des § 33 Abs. 1 Satz 1 BGB. Indem durch diese Normen die erschwerte Abänderbarkeit von Satzungsbestandteilen vorgeschrieben wird, tragen sie dem Gedanken des Minderheiten-Schutzes Rechnung.Randnummer145 Dieser Schutzzweck würde unterlaufen, wenn schwerwiegende Eingriffe in die Mitgliedschaft nicht der Satzung vorbehalten blieben. Dem kann nicht entgegengehalten werden, eine derartige Betrachtungsweise führe über kurz oder lang dazu, dass alle denkbaren Regelungen von Anfang an in die Satzung aufgenommen werden müssten. Diese Argumentation kann schon deshalb nicht überzeugen, weil es hier nicht um den Schutz desjenigen geht, der sich trotz für ihn nachteiliger Satzungsbestimmungen zu einem Beitritt in die Genossenschaft entschließt, sondern um den Schutz der Minderheit vor einer Majorisierung durch die Mehrheit der Genossenschaftsmitglieder. Es kann auch nicht auf eine satzungsmäßige Verlautbarung der das Genossenschaftsleben bestimmenden Grundentscheidung weitgehend verzichtet werden. Zwar mag von der damit eröffneten Informationsmöglichkeit in der Praxis oftmals kein Gebrauch gemacht werden. Dieser Umstand lässt die Forderung nach einer satzungsmäßigen Verlautbarung der das Genossenschaftsleben bestimmenden Grundentscheidungen aber keineswegs entbehrlich erscheinen, da das Gesetz für die Satzung eine derartige Publikation verlangt und im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit nicht auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalles abstellt. Diese für das Genossenschaftsrecht geltenden Grundsätze müssen erst recht bei Ausschlüssen aus der Genossenschaft Anwendung finden.Randnummer146 Hieraus folgt, dass jedenfalls die das Sicherungssystem bestimmenden Grundentscheidungen zum Ausschluss eines Mitglieds aus der Genossenschaft auch in der Satzung selbst verankert werden musste (analog vgl.: BGH, Urteil vom 24.10.1988, Az.: II ZR 311/87, u.a. in: NJW 1989, Seiten 1724 ff.).Randnummer147 Die somit hier aus diesem Grunde gegebene Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes begründet dann aber auch den Anspruch des Klägers als benachteiligter Genosse so gestellt zu werden, wie die bevorzugten Mitglieder durch die Beklagte gestellt worden sind (BGH, Urteil vom 14.10.2009, Az.: VIII ZR 159/08, u.a. in: NJW-RR 2010, Seiten 226 f.; BGH, Urteil vom 11.07.1960, Az.: II ZR 24/58, u.a. in: NJW 1960, Seiten 2142 f.).Randnummer148 Zwar ist der Kläger unstreitig kein „Gründungsmitglied“ der Beklagten, so dass er bei einer entsprechenden Regelung in der Satzung der Beklagten ggf. wohl auch keinen Anspruch darauf gehabt hätte, dass die Beklagte ihm gegenüber auf den - nach § 9 der Satzung berechtigten – Ausschluss aus der Genossenschaft ebenso verzichtet wie gegenüber den anderen, vom Kläger angeführten Genossenschaftsmitgliedern, die ebenfalls nicht mehr in einem Dienst-, Arbeits- oder Auftragsverhältnis zu der Beklagten stehen (BGH, Urteil vom 14.10.2009, Az.: VIII ZR 159/08, u.a. in: NJW-RR 2010, Seiten 226 f.). Insoweit hätte die Beklagte also rechtswirksam in ihrer Satzung bestimmen können, dass die Mitgliedschaft eines Mitglieds dann nicht endet, wenn es ein „Gründungsmitglied“ gewesen ist (vgl. analog: BVerfG, Beschluss vom 29.05.1989, Az.: 1 BvR 1049/88, u.a. in: FamRZ 1989, Seite 1047; BGH, Urteil vom 20.09.1982, Az.: II ZR 195/81, u.a. in: WM 1982, Seite 1222 = ZIP 1982, Seiten 1321 f. = ZfgG 33, Seiten 270 ff.; OLG Celle, Urteil vom 13.06.1988, Az.: 1 U 13/88, u.a. in: NJW-RR 1989, Seiten 313 ff.), jedoch ist eine derartige Regelung zu „Gründungsmitglied“ in der hiesigen Satzung der Beklagten gerade nicht erfolgt.Randnummer149 Aus dem genossenschaftlichen Treueverhältnis ergeben sich zudem hier aber auch noch Schranken für den Ausschluss des Klägers als Genossenschaftsmitglied der Beklagten, insbesondere muss diese Sanktion dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen. Das ist aber nur dann der Fall, wenn die Ausschließung geeignet und erforderlich ist, um die Störung des Mitgliedschaftsverhältnisses zu beseitigen und nicht außer Verhältnis zu diesem Ziel steht. Soweit der Genossenschaft schonendere Mittel zu Gebote stehen, hat sie zunächst diese anzuwenden, da die Ausschließung die „ultima ratio“ ist (BGH, Beschluss vom 20.09.2010, Az.: II ZR 17/09, u.a. in: DStR 2010, Seite 2319; OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; OLG Schleswig, Urteil vom 16.12.2008, Az.: 5 U 46/08, u.a. in: BeckRS 2009, Nr. 25681 = „juris“).Randnummer150 Dabei hat sich die gerichtliche Prüfung zwar darauf zu beschränken, ob sich die Ermessensausübung innerhalb der von Recht und Gesetz gezogenen Grenzen hält, da es nicht Aufgabe des Gerichts ist, die Zweckmäßigkeit des Ausschlusses zu beurteilen und seine eigene Ermessensausübung an die Stelle derjenigen der Genossenschaft zu setzen (OLG Brandenburg, Urteil vom 28.12.2017, Az.: 6 U 40/16, u.a. in: GesR 2018, Seiten 430 f.; OLG Hamm, Urteil vom 26.05.1999, Az.: 8 U 17/99, u.a. in: NZG 1999, Seiten 1234 f.).Randnummer151 Aber auch nach diesen Grundsätzen und bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände wäre die Entscheidung der Beklagten, den Kläger aus der Genossenschaft auszuschließen, wohl hier zu beanstanden. Denn dem Kläger werden von der Beklagten hier keinerlei Pflichtverletzungen vorgehalten. Die Nachteile, die der Kläger durch den Ausschluss erleidet, wiegen demgegenüber aber erheblich schwerer, da er infolge des Ausschlusses konkrete wirtschaftliche Nachteile – ggf. sogar im fünfstelligen Eurobereich – erleiden kann (BGH, Beschluss vom 20.09.2010, Az.: II ZR 17/09, u.a. in: DStR 2010, Seite 2319; OLG Schleswig, Urteil vom 16.12.2008, Az.: 5 U 46/08, u.a. in: BeckRS 2009, Nr. 25681 = „juris“).Randnummer152 Ein milderes Mittel als der Ausschluss des Klägers kam unter Berücksichtigung dieser Interessenlage aber wohl auch in Betracht. Insbesondere hätte die Beklagte den Kläger z.B. als investierendes Mitglied zulassen und ihnen gleichzeitig in seinen Stimmrechten beschränken können.Randnummer153 Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits stützt sich auf § 91 ZPO.Randnummer154 Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.Randnummer155 Der Wert des Streitgegenstandes des Verfahrens ist hier zudem noch durch das Gericht festzusetzen gewesen. Der Wert einer Feststellungsklage, mit der sich das Mitglied einer Genossenschaft gegen seinen Ausschluss wendet, bestimmt sich insofern aber nach dem Interesse am Fortbestehen der Mitgliedschaft und entspricht damit in der Regel dem Wert des von der Ausschließung betroffenen Geschäftsanteils des Genossen (BGH, Beschluss vom 11.09.2018, Az.: II ZR 37/18, u.a. in: BeckRS 2018, Nr. 23617 = „juris“; BGH, Beschluss vom 27.04.2009, Az.: II ZB 16/08, u.a. in: NJW 2009, Seiten 3161 f.).Randnummer156 Ob hier ggf. eine höhere Bewertung deshalb geboten wäre, weil sich aus dem Vortrag der Parteien ein höherer wirtschaftlicher Wert (ggf. sogar im fünfstelligen Euro-Bereich) des Geschäftsanteils des Klägers ergibt (BGH, Beschluss vom 27.04.2009, Az.: II ZB 16/08, u.a. in: NJW 2009, Seiten 3161 f.), kann vorliegend wohl dahingestellt bleiben, da das Landgericht Potsdam – als hiesiges Berufungsgericht – den Streitwert des nunmehrigen Verfahrens bereits mit Beschluss vom 12.08.2019 auf lediglich 2.500,00 Euro festgesetzt hatte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG Charlottenburg, Beschluss vom 22.01.2016 – 99 AR 9466/15 | § 2 Abs 1 S 1 GmbHG, § 9c Abs 1 S 1 GmbHGDie Gründung einer deutschen GmbH durch einen schweizer Notar aus dem Kanton Bern ist unwirksam und nicht ins Handelsregister eintragungsfähig.TenorDie Anmeldung vom 09.09.2015 auf Eintragung der Gesellschaft wird kostenpflichtig zurückgewiesen.GründeI.Mit Anmeldung vom 09.09.2015 wurde die Gründung der „S GmbH“ (nachfolgend auch: „Gesellschaft i. Gr.“) zum Handelsregister angemeldet. Mit der Anmeldung eingereicht wurde eine mit Apostille versehene öffentliche Urkunde des Schweizer Notars W., dienstansässig in T. im Kanton Bern. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Urschrift Nr. 312 vom 09.09.2015 des Berner Notars W. verwiesen.Das Gericht hat die Gesellschaft i. Gr. darauf hingewiesen, dass es die Beurkundung der Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch einen Schweizer Notar als nicht ausreichend erachtet, um die Form des § 2 Abs. 1 S. 1 GmbHG zu wahren. Die Gesellschaft i. Gr. hat zu diesen gerichtlichen Hinweisen mit Schreiben vom 04.01.2016 ausführlich Stellung genommen.II.Die Anmeldung der Eintragung der Gesellschaft ist zurückzuweisen, da die Gesellschaft nicht ordnungsgemäß errichtet worden ist, § 9c Abs. 1 S. 1 GmbHG. Die Beurkundung der Gründung einer deutschen GmbH durch einen Schweizer Notar genügt nicht der Form des § 2 Abs. 1. S. 1 GmbHG. Dies gilt insbesondere für die Beurkundung durch einen Notar des Schweizer Kantons Bern, da das im Kanton Bern zu beachtende Beurkundungsverfahren derart von deutschen Standards abweicht, dass nicht von einer Gleichwertigkeit der Beurkundung gesprochen werden kann.1.Auf den vorliegenden Fall ist hinsichtlich der Formerfordernisse deutsches Recht anwendbar, Art. 11 Abs. 1 Alt. 1 EGBG. Die Einhaltung der formellen Vorschriften des schweizer Rechts bzw. des Rechtes des Kantons Bern ist nicht ausreichend.a. Das Gericht schließt sich der ganz herrschenden Meinung an, wonach aufgrund der besonderen materiellen Bedeutung von § 2 Abs. 1 GmbHG die Einhaltung der (schweizer) „Ortsform“ gem. Art. 11 Abs. 1 Alt. 2 EGBG nicht ausreicht (statt vieler vgl. nur Baumbach/Hueck-Fastrich, GmbHG, 20. Aufl., § 2 Rz. 9; Lutter/Hommelhoff-Bayer, GmbHG, 18. Auflage, § 2 Rz. 18, jeweils mit zahlreichen Nachweisen). Ausweislich der Gesetzesmaterialien zum Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts vom 25.07.1986 (BGBl. I, S. 1142) sollte sich der auf das EG-Schuldrechtsübereinkommen zurückzuführende Art. 11 EGBGB ausdrücklich nicht auf Fragen der Verfassung juristischer Personen beziehen (BT-Drs. 10/504, 49; MK/AktG-Pentz, 4. Auflage, § 23 Rz. 30). Diese Ansicht wird zudem im Referentenentwurf für ein Gesetz zum Internationalen Privatrecht der Gesellschaften, Vereine und juristische Personen vertreten (S. 4 des Entwurfes, abzurufen unter http://www.gesmat.bundesgerichtshof.de/gesetzesmaterialien/16_wp/int_gesr/refe.pdf). Träfe die Ansicht der Gesellschaft i. Gr. zu, wonach die Einhaltung der „Ortsform“ ausreichend wäre, wäre beispielsweise die Gründung einer deutschen GmbH in den USA vor einem in juristischer Hinsicht überhaupt nicht ausgebildeten Notary Public möglich.b. Die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.06.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom I“) ist nicht einschlägig, da das internationale Gesellschaftsrecht gem. Art. 1 Abs. 2f von ihrem Anwendungsbereich ausgenommen ist.c. Die Gesellschaft i. Gr. vertritt die Auffassung, bereits aus der Formulierung des § 2 Abs. 1 S. 1 GmbHG folge die Zulässigkeit der Beurkundung durch einen Schweizer Notar; denn sofern der Gesetzgeber ausschließlich deutsche Notare für zuständig erklären wolle, wäre dies aus der Formulierung der Norm („deutscher Notar“) ersichtlich, wie beispielsweise in § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO. Dass diese Auffassung unzutreffend ist, ergibt sich bereits aus § 925 Abs. 1 S. 2 BGB. Nach der zitierten Vorschrift ist zur Entgegennahme der Auflassung „jeder“ Notar zuständig. Nach ganz herrschender Meinung kann aber entgegen des Wortlautes die Auflassung nicht vor jedem Notar, sondern nur vor einem deutschen Notar erfolgen (vgl. statt vieler mit zahlreichen Nachweisen MK/BGB- Kanzleiter, 6. Auflage, § 925 Rz. 14). Dies beruhe, so die h. M., auf dem Zweck des § 925 BGB, die Schaffung nach deutschem Recht einwandfreier und unzweideutiger Unterlagen als Grundlage für den Vollzug der Eigentumsumschreibung im Grundbuch zu gewährleisten (MK aaO.). Diese Gesichtspunkte gelten ebenso für die Gründung einer GmbH, sodass eine unterschiedliche Behandlung nicht gerechtfertigt ist.2.Die Frage, ob die Gründung einer deutschen GmbH durch einen Schweizer Notar beurkundet werden kann, ist, soweit ersichtlich, höchstrichterlich noch nicht entschieden worden: Die einzige Entscheidung des BGH, die zumindest ein ähnliches Problem zum Gegenstand hat, stammt aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts (BGH NJW 1981, 1160). Die weiteren Entscheidungen verhalten sich entweder nicht zu Vorgängen, die die Verfassung der Gesellschaft betreffen, oder haben zudem keinen Schweizer Sachverhalt zum Gegenstand.a. Die bereits erwähnte Entscheidung von 1981 hatte die Beurkundung einer Änderung des Gesellschaftsvertrages einer deutschen GmbH durch einen Zürcher Notar zum Gegenstand. Der BGH legte seiner Entscheidung irrig ein falsches Beurkundungsverfahren für den Kanton Zürich zugrunde (entgegen der Ansicht des BGH bestand und besteht im Kanton Zürich keine Pflicht des Notars, die Urkunde zu verlesen, vgl. hierzu Müller, NJW 2014, 1994, 1995, 1997). Zudem hatte der BGH ausweislich der Urteilsgründe keine eigenen Recherchen zur Rechtslage in der Schweiz angestellt, sondern stützte sich allein auf ein Gutachten der Universität Köln aus dem Jahr 1971. Dieses vor über 40 Jahren erstellte universitäre Gutachten befasste sich aber nur mit der Frage, ob die notarielle Unterschriftsbeglaubigung in Zürich mit der in Deutschland vergleichbar sei. Das Gutachten machte auch selbst deutlich, dass es damit für die davon zu unterscheidende Beurkundung nichts aussagen könne (Müller, aaO.). In der Entscheidung stellte der BGH auf der genannten zweifelhaften Grundlage fest, ein vom deutschen Recht aufgestelltes Beurkundungserfordernis könne auch durch die Beurkundung durch einen ausländischen Notar erfüllt werden, sofern sowohl die Stellung des Notars wie auch das nach ausländischem Recht einzuhaltende Beurkundungsverfahren der deutschen Beurkundung als gleichwertig anzusehen seien.b. Ein weiteres BGH-Urteil aus dem Jahr 1989 hatte die Abtretung von Geschäftsanteilen, beurkundet durch einen Schweizer Notar, zum Gegenstand. Lediglich in einem obiter dictum am Ende der Entscheidung gelangte der BGH unter bloßem Verweis auf die vorgenannte Entscheidung aus dem Jahr 1981 zu dem Ergebnis, bei der Beurkundung durch einen Schweizer Notar sei das in deutschen Gesetzesvorschriften aufgestellte Formerfordernis der notariellen Beurkundung erfüllt (BGH NJW-RR 1989, 1259, 1261). Der Kanton, in dem die Beurkundung stattgefunden hatte, wurde nicht erwähnt.c. Im Beschluss vom 17.12.2013 (NJW 2014, 2026 ff.) hat der BGH zu dem hier interessierenden Thema dagegen nicht Stellung genommen: Er hat nicht die Wirksamkeit einer in Basel beurkundeten Anteilsabtretung untersucht. Entscheidungsgegenstand war nur die Frage, ob die Gesellschafterliste eines Baseler Notars vom deutschen Handelsregister zu akzeptieren sei. Der BGH hat entschieden, dass ein deutsches Registergericht die Gesellschafterliste einer GmbH nicht schon deshalb zurückweisen dürfe, weil sie von einem Baseler Notar eingereicht worden sei. Auch diese Entscheidung hatte also nicht die Beurkundung der Gründung einer GmbH durch einen Schweizer Notar zum Gegenstand.d. Auch aus dem Urteil des BGH vom 21.10.2014 (NZG 2015, 18 ff.) lässt sich nicht herleiten, dass vorliegend ein ausländischer Notar hätte beurkunden können: Gegenstand der Entscheidung war die Beurkundung der Hauptversammlung einer deutschen Aktiengesellschaft (vgl. § 130 AktG) durch einen ausländischen Notar. Der BGH billigte dies, stellte aber in der Begründung entscheidend ab auf die mangelnde Einflussmöglichkeit des Notars auf den Versammlungsablauf (Rz. 18) sowie das Nichtbestehen von Prüfungs- und Belehrungspflichten (Rz. 19). Die Beurkundung der Hauptversammlung sei keine Beurkundung von (Willens-)Erklärungen, sondern eine sonstige Beurkundung über die Wahrnehmungen des Notars. Für eine solche Form der Beurkundung nach dem dritten Abschnitt des Beurkundungsgesetzes gälten die Prüfungs- und Belehrungspflichten nach § 17 BeurkG aber ohnehin nicht. Zudem habe der Gesetzgeber für weniger bedeutende Beschlüsse bei nichtbörsennotierten Gesellschaften die Anwesenheit eines Notars für verzichtbar erachtet, § 130 Abs. 1 S. 3 AktG, so der BGH.Bei der Gründung der GmbH dagegen sind Willenserklärungen zu beurkunden, § 17 BeurkG ist anwendbar, der Gesetzgeber hat keine Ausnahmen vom Erfordernis der Beurkundung vorgesehen und die Beurkundung der Gründung einer GmbH ist mit der Protokollierung des Ablaufes einer Hauptversammlung nicht zu vergleichen.3.Eine Beurkundung durch einen ausländischen Notar soll der Beurkundung durch einen deutschen Notar iSd. genannten Rechtsprechung des BGH gleichwertig sein, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind:Die ausländische Urkundsperson hat zum einen für die Errichtung der Urkunde ein Verfahrensrecht zu beachten, das den tragenden Grundsätzen des deutschen Beurkundungsrechts entspricht. Zum anderen muss die ausländische Urkundsperson nach Vorbildung und Stellung im Rechtsleben eine der Tätigkeit des deutschen Notars entsprechende Funktion ausüben.Die erste Voraussetzung - Gleichwertigkeit des Verfahrensrechts - ist vorliegend nicht erfüllt:a. Dabei ist zu beachten, dass bei der Gründung einer GmbH Willenserklärungen zu beurkunden sind und damit in Deutschland das Verfahren nach §§ 8 ff. BeurkG einzuhalten ist. Zudem ist zu beachten, dass ein erheblicher Unterschied zwischen der Beurkundung der Abtretung von Geschäftsanteilen an einer GmbH und der Beurkundung der Gründung einer GmbH besteht. In der Stellungnahme der Gesellschaft i. Gr. wird auf diese Unterscheidung nicht Rücksicht genommen, wenn Entscheidungen deutscher Gerichte zitiert werden, die sich nicht auf die Gründung einer GmbH, sondern auf die Abtretung von Geschäftsanteilen beziehen.b. Das im Kanton Bern zu beachtende Beurkundungsverfahren weicht derart von deutschen Standards ab, dass nicht von einer Gleichwertigkeit der Beurkundung gesprochen werden kann: Im Kanton Bern gilt die Notariatsverordnung (NV) vom 26.04.2006 (BAG 06-059). Nach Art. 46 I NV liest der Notar die Urkunde (nur) vor, soweit sie Willenserklärungen enthält. Nach Art. 46 II NV können Bürgschaften selbst gelesen werden. Nach Art. 39 NV sind Beilagen der Urschrift im Original oder in beglaubigter Kopie beizufügen und mit einem Zeugnis des Notars über die Zugehörigkeit zu der betreffenden Urschrift zu versehen. In Bern müssen also Anlagen gar nicht und die Urkunde nur insoweit vorgelesen werden, als sie Willenserklärungen enthält. Im deutschen Recht dagegen muss gem. § 13 BeurkG die gesamte Niederschrift und nicht nur die beurkundeten Erklärungen der Beteiligten vorgelesen werden (Winkler, BeurkG, 17. Auflage, § 13 Rz. 21). Ebenso sind in Deutschland auch die einen Teil der notariellen Niederschrift bildenden Anlagen iSd. § 9 Abs. 1 S. 2 BeurkG zu verlesen. Eine Verletzung der Verlesungspflicht führt zur Nichtigkeit der Beurkundung (Winkler, aaO., Rz. 23). Die Vorlesungspflicht ist ein „Essentiale der Beurkundung“ (Winkler, aaO., Rz. 2), „Kernstück“ der notariellen Beurkundungsverhandlung (Eylmann/Vaasen-Limmer, BeurkG, 3. Auflage, § 13 Rz. 3). Das Verlesen der Urkunde ist damit im Sinne der Gleichwertigkeits-Rechtsprechung des BGH als tragender Grundsatz des deutschen Beurkundungsrechts anzusehen (MK/GmbHG-J. Mayer, 2. Auflage, § 2 Rz. 52; Schmidt, aaO., 1998; Haerendel, DStR 2001, 1802, 1805). Denn gerade das Verlesen ist das zwingende Unterscheidungsmerkmal zur bloßen Beglaubigung. Da dieser Grundsatz im notariellen Verfahrensrecht des Kantons Bern nicht gleichwertig gewahrt ist, ergibt sich bereits aus diesen Gründen die Formnichtigkeit der Gründung der Gesellschaft.c. Daran ändert auch eine freiwillige, gleichsam „überobligatorische“ Anwendung des höheren (deutschen) Standards durch den ausländischen Notar nichts: Es kommt abstrakt darauf an, dass der ausländische Notar nach der für ihn geltenden Notariatsverfassung ein gleichwertiges Verfahren einhalten muss. Jede andere Handhabung würde zu einer Einzelfallprüfung und damit zu einer großen Rechtsunsicherheit führen. Gleichwertig ist nicht eine einzelne Beurkundung, sondern die Beurkundung durch die Notare eines bestimmten Staates (Staudinger/Hertel, BGB, Bearbeitung 2012, Vor §§ 127a, 128, Rz. 874; Schmidt, aaO., 1999). Andernfalls müsste für jeden Notar überprüft werden, ob er über ausreichende Kenntnisse im deutschen Recht verfügt. Dies würde wohl die Ablegung eines Sachkundenachweises durch den ausländischen Notar erfordern, was höchst unpraktikabel wäre.4.Das Gericht teilt auch die in der Literatur vertretene Meinung, der BGH habe die in den beiden erwähnten Entscheidungen aus den 80er Jahren zum Ausdruck gekommene Ansicht der Gleichwertigkeit der Beurkundung durch einen Schweizer Notar nur deshalb noch nicht korrigiert, da das Gericht hierzu noch keine Gelegenheit hatte (MK/GmbHG-J. Mayer, 2. Auflage, § 2 Rz. 56 m. weit. Nachw.). Auch daraus ergibt sich vorliegend die Formnichtigkeit der Beurkundung. Dies aus folgenden Gründen:a. Im Vorfeld der Entscheidung des BGH aus dem Jahr 1981 hatten die Oberlandesgerichte Hamm und Karlsruhe sowie zahlreiche Stimmen in der Literatur die Gleichwertigkeit der Beurkundung mit der Begründung abgelehnt, die Prüfungs- und Belehrungspflicht des deutschen Notars erfordere eine genaue Kenntnis des deutschen Gesellschaftsrechts, die der ausländische Notar regelmäßig nicht besitze. Der BGH räumte zwar ein, das in § 53 Abs. 2 GmbHG angeordnete Erfordernis der notariellen Beurkundung verfolge auch den Zweck, den zu beurkundenden Vorgang rechtlich zu prüfen, die Urkundsbeteiligten rechtlich zu beraten und zu belehren, damit Irrtümer und Zweifel vermieden sowie unerfahrene und ungewandte Beteiligte nicht benachteiligt würden (vgl. § 17 Abs. 1 BeurkG). Entscheidend sei aber, dass die Befolgung der Pflichten aus §17 Abs. 1 BeurkG nicht Wirksamkeitsvoraussetzung der Beurkundung, sondern verzichtbar sei. Einem solchen Verzicht käme es praktisch gleich, wenn die Beteiligten einen ausländischen Notar aufsuchten, von dem sie regelmäßig eine genaue Kenntnis des deutschen Gesellschaftsrechts und deshalb eine umfassende Belehrung von vornherein gar nicht erwarten könnten. Die inhaltliche Prüfung durch das Registergericht gewährleiste, dass Urkunden, die Publizitätswirkung für Dritte hätten, (auch ohne inhaltliche Prüfung durch einen Notar) eine sichere Grundlage für den Rechtsverkehr darstellten. Hinzu käme, dass vom deutschen Notar die Kenntnis des Inhalts ausländischer Rechtsordnungen ebenso nicht erwartet werden könne (vgl. § 17 Abs 3 S. 2 BeurkG).bb. Alle diese Argumente stehen teils im Widerspruch zur eigenen Rechtsprechung des BGH seit den beiden erwähnten Entscheidungen aus den 1980er Jahren, teils zur bereits damals geltenden Rechtslage, teils zur nunmehr geltenden Rechtslage:(1) In der Rechtsprechung des BGH ist anerkannt, dass jedenfalls im (hier vorliegenden) Beurkundungsverfahren gem. §§ 8 ff. BeurkG ein Verzicht auf die notarielle Belehrungs- und Prüfungspflicht gem. § 17 Abs. 1 BeurkG nicht möglich ist. Daran ändert auch nichts, dass § 17 Abs. 1 BeurkG als „Soll-Vorschrift“ konzipiert ist, denn für den Notar bedeutet das „Soll“ ein dienstrechtliches „Muss“ (BT-Drs. V/4014 sub II.1.a). Nur ausnahmsweise kann der Notar von einer Belehrung absehen, wenn - im Einzelfall - die Beteiligten sich über die Tragweite ihrer Erklärungen und das damit verbundene Risiko vollständig im Klaren sind und sie die konkrete Vertragsgestaltung gleichwohl ernsthaft wollen. Grund hierfür ist aber nicht, dass die Beteiligten auf den Schutz des § 17 Abs. 1 BeurkG „verzichten“ könnten, sondern in diesen Ausnahmefällen ist eine Belehrung nicht erforderlich, da die Beteiligten insoweit nicht schutzbedürftig sind (BGH NJW 1995, 330, 331). Wenn aber die Belehrungspflicht eines deutschen Notars nicht verzichtbar ist, sondern nur auf der Grundlage besonderer Voraussetzungen entfallen kann, dann kann auch die weitere These des BGH, bereits durch die Wahl eines ausländischen Notars sei ein solcher Verzicht konkludent anzunehmen, nicht aufrechterhalten werden. Das Entfallen der Belehrungspflicht wird zudem in der übrigen Rechtsprechung des BGH als Ausnahme von der Regel angesehen, womit schwer vereinbar ist, bei Auslandsbeurkundungen die Ausnahme zur Regel zu machen. Hinzu kommt auch, dass nach der ständigen Rechtsprechung des BGH (vgl. nur BGH aaO.) sich der Notar durch gezieltes Nachfragen davon überzeugen muss, dass sich die Beteiligten auch und gerade über die rechtlichen Konsequenzen ihres Tuns im Klaren sind; nur wenn der Notar sich insoweit sicher ist, kann man überhaupt an ein Entfallen der Belehrungspflicht denken. Als Organ der Rechtspflege ist der Notar insbesondere dann zur Belehrung verpflichtet, wenn besondere Umstände es nahe legen, dass einem Beteiligten wegen mangelnder Kenntnis der Rechts- oder Sachlage ein Schaden droht. Daraus folgt zwingend, dass der handelnde Notar über entsprechende Fachkenntnisse verfügen muss, um überhaupt das Bestehen etwaiger Risiken für die Beteiligten einschätzen zu können (Dignas, GmbHR 2005, 139, 143).(2) Auch die weitere Begründung des BGH in der genannten Entscheidung aus dem Jahr 1981, auch von einem deutschen Notar könne die Kenntnis des Inhalts ausländischer Rechtsordnungen nicht erwartet werden (vgl. § 17 Abs 3 S. 2 BeurkG), verfängt nicht. Besonders mit der (zwischenzeitlich eingefügten) Regelung des § 11a BNotO zeigt der deutsche (und in § 31 Abs. 3 ÖNO übrigens auch der österreichische) Gesetzgeber, dass ein Verzicht auf die Belehrung über ausländisches Recht im Rahmen der Beurkundung gerade nicht gewollt ist. Vielmehr wird damit die Auffassung des Gesetzgebers deutlich, dass der inländische Notar bei Anwendung ausländischen Rechts gerade nicht per se eine gleichwertige fachliche Qualifikation inne hat wie der ausländische Notar. Eine Regelung wie in § 11a BNotO wäre nicht notwendig, wenn bei der Anwendung ausländischen Rechts eine Beratung und Belehrung obsolet wäre (Dignas, GmbHR 2005, 139, 144).(3) Auch die weitere Begründung, die Prüfung durch das Registergericht gewährleiste, dass die Urkunde eine sichere Grundlage für den Rechtsverkehr darstelle, überzeugt nicht (mehr). Nach der Einführung des § 9c Abs. 2 GmbHG im Jahr 1998 ist die Inhaltskontrolle durch das Handelsregister bei der Gründung einer GmbH erheblich beschränkt.(4) Hinzu kommt, dass in der neueren Rechtsprechung des BGH, die nach den beiden genannten Entscheidungen aus den 1980er Jahren ergangen ist, der Zweck der notariellen Beurkundung des Gesellschaftsvertrages (auch) in „Beweissicherungs- und damit Rechtssicherheitsgründen” sowie einer „materiellen Richtigkeitsgewähr” gesehen wird, und die notarielle Beurkundung eine „Prüfungs- und Betreuungsfunktion” gewährleiste (vgl. BGH NJW 1989, 295, 298 - „Supermarkt“). Dem ist jedenfalls zuzustimmen, wenn die Wirkungen der beurkundeten Erklärungen über den Kreis der unmittelbar Beteiligten hinausreichen und auch für Dritte Geltung haben oder erlangen können, also insbesondere bei Akten, die die Verfassung der Gesellschaft betreffen, wie z. B. die Gründung einer GmbH. In diesen Fällen hat der Gesetzgeber nicht nur die schwächere Form der notariellen Beglaubigung, sondern ausdrücklich die notarielle Beurkundung angeordnet. Grund dieser Anordnung ist, dass eben nicht nur sichergestellt werden soll, dass die Identität der Erklärenden zweifelsfrei feststeht, sondern dass die Urkundsperson auch sachlich zu dem Inhalt der beurkundeten Erklärungen Stellung nehmen soll, und diese Stellungnahme - im Gegensatz zu den beratenden Rechtsanwälten - von neutraler Warte aus erfolgt (Goette, DStR 1996, 709, 712). Ein ausländischer Notar kann aber diese vom Gesetzgeber durch Anordnung der notariellen Beurkundung bezweckte materielle Richtigkeitsgewähr gerade nicht gewährleisten (Goette, DStR 1996, 709, 712 f.; Staudinger/Hertel, BGB, Bearbeitung 2012, Vor §§ 127a, 128, Rz. 875; MK/GmbHG-J. Mayer, 2. Auflage, § 2 Rz. 54 ff.; Lutter/Hommelhoff-Bayer, GmbHG, 18. Auflage, § 2 Rz. 19; Winkler, BeurkG, 17. Aufl., Einleitung Rz. 90 ff.; Haerendel, DStR 2001, 1802, 1804 f.). Auch an dieser Stelle wird noch einmal deutlich, dass der vom BGH in der Entscheidung aus dem Jahr 1981 angenommene „Belehrungsverzicht“ sehr zweifelhaft ist - es wäre ein Verzicht zu Lasten Dritter, nämlich der Allgemeinheit, die auf die Richtigkeit der notariellen Urkunden vertraut.(5) Die Theorie der Gleichwertigkeit der Beurkundung des BGH hat damit eine gravierende Schwäche: Sie erfordert keine Kenntnis des deutschen Rechts. Aber was nutzt den Urkundsbeteiligten (und der Allgemeinheit) beispielsweise ein portugiesischer Notar mit ausgezeichneten Kenntnissen im portugiesischen Gesellschaftsrecht, der einem strengen Standesrecht der Notarkammer Lissabon unterworfen ist und sich penibel an das portugiesische Beurkundungsgesetz hält, wenn er vom Inhalt des zu beurkundenden Rechtsaktes - der Gründung einer deutschen GmbH - mangels Kenntnis des deutschen Rechts keine Ahnung hat (Hertel, aaO., Rz. 875). Der Notar soll nach dem Verständnis des deutschen Gesetzgebers ja gerade kein bloßes Schreibbüro sein, in dem unreflektiert Erklärungen protokolliert werden.(6) Schließlich kommt hinzu, dass regelmäßig nur ein deutscher Notar den Melde- und Kontrollpflichten unterliegt wie z. B. § 54 EStDV, der dem (deutschen) Notar bei der Gründung von Kapitalgesellschaften aufgibt, dem Finanzamt beglaubigte Abschriften der Gründungsurkunde zu übersenden (MK/GmbHG aaO., Rz. 55; Winkler, aaO., Rz. 95). Auch aus diesem Grund ist das Beurkundungsverfahren in der Schweiz dem deutschen nicht gleichwertig.5.Lediglich am Rande sei erwähnt, dass das Erfordernis der Beurkundung durch einen deutschen Notar keinen Verstoß gegen die europäischen Grundfreiheiten, insbesondere die Niederlassungs- bzw. Dienstleistungsfreiheit, darstellt (die im vorliegenden Fall mangels Geltung in Beziehungen zur Schweiz ohnehin nicht anwendbar wären): Eine Beschränkung der Niederlassungs- bzw. Dienstleistungsfreiheit wäre im vorliegenden Fall aus „aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses” („Gebhard-Formel“) gerechtfertigt, wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt (vgl. hierzu auch die Entscheidung des EuGH zum Staatsangehörigkeitsvorbehalt für deutsche Notare, Urt. vom 24.05.2011, C-54/08, Tz. 96-98, 100). Zudem hat der EuGH in seiner Rechtsprechung zur grenzüberschreitenden Sitzverlegung (EuGH, Urteil vom 12.07.2012, C-378/10 - „VALE“, NJW 2012, 2715, 2718, Rz. 52) es ausdrücklich für zulässig erachtet, dass der Zuzugsstaat seine gesellschaftsrechtlichen Gründungsvorschriften anwendet.Im Übrigen erstaunt die Ansicht der Gesellschaft i. Gr., dass der „internationale Rechtsverkehr“ „erheblich eingeschränkt“ werde, wenn es einem Schweizer Notar verwehrt werde, die Gründung einer deutschen GmbH zu beurkunden. Im Grundstücksrecht wird die herrschende Meinung, wonach die Auflassung nur vor einem deutschen Notar erklärt werden kann, nicht in Frage gestellt, schon gar nicht mit dem Argument, in Zeiten der Globalisierung müsse jeder Notar in jeder Rechtsordnung beurkunden können, sonst käme der „internationale Rechtsverkehr“ zum Erliegen.Das hier gefundene Ergebnis ist zudem nicht Ausdruck nationalstaatlichen Protektionismus, sondern vielmehr dem Schutz der Urkundsbeteiligten und dem Schutz der Allgemeinheit geschuldet. Jedenfalls in den Industriestaaten sind die Rechtsordnungen zwischenzeitlich so komplex, dass die überwiegende Anzahl der Angehörigen der rechtsberatenden Berufe sich verantwortungsvoll und bewusst auf die Rechtsordnung beschränken, in der sie ausgebildet worden und in der sie tätig sind. Selbst wenn man die Gründung einer deutschen GmbH für so „einfach“ hielte, dass dies auch mit begrenzten Rechtskenntnissen möglich sei, so ist zu bedenken, dass man dann dem ausländischen Notar auch zubilligen müsste, andere Beurkundungen gem. § 8 ff. BeurkG wie z. B. komplexe Vorgänge nach dem UmwG, vorzunehmen.Die Entscheidung des Gesetzgebers, die beispielsweise in § 17 Abs. 1 BeurkG zum Ausdruck kommt, ist klar: Der Notar soll (jedenfalls im Rahmen der Beurkundung gem. §§ 8 ff. BeurkG) gerade nicht nur bloßer Protokollant sein, im Gegensatz zu dem im angelsächsischen Rechtskreis beheimateten Notary Public, der über keine (vertieften) Rechtskenntnisse verfügt. Wenn man das deutsche System der vorsorgenden Rechtspflege, das auf das juristische Spezialwissen des Notars setzt, abschaffen möchte, muss dies der Gesetzgeber und nicht die Rechtsprechung entscheiden. Eine faktische Abschaffung des deutschen Systems der vorsorgenden Rechtspflege durch Eröffnung eines „Beurkundungstourismus“ ist dagegen nicht möglich. Der vorliegende Fall zeigt zudem deutlich, dass weder ein berechtigtes Interesse noch ein Bedürfnis ersichtlich ist, dass eine GmbH, deren Sitz in Berlin ist, deren Geschäftsräume in Berlin liegen und deren Geschäftsführer und Gesellschafter in Berlin wohnen, gerade vor einem Schweizer Notar gegründet wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG Fulda, Urteil vom 08.03.2013 - 30 C 150/12 (H) | § 93 InsO, § 128 HGB, §§ 128ff HGB, § 823 Abs 2 BGB, § 266a StGBDie Rechtswirkungen des § 93 InsO erstrecken sich nicht auf Ansprüche gegen Gesellschafter, die deshalb bestehen, weil diese aus einem von den handelsrechtlichen Haftungsbestimmungen unabhängigen Rechtsgrund für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft einzustehen haben. Dies ist der Fall, wenn es sich um Schadensersatzansprüche einer OHG gegen den vertretungsberechtigten Gesellschafter handelt, der in Kenntnis der Abführungspflicht vorsätzlich Arbeitnehmeranteile vorenthalten hat. Insoweit handelt es sich bei einem Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB, § 266a StGB um einen direkten Anspruch gegen den Gesellschafter, der unabhängig von der handelsrechtlichen Haftungsbestimmung des § 128 HGB besteht und neben dem Anspruch gegen die gesamtschuldnerisch haftende Gesellschaft zur Insolvenztabelle angemeldet werden kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG Hamburg, Beschluss vom 02.12.2011- 67c IN 421/11 | § 19 Abs 2 InsODer Insolvenzeröffnungsgrund der Überschuldung i.S. von § 19 Abs. 2 InsO ist auch dann gegeben, wenn das zahlungsfähige Schuldner-Unternehmen im Rahmen einer - für die Fortbestehungsprognose notwendigen - Ertragsfähigkeitsprognose innerhalb eines absehbaren Zeitraums von zweieinhalb bis drei Jahren ertraglos und zahlungsunfähig werden wird, weil der Wert der schuldnerischen Aktiva dauerhaft reduziert ist.1. Die Schuldnerin verfügt derzeit über liquide oder kurzfristig liquidierbare Mittel in Höhe von rd. € 269.000,00. Weiterhin verfügt die Schuldnerin über fällige und werthaltige Ansprüche gegen Dritte im Umfang von ca. € 30.000,00. Dem stehen monatliche laufend fällig werdende Verpflichtungen (insbesondere Pensionen, Gehälter, Miete etc.) in Höhe von ca. € 8.000,00 gegenüber. Weitere fällige Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen lediglich gegenüber der Komplementär-GmbH in Höhe von insgesamt ca. € 60,000,00. Die Schuldnerin ist daher ersichtlich aktuell nicht zahlungsunfähig i. S. d. § 17 InsO, da sie sämtliche aktuell fälligen Verbindlichkeiten erfüllen kann. Da neben den laufend fällig werdenden Verpflichtungen künftig auch nur geringe weitere Verpflichtungen entstehen werden, würde angesichts der Höhe der liquiden Mittel der Schuldnerin eine Zahlungsunfähigkeit auch erst nach Ablauf von ca. 21/2 - 3 Jahren eintreten (unterstellt, dass sich der Kurswert des vorhandenen Wertpapiervermögens in dieser Zeit nicht erheblich verändert).2. Die Schuldnerin ist auch nicht drohend zahlungsunfähig. Zwar steht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest, dass die Schuldnerin nach Ablauf von ca. 21/2 - 3 Jahren zahlungsunfähig sein wird, allerdings liegt der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit zeitlich außerhalb des für die drohende Zahlungsunfähigkeit angenommenen Prognosezeitraums von bis zu zwei Jahren (vgl. Schröder, in: Hamburger Kommentar, § 18 Rn. 9 f., m. w. N.)3. Die Gesellschaft ist spätestens seit dem 31.12.2008 bilanziell überschuldet (s. o.). Dabei indiziert die bilanzielle Überschuldung die insolvenzrechtliche Überschuldung im Rechtssinne (BGH ZInsO 2007, 1349).Deckt das Vermögen einer Gesellschaft die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr, so ist sie gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO (in der bis zum 31.12.2013 geltenden Fassung nach dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz - FMStG) überschuldet, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Im Grundsatz müssen danach in schriftlich dokumentierter Form ein schlüssiges und realisierbares Unternehmenskonzept sowie eine darauf aufbauende Finanzplanung vorliegen, der zufolge die Finanzkraft des Unternehmen zur Fortführung mittelfristig ausreicht (Schröder in: Hamburger Kommentar, § 19 Rn 15 m. w. N.). Eine solche positive Fortführungsprognose liegt m. E. nicht vor.Es ist allerdings bislang in Rechtsprechung und Literatur ungeklärt, ob (auf der Basis des § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO in der Fassung nach dem FMStG) eine positive Fortführungsprognose schon dann bejaht werden kann, wenn die Gesellschaft innerhalb des Prognosezeitraums voraussichtlich ihre fälligen Verbindlichkeiten wird fristgerecht bedienen können - also nicht zahlungsunfähig werden wird - (so Hirte/Knof/Mock ZInsO 2008, 1222; Aleth/Harlfinger NZI 2011, 166, 168; Frystatzki NZI 2011, 173) oder ob weitere Anforderungen erfüllt sein müssen, insbesondere ob innerhalb des Prognosezeitraums die Ertragsfähigkeit der Gesellschaft wiederhergestellt sein muss. Die Fortführungsprognose ist danach nur positiv, wenn die überwiegende Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass die Gesellschaft mittelfristig Einnahmen-Überschüsse erzielen wird, aus denen die gegenwärtigen und künftigen Verbindlichkeiten gedeckt werden können (so Schröder in: Hamburger Kommentar, § 19 Rn 12 ff.; Ehlers NZI 2011, 161 f.; Sikora ZInsO 2010, 1761, 1763; Dahl NZI 2008, 719, 720; Wolf DStR 2009, 2682, 2684; Baumbach/Hueck/Schulze-Osterloh, GmbHG, 17. Auflage, § 64 Rn. 11; ähnlich OLG Naumburg ZInsO 2004, 512; KG 2006, 437). Für den hier zu begutachtenden Fall hat dieser Meinungsstreit - vordergründig - folgende Auswirkung: Folgt man der Ansicht, dass bereits eine positive Liquiditätsprognose die Fortführungsprognose begründet, könnte man vorliegend zum Schluss gelangen, eine Fortführungsprognose läge vor. Denn innerhalb des Prognosezeitraum von ein bis zwei Jahren (vgl. Kirchhof in: Heidelberger Kommentar § 19 Rn. 10; Schröder a. a. O. § 19 Rn 18 m. w. N.) sind die Zahlungsverpflichtungen der Schuldnerin gedeckt (vgl. oben Ziffer 7.1). Folgt man hingegen der Ansicht, dass zusätzlich eine positive Ertragsfähigkeitsprognose vorliegen muss, läge eine Fortführungsprognose vorliegend nicht vor, da die Schuldnerin - als reine Verwalterin von Kapitalvermögen - nur über geringe Einnahmen verfügt und sicher nie mehr Einnahmen-Überschüsse erwirtschaften wird (geschweige denn solche, die die gegenwärtigen und künftigen Verbindlichkeiten decken).Vorzugswürdig ist klar die Auffassung, die zusätzlich eine positive Ertragsfähigkeitsprognose verlangt. Dies folgt aus zwei Argumenten:Zunächst findet sich das Erfordernis einer Ertragsfähigkeitsprognose bereits in einem der maßgeblichen Urteile des BGH zum nunmehr vorübergehend wieder eingeführten zweistufigen Überschuldungsbegriff, der sog. Dornier-Entscheidung (BGHZ 119, 201). Für die Dauer der Geltung des neuen "alten" Überschuldungsbegriffes in der Fassung nach dem FMStG ist diese alte BGH-Rechtsprechung aber wieder maßgeblich für die Auslegung des § 19 InsO. In der dortigen Entscheidung stellt der BGH bei der Beurteilung einer "erfolgreichen Überlebensprognose" im Wesentlichen nicht auf bestimmte Kennzahlen ab. Vielmehr setzt es sich mit den operativen Geschäftschancen der betreffenden Gesellschaft inhaltlich auseinander und stellt im dortigen Fall fest, dass im Zeitpunkt der Prognoseentscheidung die Entwicklung eines bestimmten Produkts als allgemein erfolgversprechend betrachtet wurde und für das Produkt ein Markt mit den entsprechenden Absatz- und Gewinnchancen gesehen wurde; und dies, obgleich die Gesellschaft zum damaligen Zeitpunkt über keine laufenden Einnahmen aus Geschäftstätigkeit verfügte, was zu einer erheblichen rechnerischen Überschuldung führte (BGH a. a. O.).Vorliegend sind keine Ansätze erkennbar, um die in der Handelsbilanz der Schuldner ausgewiesenen Werte für die Zwecke einer insolvenzrechtlichen Überschuldungsbilanz zu modifizieren. Zu keinem Zeitpunkt verfügte die Schuldnerin über stille Reserven, die zu einer höheren Bewertung von Aktiva in der insolvenzrechtlichen Überschuldungsbilanz geführt hätten. Die Aktiva der Schuldnerin bestanden stets überwiegend aus Geldvermögen und nach aktuellen Börsenwerten bewerteten Wertpapieren. Auch die Passiva der Schuldnerin sind stets realistisch bewertet gewesen und können daher für die Zwecke einer insolvenzrechtlichen Überschuldungsbilanz nicht modifiziert werden. Dies gilt insbesondere für die Rückstellungen, die hinsichtlich der Pensionsverbindlichkeiten der Schuldnerin gebildet wurden. Denn die betreffenden Verbindlichkeiten stehen dem Grunde nach fest und die Höhe der Rückstellungen basierte auf aktuellen versicherungsmathematischen Gutachten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG Köln, Urteil vom 13.10.2014 – 142 C 639/12 | HGB §§ 325 ff.; BGB § 3151. Die Bundesanzeiger Verlag GmbH als Betreiber des Bundesanzeigers und Unternehmensregisters hat keinen Anspruch auf ein Entgelt für die Bilanzveröffentlichungen.2. Unternehmen sind gesetzlich nach den §§ 325 ff. HGB verpflichtet, ihre Jahresabschlüsse beim Betreiber des Bundesanzeigers zur Offenlegung einzureichen. Mit der Aufgabe des Betriebes des Bundesanzeigers wurde die Bundesanzeiger Verlag GmbH aufgrund von Verträgen mit dem Bundesministerium der Justiz (BMJ) betraut. Zu diesem Zweck stellt die Bundesanzeiger Verlag GmbH eine entsprechende elektronische Publikationsplattform zur Verfügung, auf der sich die Unternehmen registrieren lassen müssen, den Auftrag elektronisch ausfüllen müssen und die Jahresabschlüsse elektronisch übermitteln müssen.3. Die Entgelte werden dabei nach Maßgabe der Verträge mit dem BMJ festgelegt.4. Hieraus folgt, dass die zur Veröffentlichung der Jahresabschlüsse verpflichteten Unternehmen keine Wahl zwischen verschiedenen Publikationsorganen haben, sondern ihrer gesetzlichen Verpflichtung nur durch einen Vertragsschluss mit der Bundesanzeiger Verlag GmbH nachkommen können.5. Es ist anerkannt, dass Tarife und sonstige Entgeltregelungen von Unternehmen mit Monopolstellung, die mittels eines privatrechtlich ausgestalteten Benutzungsverhältnisses Leistungen anbieten, auf deren Inanspruchnahme der andere Vertragsteil angewiesen ist, nach billigem Ermessen festgesetzt werden müssen und die Billigkeitskontrolle in entsprechender Anwendung des § 315 BGB zu erfolgen hat (BGH NJW-RR 2006, 133-135 m.w.N.). Die Notwendigkeit einer Billigkeitskontrolle in solchen Fällen findet ihre Rechtfertigung darin, dass der Kunde, der auf die Inanspruchnahme dieser Leistungen angewiesen ist, einem Kontrahierungszwang unterliegt und er keine andere Wahl hat, als sich mit der durch einseitige Leistungsbestimmung zustande gekommenen Preisgestaltung des (Monopol-)Unternehmens einverstanden zu erklären. Die Heranziehung des § 315 BGB zur Prüfung der Angemessenheit der Konditionen derartiger Verträge ist in diesen Fällen die gebotene Kompensation für die Einschränkung der Vertragsfreiheit.6. Diese insbesondere für den Bereich der Daseinsvorsorge entwickelten und auf staatlich regulierte Entgeltregelungen von Versorgungsunternehmen anwendbaren Grundsätze sind auch im vorliegenden Fall anwendbar. Zwar bietet die Bundesanzeiger Verlag GmbH keine Leistungen der Daseinsvorsorge an. Die Veröffentlichungsentgelte unterliegen aber aufgrund der Beauftragung durch das BMJ einer staatlichen Regulierung und Kontrolle, sodass die staatlich regulierten Entgelte, auf einer einseitigen Preisgestaltung beruhen, der sich die Kunden der Bundesanzeiger Verlag GmbH nicht entziehen können. Daher finden die Grundsätzen des § 315 BGB entsprechende Anwendung.7. Die danach entsprechend § 315 BGB vorzunehmende Kontrolle führt zu dem Ergebnis, dass eine Unbilligkeit des angesetzten Entgeltes von 30,00 Euro vorliegt.8. Bei der Bestimmung des Entgeltes im Rahmen des § 315 BGB steht dem Berechtigten ein Entscheidungsspielraum zu. Die Prüfung der Billigkeit beschränkt sich daher darauf, ob das eingeräumte Ermessen ausgeübt wurde und die bei der Ausübung im konkreten Fall zu berücksichtigenden Kriterien in die vorzunehmende Abwägung einbezogen wurden. Hierzu gehört bei Leistungsverhältnissen, mit den öffentlich rechtliche Vorgaben erfüllt werden sollen aber von Seiten des Staates privatrechtlich ausgestaltet sind, auch die Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzipes (BGH a.a.O). Das Kostendeckungsprinzip kann insbesondere dann verletzt sein, wenn die Gesamtheit des verlangten Entgelts die Gesamtheit der Aufwendungen übersteigt. Darlegungs- beweisbelastet dafür, dass die Leistungsbestimmung der Billigkeit entspricht, ist derjenige, der dieses Recht für sich in Anspruch nimmt. Er muss daher auch darlegen, ob und wenn ja welche Kriterien bei der Ermessensausübung zugrunde lagen.9. Die Bundesanzeiger Verlag GmbH hat nicht weiter zu den bei der Bemessung des Entgeltes herangezogenen Kriterien vorgetragen, sie hat nur pauschal behauptet, dass die Entgeltbemessung aufwandsgerecht erfolgt. Mangels substantiierten Vortrages ist die Bundesanzeiger Verlag GmbH damit bereits ihrer Darlegungslast zur Billigkeit des in der Preisliste für die Veröffentlichung enthaltenen Entgeltes in Höhe von 20,00 Euro nicht nachgekommen. Die Rechtsfolge ist, dass sich die Bundesanzeiger Verlag GmbH auf das in der Preisliste enthaltene Entgelt nicht berufen kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG Montabaur, Beschluss vom 19.06.2012 - HRB 20744 | AktG §§ 119, 122; InsO § 276a1. Regelmäßiges Ziel der Hauptversammlung ist es, im Rahmen ihrer Zuständigkeit über die zur Tagesordnung angekündigten Gesellschaftsangelegenheiten durch Beschluss zu entscheiden. Nicht dagegen ist Sinn der Hauptversammlung als Forum für die Diskussion von Fragen zu dienen, die außerhalb der Hauptversammlungszuständigkeit liegen. (vgl. Hüffer, AktG, 9. Aufl. 2010, § 119 Rdn. 2). Nur ausnahmsweise muss oder darf die Hauptversammlung zu bloßen Informationszwecken einberufen werden (vgl. a. a. O. Rdn. 4).2. Die §§ 119, 122 AktG werden durch § 276a InsO eingeschränkt; die neue Vorschrift bestimmt, dass bei einer juristischen Person als Schuldner weder der Aufsichtsrat noch die Gesellschafterversammlung einen Einfluss auf die Geschäftsführung des Schuldners haben. Der Gesetzgeber hat sich damit nunmehr der Auffassung angeschlossen, dass gesellschaftsrechtliche Überwachungsorgane in der Eigenverwaltung keine weitergehenden Einflussmöglichkeiten auf die Geschäftsführung haben sollen als in einem alternativen Regelinsolvenzverfahren. Die Führung der Geschäfte ist durch die Geschäftsleitung an den Interessen der Gläubiger auszurichten, Sachwalter, Gläubigerausschluss und Gläubigerversammlung überwachen die wirtschaftlichen Entscheidungen. Eine zusätzliche Überwachung durch die Organe des Schuldners erscheint nicht erforderlich (vgl. BT Drucksache 17/5712 S. 42 sowie Braun, InsO, 5. Aufl. 2012, § 276 a, Rdn. 1 + 2).3. Daher steht den Aktionären ein Recht auf Ermächtigung zur Einberufung der Hauptversammlung nicht zu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG Stuttgart-Bad Cannstatt, Urteil vom 13.08.2015 - 8 C 1023/15 | § 287 ZPOBei der Bestimmung - und ggf. Schätzung nach § ZPO § 287 ZPO - des Schadensersatzes im Wege der sog. „Lizenzanalogie“ nach § ZPO § 97 Abs. ZPO § 97 Absatz 2 Satz 3 ZPO, wonach der Schadensersatzanspruch auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden kann, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte, ist Folgendes zu berücksichtigen:Das Gericht orientiert sich bei seiner Schätzung des Schadens nach der Lizenzanalogie nach § ZPO § 287 Abs. ZPO § 287 Absatz 1 Satz 1 ZPO an verschiedenen Kriterien. In erster Linie kommt es auf die sonst für den Verletzten übliche vertragliche Vergütung oder die branchenüblichen Vergütungssätze und Tarife an. Abzustellen ist auf die konkrete Rechtsverletzung, um feststellen zu können, welches Verwertungsrecht verletzt wurde. Daraus ergibt sich, welche Nutzungsrechte fiktiv hätten eingeräumt werden müssen, so dass die für dieses Nutzungsrecht übliche Vergütung ermittelt werden kann. Im Rahmen der Schätzung können nur solche Tarife zugrunde gelegt werden, die auf die jeweilige Rechtsverletzung anwendbar sind. Sind derartige Bemessungsgrößen nicht ermittelbar, richtet sich die Bestimmung der Höhe der angemessenen Lizenzgebühr im Sinne des § ZPO § 287 Abs. ZPO § 287 Absatz 1 Satz 1 ZPO nach dem Betrag, den vernünftige Lizenzvertragsparteien - also nicht der konkrete Verletzer - für die Nutzungsrechtseinräumung als Lizenzgebühr vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der Rechtsverletzung vorausgesehen hätten (Spindler in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 3. Aufl. 2015, § 97 UrhG Rn. SPINDLERSCHUSTERKOREM 3 URHG § 97 Randnummer 36f. m. w. N.).1. Aus technischer Sicht ist bei der Schätzung des Schadensersatzanspruches aus Lizenzanalogie zunächst das Ausmaß der Urheberrechtsverletzung festzustellen.a) Das Zurverfügungstellen einer - wie hier - urheberrechtlich geschützten Datei ist ein von den Nutzern einer Tauschbörse in Kauf genommener Reflex darauf, dass sie selbst die Datei herunterladen.Jede Internetverbindung ist im Stande, Daten herunterzuladen und hochzuladen. Die hierbei erreichten Geschwindigkeiten werden in „kBit pro Sekunde“ oder „MBit pro Sekunde“ angegeben. Hieraus resultieren bekannte Bezeichnungen wie „DSL 16.000“, wobei mit der Zahl stets die für die meisten Nutzer relevante Downloadgeschwindigkeit wiedergegeben wird. Nach der Norm IEC 60027-2 wurden die früheren Umrechnungsgrößen von 1.024 als „Binärpräfixe“ nicht mehr marktüblich und stattdessen die sog. „SI-Präfixe“ mit einer Umrechnungsgröße von 1.000 eingeführt, so dass folgende Umrechnungsgrößen gelten: 8 Bit sind ein Byte, 1.000 Byte sind ein Kilobyte, 1.000 Kilobyte sind ein Megabyte, 1.000 Megabyte sind ein Gigabyte; 1.000 Bit sind ein Kilobit („kBit“), 1.000 Kilobit sind ein ein Megabit („MBit“).Tauschbörsen funktionieren so, dass sie Dateien, die sich in einem bestimmten Computerordner befinden, anderen Nutzern der Tauschbörsensoftware zum Herunterladen anbieten. In diesen Computerordner werden zugleich Dateien gespeichert, die der Nutzer von anderen Nutzern herunterlädt. Das führt dazu, dass jeder, der eine Datei herunterlädt, diejenigen Teile der Datei, die er bereits erfolgreich heruntergeladen hat, seinerseits wiederum anderen Nutzern zum Download anbietet.Nach dem erfolgreichen Abschluss des Downloads der Datei verbleibt sie in demselben Computerordner und kann - erst jetzt - von dort manuell in einen anderen Ordner verschoben werden. Regelmäßig verschieben Nutzer zeitnah nach Abschluss des Downloads die fertig heruntergeladene Datei in einen anderen Ordner, um zu verhindern, dass sie von der Tauschbörsensoftware weiterhin anderen Nutzern angeboten wird. Denn dieses „Anbieten“ der Datei erfordert stets neben den Hochlade-Kapazitäten aus technischen Gründen auch in geringem Umfang Herunterlade-Kapazitäten der Internetverbindung, die die Nutzer anderweitig - nämlich für ihre eigenen Downloads - bevorzugt nutzen.Die Geschwindigkeit, mit der Daten über die Internetverbindung hochgeladen - und damit anderen Nutzern der Tauschbörse zur Verfügung gestellt - werden, liegt regelmäßig etwa bei 10% der Downloadgeschwindigkeit des Anschlusses (sog. „asymmetrische Bandbreite“). Das bedeutet, dass in der Zeit, in der ein urheberrechtlich geschützter Titel mit maximaler Internetgeschwindigkeit heruntergeladen wird, technisch maximal 10% des Titels anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden können. Dabei ist die Menge der Daten, die ein Nutzer anderen anbieten kann, stets die gleiche. D. h. je mehr Nutzer von dem PC eines anderen Daten herunterladen, desto geringer ist die Datenmenge, die jeder von ihm erhält, weil sich der Runterladende die Internet-Hochlade-Bandbreite mit anderen teilen muss. Stets verbleibt es daher, unabhängig von der Zahl der Nutzer, die von einem Urheberrechtsverletzer Daten heruntergeladen, dabei, dass der Verletzer insgesamt nicht mehr als 10% der Datei hochgeladen und damit anderen zur Verfügung gestellt haben kann.Um in einer Tauschbörse mit voller Bandbreite herunterzuladen, ist es im Umkehrschluss erforderlich, dass pro Nutzer, der eine Datei herunterladen will, 10 Nutzer erforderlich sind, die die gewünschte Datei zum Download bereit halten. Oftmals fehlt es an dieser Zahl der Nutzer, die eine bestimmte Datei zum Download anbieten, so dass die gesamte Bandbreite eines Internetanschlusses, mit dem ein Nutzer eine gewünschte Datei von anderen Nutzern herunterlädt, zwangsläufig nicht ausgeschöpft wird. Vor diesem Hintergrund ist es regelmäßig - schätzungsweise in etwa 50% der Fälle - so, dass der Download großer Dateien wie von Filmen, Software oder Spielen vor deren Abschluss abgebrochen wird. Das führt auch dazu, dass diese Dateien nach Downloadabbruch und Löschung anderen Nutzern nicht mehr zum Download angeboten werden. Gleichzeitig wird etwa die andere Hälfte der Nutzer eine langsamere Download-Geschwindigkeit in Kauf nehmen, um die begehrte Datei zu erhalten, so dass sie auch die bereits heruntergeladenen Teile der Datei ihrerseits doppelt so lange zum Download anbietet. Daher heben sich diese Effekte gegenseitig auf.Ausgehend hiervon wird die Datenmenge, die ein Nutzer zum Download angeboten hat, während er eine Datei heruntergeladen hat, bei den anfänglich ausgeführten 10% der Datei liegen. Hat eine Datei wie ein Film, ein Computerspiel oder eine Software einen Umfang von mehreren Gigabyte, kann hierauf ein Aufschlag von etwa 2% vorgenommen werden. Er ist dadurch begründet, dass eine gewisse - regelmäßig kurze - Zeit zwischen Fertigstellung des Downloads und dem manuellen Verschieben der Datei aus dem Download-Ordner verstreichen wird, innerhalb derer die Datei weiterhin anderen Nutzern angeboten wird. Der Aufschlag ist jedoch bei Musiktiteln, die nur wenige Megabyte groß sind, mit etwa 50% anzusetzen, weil bei ähnlichem, regelmäßig jedoch kürzerem Zeitablauf, zwischen Fertigstellung und Verschieben der Datei aus dem Download-Ordner der Musiktitel wesentlich häufiger heruntergeladen werden kann.Auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es sein kann, dass die von einem Nutzer während seines Downloads in der Tauschbörse angebotene, urheberrechtlich geschützte Datei nicht derart gefragt ist, dass von ihm die Datei mit seiner vollen Internetbandbreite heruntergeladen wird, erscheinen diese Werte richtig, nachdem es ebenso sein kann, dass im Einzelfall die Zeitspanne, innerhalb derer die Nutzer die Datei nach Abschluss ihres eigenen Downloads in der Tauschbörse anbieten, länger als in den vorstehenden Schätzungen genannt, liegt.b) Im vorliegenden Fall verfügte der Beklagte über einen DSL 6.000-Anschluss von „Alice“ bzw. der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG. Seine Hochlade-Geschwindigkeit („Upload-Geschwindigkeit“) betrug 576 Kilobit pro Sekunde (http://www.dsl-isdn-anbieter.de/DSL-6000.htm, Abruf am 11.08.2015) und damit in etwa die vorgenannten 10% seiner Downloadgeschwindigkeit, so dass der Ansatz der insgesamt 12% des Filmwerks, die maximal über seinen Internetanschluss dritten Nutzern der Tauschbörse angeboten worden sein werden, angemessen ist.2. Ausgehend von den vorstehenden Ausführungen kann der Klägerin ein Schaden entstanden sein, den ihr der Beklagte hätte - nach der Lizenzanalogie - entrichten müssen, wenn er von ihr die Erlaubnis erworben hätte, 13,62% des von ihr angebotenen Titels einem anderen zur Verfügung zu stellen. Selbst wenn die Klägerin derartige Rechte nicht mit den errechneten Quoten vertreibt, hätten vernünftige Lizenzvertragsparteien für die Nutzungsrechtseinräumung als Lizenzgebühr im Zweifel exakt 13,62% des Ladenpreises des streitgegenständlichen Filmwerks vereinbart. Das Filmwerk hat einen Ladenpreis von 14,99 €, so dass sich die Lizenzgebühr rechnerisch auf 2,04 € belaufen würde. Ob man diese Gebühr ansetzt oder davon ausgeht, zumindest der Ladenpreis für eine Lizenz sei geschuldet, kann hier dahinstehen.3. Auch der Gegenstandswert des von der Klägerin vorgerichtlich begehrten Unterlassungsanspruches ist mit exakt diesen Beträgen zu beziffern. Eine andere Verbreitung des Filmwerks durch den Beklagten als jene durch eine Tauschbörse drohte der Klägerin zu keinem Zeitpunkt. Es ist auch aufgrund des Zeitablaufs davon auszugehen, dass der Beklagte, als die Klägerin an ihn herantrat, das Filmwerk nicht mehr über eine Tauschbörse anbot, weil er dessen Download bereits abgeschlossen oder abgebrochen hatte.4. Ausgehend von einem Gegenstandswert von allenfalls 14,99 € ist schließlich auch der Gebührenanspruch des Klägervertreters für seine außergerichtliche Tätigkeit zu bewerten. Er wandte sich - soweit der Fall nur den Beklagten betraf - mit Schreiben vom 08.02.2013 an den Beklagten. Es ist davon auszugehen, dass der Klägervertreter auch in sämtlichen weiteren Fällen, in denen er Auskünfte aufgrund des Beschlusses des Landgerichts München I vom LGMUENCHENI 29.01.2013 erhalten hat, gleichlautende Schreiben verwendet hat, die sich lediglich in der Anschrift des Empfängers und in dem vorgeworfenen Urheberrechtsverstoß unterschieden, während die weiteren Ausführungen des Klägervertreters auf den Seiten 2ff. des Schreibens, selbst wenn sie lange Rechtsausführungen, die teilweise richtig sein mögen, enthalten, identisch waren. Vor diesem Hintergrund hält das Gericht jedenfalls für die Abfassung dieser standardisierten Abmahnschreiben nur den Ansatz einer Gebühr nach Nr. 2301 VV RVG für angezeigt.5. Das Gericht verkennt schließlich nicht, dass seine vorstehenden Ausführungen, wenn ihnen andere Gerichte folgen würden, das Abmahnwesen im Bereich des Urheberrechts weniger lukrativ machen und schließlich die effektive Verfolgung von Urheberrechtsverstößen in Tauschbörsen beeinträchtigen mögen. Hieraus kann jedoch nicht folgen, dass tatsächlich nicht entstandene - pönale - Schäden liquidiert werden und das Fehlen der unter Richtern wenig verbreiteten technischen Kenntnisse als Vehikel hierfür genutzt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG Weimar, Urteil vom 11.01.2021 – 6 OWi - 523 Js 202518/20 | IFSG § 4, § 5 Abs. 1, § 28, § 28a, § 32 GG Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 80 Abs. 1 S. 1 u. S. 2, Art. 100 Abs. 1 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1, § 14 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 TenorDer Betroffene wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Betroffenen hat die Staatskasse zu tragen. GründeI. Am 24.04.2020 hielt sich der Betroffene in den Abendstunden zusammen mit mindestens sieben weiteren Personen im Hinterhof des Hauses X-Straße 1 in W. auf, um den Geburtstag eines der Beteiligten zu feiern. Die insgesamt acht Beteiligten verteilten sich auf sieben verschiedene Haushalte. Diese Feststellungen beruhen auf den glaubhaften Angaben des Betroffenen in der Hauptverhandlung und dem verlesenen Einsatzbericht der Polizei. II. Dieses Verhalten des Betroffenen verstieß gegen § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO vom 18.04.2020 in der Fassung vom 23.04.2020. Diese Normen lauteten wie folgt: § 2 Abs. 1: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur allein, im Kreise der Angehörigen des eigenen Haushalts und zusätzlich höchstens mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet. § 3 Abs. 1: Veranstaltungen, Versammlungen im Sinne des § VERSAMMLG § 1 des Versammlungsgesetzes in der Fassung vom 15. November 1978 (BGBl. I S. 1789) in der jeweils geltenden Fassung, Demonstrationen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte mit mehr als zwei Personen sind verboten mit der Ausnahme, dass es sich um Angehörige des eigenen Haushalts handelt und zusätzlich höchstens eine haushaltsfremde Person hinzukommt. Dies gilt auch für Zusammenkünfte in Kirchengebäuden, Moscheen und Synagogen sowie in Kulträumen anderer Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften. § 2 Abs. 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO regelte Ausnahmen vom Verbot nach § 2 Abs. 1 für die Berichterstattung durch Medienvertreter, die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten im Freien und die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und von Kraftfahrzeugen, § 3 Abs. 2-4 regelten Ausnahmen vom Verbot nach § 3 Abs. 1 für bestimmte Arten von Veranstaltungen, (öffentliche) Versammlungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel, Gottesdienste und sonstige religiöse Zusammenkünfte, Trauerfeiern und Eheschließungen. Keine dieser Ausnahmen ist vorliegend einschlägig. Dieser Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit gem. § 14 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 i. V. m. § 73 Abs. 1a Nr. 24 i. V. m. § IFSG § 32 Satz 1 IfSG dar. Der Betroffene war dennoch aus rechtlichen Gründen freizusprechen, weil § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO verfassungswidrig und damit nichtig sind. Das Gericht hatte selbst über die Verfassungsmäßigkeit der Normen zu entscheiden, weil die Vorlagepflicht gem. GG Art. 100 Abs. 1 nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (grundlegend BVerfGE 1, 184, 195 ff) nur für förmliche Gesetze des Bundes und der Länder, nicht aber für nur materielle Gesetze wie Rechtsverordnungen gilt. Über deren Vereinbarkeit mit der Verfassung hat jedes Gericht selbst zu entscheiden. III. § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO sind aus formellen Gründen verfassungswidrig, da die tief in die Grundrechte eingreifenden Regelungen von der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage im Infektionsschutzgesetz nicht gedeckt sind. 1. Gemäß GG Art. 80 Abs. 1 S. 1 u. S. 2 kann die Exekutive durch ein Gesetz ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei müssen gemäß GG Art. 80 Abs. 1 S. 1 u. S. 2 Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetz bestimmt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat die sich daraus ergebenden Anforderungen an ein ermächtigendes Gesetz in ständiger Rechtsprechung mit drei sich gegenseitig ergänzenden Konkretisierungsformeln, der sog. Selbstentscheidungsformel (der Gesetzgeber hat selbst die Entscheidung darüber zu treffen, welche Fragen durch die Rechtsverordnung geregelt werden sollen, welche Grenzen der Normierung gesetzt sind und welchem Ziel sie dienen soll; (BVerfGE 2, 307, 334)), der Programmformel (anhand des Gesetzes muss sich bestimmen lassen, welches gesetzgeberische Programm verordnungsrechtlich umgesetzt werden soll; BVerfGE 5, 71, 77)) und der Vorhersehbarkeitsformel (der Bürger muss dem ermächtigenden Gesetz entnehmen können, in welchen Fällen und mit welcher Tendenz von der Ermächtigung Gebrach gemacht wird und welchen Inhalt die Rechtsverordnung haben wird; BVerfGE 56, 1, 12)) näher expliziert. Darüber hinaus hat es zur Frage des Grades der Bestimmtheit der Ermächtigung die sog. Wesentlichkeitslehre entwickelt. Nach der Wesentlichkeitslehre muss der Gesetzgeber in grundlegenden normativen Bereichen, zumal im Bereich der Grundrechtsausübung - soweit diese staatlicher Regelung überhaupt zugänglich ist - alle wesentlichen Entscheidungen selbst treffen und darf diese nicht an die Exekutive delegieren (BVerfGE 142, 1, 109; BVerfGE 98, 218, 251; BVerfGE 116, 24, 58)). Je wesentlicher Rechtsverordnungen oder andere Rechtsakte der Exekutive in Grundrechte eingreifen, umso genauer und intensiver müssen die Regelungen des ermächtigenden Gesetzes sein. Das Bundesverfassungsgericht sieht dabei die Anforderungen von GG Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG und der Wesentlichkeitslehre als deckungsgleich an (BVerfGE 150, 1, 100)). Ist im Hinblick auf bestimmte Normen einer Rechtsverordnung den Anforderungen der Wesentlichkeitslehre durch das ermächtigende Gesetz nicht Genüge getan, führt dies zur Verfassungswidrigkeit der Normen der Verordnung (BVerfGE 150, 1, 209; BVerfGE 136, 69, 92). Rechtsgrundlage für das hier zur Rede stehende sog. allgemeine Kontaktverbot ist IFSG § 32 i. V. m. § 28 Abs. 1 Satz 1 in der Fassung vom 27.03.2020. Auf die Generalklausel des IFSG § 28 Abs. 1 Satz 1 muss insoweit nicht zurückgegriffen werden (vgl. Kießling/Kießling IfSG, § 28 Rn. 35, 44). IFSG § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 in der Fassung vom 27.03.2020 lauten: "(Satz 1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. (Satz 2) Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen.“ Da unter „Ansammlungen von Menschen“ Personenmehrheiten von mindestens drei Personen mit einem inneren Bezug oder einer äußeren Verklammerung zu verstehen sind (Kießling, aaO, Rn. 38f), lassen sich § 2 Abs. 1 und das Ansammlungsverbot des § 3 Abs. 1 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO zwar unter den Wortlaut von USFG § 28 Abs. 1 Satz 2 subsumieren, für eine eingriffsintensive Maßnahme wie ein allgemeines Kontaktverbot ist IFSG § 28 Abs. 1 Satz 2 aber keine den Anforderungen der Wesentlichkeitslehre genügende Ermächtigungsgrundlage. Ein allgemeines Kontaktverbot stellt zumindest - die Frage der Betroffenheit der Menschenwürdegarantie muss an dieser Stelle zurückgestellt werden und wird unter IV. erörtert - einen schweren Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit gem. GG Art. 2 Abs. 1, darüber hinaus aber auch in die Versammlungs-, Vereinigungs-, Religions-, Berufs- und Kunstfreiheit dar, nicht nur, weil es alle Bürger adressiert und zwar unabhängig von der Frage, ob sie Krankheits- oder Ansteckungsverdächtige i. S. v. IFSG § 28 Abs. 1 Satz 1 sind oder nicht. Indem allen Bürgern untersagt wird, mit mehr als einer haushaltsfremden Person zusammenzukommen, wobei dies vorliegend nicht nur für den öffentlichen Raum (§ 2 Abs. 1 ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO), sondern gem. § 3 Abs. 1 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO auch für den privaten Raum galt, sind die Freiheitsrechte im Kern betroffen. Das allgemeine Kontaktverbot zieht dabei zwangsläufig weitere Grundrechtseinschränkungen nach sich. So ist es nur logisch folgerichtig, dass unter der Geltung eines allgemeinen Kontaktverbotes Einrichtungen aller Art ( § 5 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO), Einzelhandelsgeschäfte, Beherbergungsbetriebe ( § 6 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO) und Gastronomiebetriebe ( § 7 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO) ebenfalls geschlossen oder jedenfalls beschränkt werden. Der Gesetzgeber hatte als Eingriffsvoraussetzung für ein allgemeines Kontaktverbot vor der Schaffung von IFGS § 28a mit Gesetz vom 18.11.2020 lediglich inIFGS § 18 Abs. 1 IfSG bestimmt, dass Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige etc. einer übertragbaren Krankheit festgestellt wurden und dass die Maßnahme nur „soweit und solange es zur Verhinderung der Krankheitsverbreitung erforderlich ist“, getroffen werden darf, wobei letzteres nicht mehr als ein expliziter Verweis auf das ohnehin geltende Verhältnismäßigkeitsprinzip ist. Damit sind nur absolute Minimalvoraussetzungen geregelt. Das Gesetz kann in dieser Form nur Einzelmaßnahmen wie z.B. die in IFGS § 28 Abs. 1 Satz 2 genannte Schließung von (einzelnen) Badeanstalten tragen, nicht aber ein allgemeines Kontaktverbot. Soweit ein allgemeines Kontaktverbot überhaupt verfassungskonform sein kann (dazu näher unter IV. und V.), wäre dafür zumindest eine präzise Regelung der Anordnungsvoraussetzungen im Sinne einer genauen Konkretisierung der erforderlichen Gefahrenlage zu fordern, aber auch auf der Rechtsfolgenseite wären konkretisierende Regelungen notwendig (vgl. Kießling, aaO Rn. 63; Papier, Freiheitsrechte in Zeiten der Pandemie, DRiZ, 2020, DRIZ 2020, 180; Bäcker, Corona in Karlsruhe, VerfBlog v. 25.03.2020, https://verfassungsblog.de/corona-in-karlsruhe-ii/; Möllers, Parlamentarische Selbstentmächtigung im Zeichen des Virus, VerfBlog v. 26.03.2020, https://verfassungsblog.de/parlamentarischeselbstentmaechtigung-im-zeichen-des-virus/). 2. Dass IFGS § 28 hinsichtlich der tiefgreifenden Grundrechtseingriffe einschließlich eines Kontaktverbots durch die verschiedenen Corona-Verordnungen der Länder jedenfalls im Grundsatz nicht den Anforderungen der Wesentlichkeitsdoktrin genügt, ist in Rechtsprechung und Literatur inzwischen weitgehend Konsens. Der Gesetzgeber hat darauf zwischenzeitlich auch mit der Einfügung von IFGS § 28a zu reagieren versucht. Die Rechtsprechung hat aber, um einer sonst unvermeidlichen Verwerfung der Verordnungen zu entgehen, vielfach darauf verwiesen, dass anerkannt sei, dass es im Rahmen unvorhergesehener Entwicklungen aus übergeordneten Gründen des Gemeinwohls geboten sein könne, nicht hinnehmbare gravierende Regelungslücken für einen Übergangszeitraum auf der Grundlage von Generalklauseln zu schließen und auf diese Weise selbst sehr eingriffsintensive Maßnahmen, die an sich einer besonderen Regelung bedürften, vorübergehend zu ermöglichen (exemplarisch: OVG NRW, Beschluss vom 06.04.2020 - OVG Münster - 13 B 398/20.NE -, juris, Rn. 59 unter Berufung auf OVG NRW, Urteil vom 5. Juli 2013 - OVG Münster - 5 A 607/11 juris, Rn. 97 ff.; Saarl. OVG, Urteil vom 6. September 2013 - 3 A 13/13 -, juris, Rn. 77 ff.; VGH Bad.-Württ., Urteil vom 22. Juli 2004 - VGH Mannheim - 1 S 2801/03 juris, Rn. 30; BVerfG, Beschluss vom 8. November 2012 - 1 BvR 22/12 -, juris, Rn. 25; BVerwG, Beschluss vom 31. Januar 2019 - 1 WB 28.17 - juris, Rn. 35; Bethge, Ausgangssperre, VerfBlog v. 24.03.2020). Diese Voraussetzungen lägen vor, da es sich bei der Corona-Pandemie um ein derart beispielloses Ereignis handele, dass vom Gesetzgeber nicht verlangt werden könnte, die erforderlichen Regelungen bereits im Voraus getroffen zu haben. Es bestehe auch ein dringender Handlungsbedarf, der zur Schließung gravierender, bei einer Abwägung der gegenläufigen verfassungsrechtlichen Positionen nicht mehr vertretbarer Schutzlücken den vorübergehenden Rückgriff auf die infektionsschutzrechtliche Generalklausel gebieten würde (OVG NRW, Beschluss vom 06.04.2020 - OVG Münster - 13 B 398/20.NE -, juris, Rn. 61). Je länger die Freiheitsbeschränkungen in der Corona-Krise andauerten, wurde in der Rechtsprechung zunehmend die Frage diskutiert, ob der „Übergangszeitraum“ nicht bereits abgelaufen sei [vgl. etwa BayVGH, Beschluss vom 29.10.2020 - VGH München - 20 NE 20.2360 -, juris, der dieser Frage breiten Raum widmet und sie an einer Stelle zumindest implizit bereits bejaht (Rn. 30): „Bis zu welchem Ausmaß und für welchen Zeitraum die §§ IFSG § 32, IFSG § 28 IfSG möglicherweise noch ausreichend waren, um die mit einer bislang nicht dagewesenen Pandemie … entstandene Gefahrenlage zu bewältigen, bedarf an dieser Stelle keiner abschließenden Entscheidung …“ (Hervorhebung hinzugefügt), um dann mit dem Argument, dass der Bayerische Landtag die Staatsregierung mittlerweile aufgefordert habe, sich für die Schaffung konkreter Befugnisnormen im IfSG einzusetzen, am Ende die Frage doch wieder in die Schwebe zu bringen und von einer Verwerfung der angegriffenen Norm abzusehen.] 3. Es kann hier dahinstehen, ob die damit vorgenommene Relativierung der Geltung der Wesentlichkeitslehre mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Einklang zu bringen ist (ablehnend etwa Möllers, aaO: „Sollten wir aus der Krise mit der Einsicht herausgehen, dass fundamentale Normen der Arbeitsteilung zwischen Parlament und Regierung … befristet unter einem ungeschriebenen verfassungsrechtlichen Notstandsvorbehalt stehen, wäre das fatal.“), es soll diesbezüglich lediglich noch darauf hingewiesen werden, dass die einzige in diesem Zusammenhang zitierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, der Beschluss vom 08.11.2012 - 1 BvR 22/12 -, kaum als Beleg angeführt werden kann, da in dieser Entscheidung lediglich unbeanstandet gelassen wurde, dass die Untergerichte die polizeiliche Generalklausel in einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes als noch ausreichende Rechtsgrundlage für eine Maßnahme, die möglicherweise einer detaillierten Ermächtigungsgrundlage bedurft hätte, angesehen haben, die Entscheidung über die Frage der Rechtsgrundlage somit in das Hauptsacheverfahren verlagert wurde. Dass gesetzliche Regelungslücken von der Exekutive unter bestimmten Bedingungen durch die Anwendung von Generalklauseln geschlossen werden könnten und insoweit die Anforderungen der Wesentlichkeitslehre vorübergehend suspendiert seien, ist damit in dieser Entscheidung nicht gesagt. Soweit eingriffsintensive Maßnahmen, die an sich einer besonderen Regelung bedürften, unter Rückgriff auf Generalklauseln nur im Rahmen „unvorhergesehener Entwicklungen“ zulässig sein sollen, ist diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt. Bereits im Jahr 2013 lag dem Bundestag eine unter Mitarbeit des Robert Koch-Instituts erstellte Risikoanalyse zu einer Pandemie durch einen „Virus Modi-SARS“ vor, in der ein Szenario mit 7,5 Millionen (!) Toten in Deutschland in einem Zeitraum von drei Jahren beschrieben und antiepidemische Maßnahmen in einer solchen Pandemie diskutiert wurden (Bundestagsdrucksache 17/12051). Der Gesetzgeber hätte daher im Hinblick auf ein solches Ereignis, das zumindest für „bedingt wahrscheinlich“ (Eintrittswahrscheinlichkeit Klasse C) gehalten wurde, die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes prüfen und ggf. anpassen können. Hinzu kommt - und dieses Argument ist gewichtiger -, dass am 18.04.2020, dem Tag des Erlasses der 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO, weder in Deutschland im Ganzen betrachtet, noch in Thüringen eine epidemische Lage bestand, angesichts derer es ohne die Ergreifung von einschneidenden Maßnahmen durch die Exekutive unter Rückgriff auf die infektionsschutzrechtliche Generalklausel bzw. die (den Anforderungen der Wesentlichkeitslehre ebenfalls nicht genügenden) Spezialermächtigungen des IFGS § 28 Abs. 1 S. 2 zu „nicht mehr vertretbaren Schutzlücken“ gekommen wäre. Es gab keine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ ( IFSG § 5 Abs. 1) wenngleich dies der Bundestag mit Wirkung ab 28.03.2020 festgestellt hat. Diese Einschätzung ergibt sich bereits allein aus den veröffentlichten Daten des Robert Koch-Instituts: - Der Höhepunkt der COVID-19-Neuerkrankungen (Erkrankungsbeginn = Beginn der klinischen Symptome) war bereits am 18.03.2020 erreicht. Dies ergibt sich aus einer Grafik, die seit dem 15.04.2020 täglich in den Situationsberichten des Robert Koch-Instituts veröffentlicht wurde und die den zeitlichen Verlauf der Neuerkrankungen zeigt (z.B. Lagebericht vom 16.04.2020, S. 6, Abb. 6). Bringt man hier noch die laut Robert Koch-Institut durchschnittliche Inkubationszeit von 5 Tagen in Abzug, ergibt sich als Tag des Höhepunktes der Neuinfektionen der 13.03.2020. Zum Zeitpunkt des Beginns des Lockdowns am 22.03.2020 sank damit die Zahl der Neuinfektionen bereits seit 10 Tagen. Einschränkend ist lediglich zu bemerken, dass die Ermittlung des Verlaufs der Neuerkrankungen durch das Robert Koch-Institut insoweit mit einer Unsicherheit behaftet ist, als sie allein auf den gemeldeten Positivtests (und dem dabei entweder mit gemeldeten Erkrankungsbeginn bzw. - soweit nicht bekannt - dem geschätzten Erkrankungsbeginn) beruht und die Zahl der durchgeführten Tests nicht konstant war. Da aber von der 11. Kalenderwoche (09.-15.03.) bis zur 14. Kalenderwoche die wöchentlichen Testzahlen gesteigert wurden - von der 11. auf die 12. Kalenderwoche sprunghaft, danach nur noch mäßig - wäre für den Peak der Kurve der Neuerkrankungen eine zeitliche Verzerrung nach hinten zu erwarten, er wäre somit „verspätet“ registriert worden und könnte in Wirklichkeit noch etwas vor dem 18.03.2020 gelegen haben. Dies kann hier aber dahingestellt bleiben, da es die vorliegende Argumentation nur noch verstärken würde. - Vor dem Lockdown gab es dementsprechend auch keine exponentielle Steigerung der Neuinfektionen. Zwar stieg die Zahl der Positivtests von 7.582 in der 11. Kalenderwoche (09.-15.03.) auf 23.820 in der 12. Kalenderwoche (16.-22.03.) und damit um 214%, dieser Anstieg war aber vor allem auf eine Steigerung der Testzahlen von 127.457 (11. KW) um 173% auf 348.619 (12. KW) zurückzuführen (Lagebericht vom 15.04.2020, Tabelle 4, S. 8). Der Anteil der Positivtests an den Gesamttests (sog. Positivenquote) stieg nur von 5,9% auf 6,8%, was einer Steigerung um lediglich 15% entspricht. - Wie sich aus dem Epidemiologischen Bulletin 17/2020 des Robert Koch-Instituts, veröffentlicht am 15.04.2020, ergibt, sank die effektive Reproduktionszahl R nach den Berechnungen des RKI bereits am 21.03.2020 unter den Wert 1 (https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6650.2/17_2020_2.Artikel.pdf?sequence=3& isAllowed=y) und blieb dann mit kleineren Schwankungen ungefähr bei 1. Da nach den Erläuterungen des Robert Koch-Instituts (Erläuterung der Schätzung der zeitlich variierenden Reproduktionszahl R, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/R-Wert-Erlaeuterung.pdf? blob=publicationFile) die an einem bestimmten Tag berichtete Reproduktionszahl die Neuinfektionen im Zeitraum 13 bis 8 Tage vor diesem Tag beschreibt, ist diese Zeitverzögerung noch in Abzug zu bringen, so dass danach der R-Wert (bei einer Korrektur um 10 Tage) bereits am 11. März unter 1 lag, was obigem Befund zum Höhepunkt der Neuinfektionen entspricht (vgl. Kuhbandner, Warum die Wirksamkeit des Lockdowns wissenschaftlich nicht bewiesen ist, https://www.heise.de/tp/features/Warum-die-Wirksamkeit-des-Lockdowns-wissenschaftlich-nicht-bewiesen-ist-4992909.html?seite=all.) - Da die Zahl der Neuinfektionen bereits seit Mitte März rückläufig war, ist es nicht überraschend, dass in Deutschland zu keinem Zeitpunkt im Frühjahr 2020 eine konkrete Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems durch eine „Welle“ von COVID-19-Patienten bestand. Wie sich dem am 17.03.2020 neuetablierten DIVI-Intensivregister entnehmen lässt, waren im März und April in Deutschland durchgehend mindestens 40% der Intensivbetten frei. In Thüringen wurden am 03.04.2020 378 Intensivbetten als belegt gemeldet, davon 36 mit COVID-19-Patienten. Dem standen 417 (!) freie Betten gegenüber. Am 16.04.2020, also zwei Tage vor dem Erlass der Verordnung wurden 501 Intensivbetten als belegt gemeldet, davon 56 mit COVID-19-Patienten. Dem standen 528 (!) freie Betten gegenüber (https://www.intensivregister.de/ …aktuelle-lage/zeitreihen Die Zunahme der Gesamtbettenzahl ist dadurch zu erklären, dass anfangs nicht alle Kliniken an das DIVI-Intensivregister meldeten, erst ab dem 25. April kann von einer Meldung nahezu aller Kliniken ausgegangen werden.) Die Höchstzahl der gemeldeten COVID-19- Patienten betrug in Thüringen im Frühjahr 63 (28. April), die Zahl der COVID-19-Patienten lag damit zu keinem Zeitpunkt in einem Bereich, bei dem eine Überlastung des Gesundheitssystems zu befürchten gewesen wäre. - Diese Einschätzung der tatsächlichen Gefahren durch COVID-19 im Frühjahr 2020 wird bestätigt durch eine Auswertung von Abrechnungsdaten von 421 Kliniken der Initiative Qualitätsmedizin (https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/effekte-der-sars-cov-2-pandemie-auf-die-stationaere-versorgung-im-ersten-halbjahr-2020), die zu dem Ergebnis kam, dass die Zahl der in Deutschland im ersten Halbjahr 2020 stationär behandelten SARI-Fälle (SARI = severe acute respiratory infection = schwere Atemwegserkrankungen) mit insgesamt 187.174 Fällen sogar niedriger lag als im ersten Halbjahr 2019 (221.841 Fälle), obwohl darin auch die COVID bedingten SARI-Fälle mit eingeschlossen waren. Auch die Zahl der Intensivfälle und der Beatmungsfälle lag nach dieser Analyse im ersten Halbjahr 2020 niedriger als in 2019. - Auch die Sterbestatistik unterstützt diesen Befund. Laut Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts (https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html?nn=209016) starben im ersten Halbjahr 2020 in Deutschland 484.429 Menschen, im ersten Halbjahr 2019 waren es 479.415, 2018 501.391, 2017 488.147 und 2016 461.055 Menschen. Sowohl 2017 als auch 2018 gab es danach im ersten Halbjahr mehr Todesfälle als in 2020 (für die weitere Entwicklung vgl. den CoDAG-Bericht Nr. 4 des Instituts für Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität München vom 11.12.2020, https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/bericht-4.pdf). - Die Schreckenszenarien, die im Frühjahr die Entscheidung über den Lockdown maßgeblich beeinflussten (dazu näher unter V.1.), beruhten auch auf falschen Annahmen zur Letalität des Virus (sog. infection fatality rate = IFR) und zur Frage einer bereits vorhandenen bzw. fehlenden Grundimmunität gegen das Virus in der Bevölkerung. Die Kontagiosität wurde dagegen von Anfang nicht als dramatisch höher beurteilt als bei einem Influenzavirus (das Robert Koch-Institut gibt die Basisreproduktionszahl R0 von SARS-CoV-2 mit 3,3 - 3,8 an, bei Influenza liegt sie nach den meisten Angaben bei 1 - 3, bei Masern bei 12 - 18). Die Letalität beträgt nach einer Metastudie des Medizinwissenschaftlers und Statistikers John Ioannidis, eines der meistzitierten Wissenschaftler weltweit, die im Oktober in einem Bulletin der WHO veröffentlicht wurde, im Median 0,27%, korrigiert 0,23% und liegt damit nicht höher als bei mittelschweren Influenzaepidemien (https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf). Der Altersmedian der an oder mit SARS-CoV-2 Verstorbenen beträgt in Deutschland 84 Jahre (vgl. Situationsbericht des RKI vom 05.01.2021, S. 8). Und entgegen den ursprünglichen Annahmen, die von einer fehlenden Immunität gegen das „neuartige“ Virus ausgingen, weshalb zum Erreichen einer Herdenimmunität 60-70% Bevölkerung infiziert werden müssten, gibt es bei bis zu 50% der Bevölkerung, die nicht SARS-CoV-2 exponiert waren, bereits eine Grundimmunität durch kreuzreaktive T-Zellen, die durch Infektionen mit früheren Corona-Viren entstanden sind (Doshi, Covid-19: Do many people have pre-existing immun…, https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563, dazu auch: SARS-CoV-2: Ist die Grundimmunität größer als angenom…, DAZ.online vom 14.10.2020, https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/10/14/sars-cov-2-ist-die-grundimmunitaet-hoeher-als-angenommen). 20Da nach allem keine Situation bestand, die ohne einschneidende Maßnahmen zu „unvertretbaren Schutzlücken“ geführt hätte, sind § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO auch wenn man der Rechtsauffassung folgt, dass in einer solchen Situation ein Rückgriff auf Generalklauseln verfassungsgemäß ist, wegen Verstoßes gegen die Anforderungen der Wesentlichkeitslehre verfassungswidrig. IV. Das allgemeine Kontaktverbot bzw. das Ansammlungsverbot gem. § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO ist aus materiellen Gründen verfassungswidrig, weil es die in GG Art. 1 Abs. 1 als unantastbar garantierte Menschenwürde verletzt. 22Unantastbarkeit der Menschenwürde heißt, dass eine Verletzung der Menschenwürde nicht mit anderen Grundwerten der Verfassung gerechtfertigt werden kann; der Achtungsanspruch der Menschenwürde ist kategorisch. Dies bedeutet aber nicht, dass der Inhalt dieses Achtungsanspruchs, das, was der Würde des Einzelnen geschuldet ist, unabhängig von der konkreten Situation bestimmt werden könnte. Insbesondere die Rücksicht auf Würde und Leben anderer prägt den Inhalt des Achtungsanspruchs mit (Maunz/Dürig/Herdegen, GG, Art. 1 Abs. 1 Rn. 46.) So kann z. B. physischer Zwang oder Freiheitsentzug in bestimmten Situationen die Würde des Betroffenen verletzen, in anderen dagegen nicht. In den Worten des Bundesverfassungsgerichts: „Was den Grundsatz der Unantastbarkeit der Menschenwürde angeht, so hängt alles von der Festlegung ab, unter welchen Umständen sie verletzt sein kann. Dies lässt sich nicht generell sagen, sondern immer nur in Ansehung des konkreten Falls.“ (BVerfG NJW 1993, 3315). Unbestritten bleibt dabei, dass es einzelne Handlungen gibt, die unabhängig von dem mit ihnen verfolgten Zweck (Finalität) eine Würdeverletzung darstellen. Dazu zählen Folter, Genozid oder Massenvertreibung. Daneben gibt es bestimmte Handlungen, die allein aufgrund ihrer Finalität würdeverletzend sind, als Beispiel ist hier die rassistische Diskriminierung zu nennen (Herdegen, aaO, Rn. 47). Abgesehen von diesen Fällen kommt es aber immer auf eine wertende Gesamtwürdigung an. Für diese wird von der Rechtsprechung häufig die sog. Objektformel herangezogen, nach der die Menschenwürde betroffen ist, wenn der konkrete Mensch zum bloßen Objekt herabgewürdigt wird. Diese Formel ist aber insofern nur begrenzt operationalisierbar, als sie nicht frei von tautologischen Elementen ist. Sie kann daher nur die Richtung weisen, in der Fälle der Verletzung der Menschenwürde gefunden werden können (BVerfG 30, 1 (25)). Richtungsweisend in diesem Sinne erscheint auch ein Ansatz, der den Menschenwürdesatz als Schutz vor Tabuverletzungen begreift (Sachs/Höfling, GG Art. 1 Rn. 18). Auf den vorliegenden Fall bezogen ergibt sich daraus folgendes: Bei einem allgemeinen Kontaktverbot handelt es sich um einen schweren Eingriff in die Bürgerrechte. Es gehört zu den grundlegenden Freiheiten des Menschen in einer freien Gesellschaft, dass er selbst bestimmen kann, mit welchen Menschen (deren Bereitschaft vorausgesetzt) und unter welchen Umständen er in Kontakt tritt. Die freie Begegnung der Menschen untereinander zu den unterschiedlichsten Zwecken ist zugleich die elementare Basis der Gesellschaft. Der Staat hat sich hier grundsätzlich jedes zielgerichteten regulierenden und beschränkenden Eingreifens zu enthalten. Die Frage, wie viele Menschen ein Bürger zu sich nach Hause einlädt oder mit wie vielen Menschen eine Bürgerin sich im öffentlichen Raum trifft, um spazieren zu gehen, Sport zu treiben, einzukaufen oder auf einer Parkbank zu sitzen, hat den Staat grundsätzlich nicht zu interessieren. Mit dem Kontaktverbot greift der Staat - wenn auch in guter Absicht - die Grundlagen der Gesellschaft an, indem er physische Distanz zwischen den Bürgerinnen und Bürgern erzwingt („social distancing“). Kaum jemand konnte sich noch im Januar 2020 in Deutschland vorstellen, dass es ihm durch den Staat unter Androhung eines Bußgeldes untersagt werden könnte, seine Eltern zu sich nach Hause einzuladen, sofern er nicht für die Zeit ihrer Anwesenheit die übrigen Mitglieder seiner Familie aus dem Haus schickt. Kaum jemand konnte sich vorstellen, dass es drei Freunden verboten sein könnte, zusammen auf einer Parkbank zu sitzen. Noch nie zuvor ist der Staat auf den Gedanken verfallen, zu solchen Maßnahmen zur Bekämpfung einer Epidemie zu greifen. Selbst in der Risikoanalyse „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ (BT-Drs. 17/12051), die immerhin ein Szenario mit 7,5 Millionen Toten beschrieb, wird ein allgemeines Kontaktverbot (ebenso wie Ausgangssperren und die weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens) nicht in Erwägung gezogen. Als antiepidemische Maßnahmen werden neben Quarantäne von Kontaktpersonen Infizierter und Absonderung von Infizierten nur Schulschließungen, die Absage von Großveranstaltungen und Hygieneempfehlungen genannt (BT-Drs. 17/12051, S. 61f). Wenngleich es scheint, dass es in den Monaten der Corona-Krise zu einer Werteverschiebung mit der Folge gekommen ist, dass zuvor als absolut exzeptionell betrachtete Vorgänge inzwischen von vielen Menschen als mehr oder weniger „normal“ empfunden werden, was selbstverständlich auch den Blick auf das Grundgesetz verändert, sollte nach dem Gesagten an sich kein Zweifel daran bestehen, dass mit einem allgemeinen Kontaktverbot der demokratische Rechtsstaat ein - bisher als vollkommen selbstverständlich angesehenes - Tabu verletzt. Hinzu kommt und als gesondert zu würdigender Aspekt ist zu beachten, dass der Staat mit dem allgemeinen Kontaktverbot zum Zwecke des Infektionsschutzes jeden Bürger als potentiellen Gefährder der Gesundheit Dritter behandelt. Wird jeder Bürger als Gefährder betrachtet, vor dem andere geschützt werden müssen, wird ihm zugleich die Möglichkeit genommen, zu entscheiden, welchen Risiken er sich selbst aussetzt, was eine grundlegende Freiheit darstellt. Ob die Bürgerin abends ein Café oder eine Bar besucht und um der Geselligkeit und Lebensfreude willen das Risiko einer Infektion mit einem Atemwegsvirus in Kauf nimmt oder ob sie vorsichtiger ist, weil sie ein geschwächtes Immunsystem hat und deshalb lieber zu Hause bleibt, ist ihr unter der Geltung eines allgemeinen Kontaktverbotes nicht mehr zur Entscheidung überlassen. Das freie Subjekt, das selbst Verantwortung für seine und die Gesundheit seiner Mitmenschen übernimmt, ist insoweit suspendiert. Alle Bürger werden vom Staat als potentielle Gefahrenquellen für andere und damit als Objekte betrachtet, die mit staatlichem Zwang „auf Abstand“ gebracht werden müssen. Mit der Feststellung, dass mit dem allgemeinen Kontaktverbot ein Tabu verletzt und der Bürger als Objekt behandelt wird, ist allerdings noch nicht entschieden, ob damit die Menschenwürde verletzt ist. Im Rahmen der wertenden Gesamtwürdigung ist die Frage zu beantworten, ob grundsätzlich Umstände denkbar wären, unter denen ein allgemeines Kontaktverbot dennoch als mit der Würde der Menschen vereinbar angesehen werden könnte. Da eine Tabuverletzung im Bereich grundrechtseingreifenden Handeln des Staates allenfalls zur Abwendung einer ganz außergewöhnlichen Notlage hinnehmbar erscheint, wäre dies nur bei einem allgemeinen Gesundheitsnotstand - einem drohenden flächendeckenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems durch Überlastung bzw. der Drohung von Todesfällen in vollkommen anderen Dimensionen als bei den regelmäßig vorkommenden Grippewellen - und auch nur dann gegeben, sofern von dem tabuverletzenden Grundrechtseingriff ein substantieller Beitrag zur Abwendung oder Begrenzung des Notstandes zu erwarten wäre. Beides war nicht der Fall. Dass im Frühjahr kein allgemeiner Gesundheitsnotstand in Deutschland bestand, wurde bereits gezeigt. Dass von einem allgemeinen Kontaktverbot kein substantieller Beitrag zur positiven Beeinflussung einer Epidemie zu erwarten ist, wird unter V. noch näher ausgeführt. Unter den tatsächlich gegebenen Umständen verletzt der Staat danach mit einem allgemeinen Kontaktverbot den mit der Menschenwürde bezeichneten Achtungsanspruch der Bürger. V. Soweit der Auffassung, dass die hier zur Rede stehenden Normen die Menschenwürde verletzen, nicht gefolgt wird, genügen die Normen jedenfalls nicht dem Verhältnismäßigkeitsgebot. Mit dem allgemeinen Kontaktverbot und dem Verbot von Ansammlungen wird in die allgemeine Handlungsfähigkeit gem. GG Art. 2 Abs. 1 und in Spezialgrundrechte eingegriffen. Die Prüfung kann hier auf die Frage der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die allgemeine Handlungsfreiheit beschränkt werden, da bei Verneinung der Verhältnismäßigkeit dieses Eingriffs auch die Eingriffe in die Spezialgrundrechte (soweit die Eingriffe nicht über den Regelungsinhalt des Kontaktverbotes hinausgehen) unverhältnismäßig sind. 1. Verhältnismäßigkeit setzt voraus, dass mit einem Grundrechtseingriff ein legitimes Ziel verfolgt wird, der Eingriff geeignet ist, die Zielerreichung zu fördern, der Eingriff erforderlich ist, weil es kein milderes Mittel gibt, das in gleicher Weise geeignet ist, und er schließlich auch angemessen, d.h. verhältnismäßig im engeren Sinne ist. Als Ziel des Lockdowns wurde anfangs ausschließlich die Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems bezeichnet. In dem Lockdown-Beschluss vom 22.03.2020 gaben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder als Ziel an: „Wir müssen alles dafür tun, um einen unkontrollierten Anstieg der Fallzahlen zu verhindern und unser Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten. Dafür ist die Reduzierung von Kontakten entscheidend.“ (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-vom-22-03-2020-1733248). Um eine Überlastung des Gesundheitssystems durch einen unkontrollierten Anstieg der Patientenzahlen zu verhindern, sollte der Anstieg der Neuinfektionen gebremst werden, um die erwartete Zahl an Intensivpatienten auf einen längeren Zeitraum zu verteilen („flatten the curve“). Dies war auch das maßgebliche Ziel der Thüringer Landesregierung seit dem Erlass der Thüringer Corona-EindämmungsVO vom 24.03.2020 und auch der 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO vom 18.04.2020, der eine erneute Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder am 15.04.2020 vorausging, bei der beschlossen wurde, den Lockdown zu verlängern. Da die Ausbreitung des Virus als unvermeidlich angesehen wurde, ging es anfangs dagegen nicht darum, die Zahl der Infektionen so gering wie möglich zu halten. Erst nachdem unübersehbar wurde, dass es zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems kommen würde, wurde als Ziel der Maßnahmen zunehmend die bloße Minimierung der Infektionszahlen genannt. Zum Verständnis des Hintergrundes des Lockdown-Beschlusses ist ein im März verfasstes Strategiepapier des Bundesinnenministeriums mit dem Titel „Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen“ von Bedeutung (das als Verschlusssache deklarierte Papier ist inzwischen auf der Webseite des Bundesinnenministeriums öffentlich zugänglich https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid19.html). In diesem Papier wurden in einem Worst-Case-Szenario über eine Million Tote allein in Deutschland bis Ende Mai 2020 prognostiziert. Der Bedarf an Intensivbetten sollte in dem Szenario etwa am 09.04.2020 erstmals die Zahl der verfügbaren Betten übersteigen. Die Pandemie wurde als „größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriege“ bezeichnet - genau diese Worte verwendete auch die Bundeskanzlerin in ihrer Fernsehansprache vom 18.03.2020, was dafür spricht, dass die Prognosen aus dem Strategiepapier bei der Entscheidung über den Lockdown eine maßgebliche Rolle spielten. Allerdings gab es auch im März schon gegenteilige Äußerungen renommierter Wissenschaftler wie die von John Ioannidis, der in einem Artikel vom 17.03.2020 darauf hinwies, dass die bisher verfügbaren Daten solche Szenarien nicht stützen könnten (A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, StatNews 17.03.2020, https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/). Bei beiden Zielen - Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems und Minimierung der Infektionen - handelt es sich grundsätzlich um legitime Ziele des Verordnungsgebers, die Verhältnismäßigkeitsprüfung muss aber für jedes Ziel gesondert erfolgen. Dabei ist eine von den übrigen Lockdown-Maßnahmen isolierte Betrachtung des hier zu beurteilenden allgemeinen Kontaktverbotes kaum möglich, aber auch nicht erforderlich, da die Reduzierung von Kontakten die grundlegende Logik des Lockdowns darstellt. Mit einem allgemeinen Kontaktverbot müssen zwangsläufig weitere Maßnahmen wie die Schließung von Einrichtungen einhergehen, da ein allgemeines Kontaktverbot im öffentlichen und privaten Raum bei gleichzeitiger uneingeschränkter Begegnungsmöglichkeit in Kino, Theater, Konzert, in Sporteinrichtungen, in der Gastronomie etc. weitgehend leerliefe. 2. Da es für die Geeignetheit einer Maßnahme im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung als ausreichend angesehen wird, wenn sie die Zielerreichung in irgendeiner Weise fördert, kann das allgemeine Kontaktverbot als geeignet hinsichtlich beider Ziele angesehen werden, da unbestreitbar die Reduktion von Kontakten grundsätzlich zur Reduktion von Infektionen beitragen kann (Die Frage der Wirksamkeit von Lockdowns ist damit allerdings noch nicht entschieden.). 3. Um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, waren allerdings zum Zeitpunkt des Erlasses der 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO, wie bereits unter III. 3. gezeigt, die Verhängung eines allgemeinen Kontaktverbotes und auch sonstige Lockdown-Maßnahmen nicht erforderlich. Da aber dem Verordnungsgeber ein Einschätzungsspielraum einzuräumen ist, stellt sich die Frage, ob die Landesregierung zum Zeitpunkt des Verordnungserlasses im Rahmen ihres Einschätzungsspielraumes zu einer anderen als der hier dargelegten Situationsbewertung kommen und die Anordnung eines Kontaktverbotes (und anderer Maßnahmen) zur Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems für erforderlich halten durfte. Dazu ist festzuhalten, dass von dem Verordnungsgeber erwartet werden muss, dass er in Vorbereitung seiner Entscheidungen die ihm zur Verfügung stehenden und durch ihn auswertbaren Erkenntnisquellen nutzt und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse in den Entscheidungsprozess einfließen lässt. Einschätzungsspielraum heißt nicht, dass es dem Verordnungsgeber gestattet wäre, bei widerstreitenden Ansichten und Bewertungen sich ohne Ausschöpfung der eigenen Erkenntnismöglichkeiten „auf eine Seite zu schlagen“. Es heißt auch nicht, dass er sich unter Verweis darauf, dass dem Robert Koch-Institut nach IFGS § 4 vom Bundesgesetzgeber eine zentrale Stellung bei der Einschätzung des Infektionsgeschehens zuerkannt worden ist, auf die in den Täglichen Situationsberichten enthaltene zusammenfassende Risikobewertung zurückziehen und allein wegen einer Risikoeinschätzung für die Gesundheit der Bevölkerung als „hoch“ bzw. „sehr hoch“ einschneidende Maßnahmen für gerechtfertigt halten dürfte. Der Verordnungsgeber trägt die volle Verantwortung für die Verfassungsmäßigkeit der von ihm erlassenen Verordnung und kann diese auch nicht teilweise an das Robert Koch-Institut delegieren. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, muss er sich - soweit nötig, selbstverständlich unter Zuhilfenahme sachkundiger Expertise und Beratung - eigene Sachkunde verschaffen, was vorliegend heißt, dass er sich mit den vom Robert Koch-Institut bereitgestellten Daten und mit Daten aus anderen, ihm zugänglichen Quellen selbst auseinandersetzen muss. Unter Beachtung dieser Anforderungen ist die Frage, ob der Verordnungsgeber die Verlängerung des Lockdowns als erforderlich zur Abwendung einer Überlastung des Gesundheitssystems erachten durfte, eindeutig mit „Nein“ zu beantworten. Dem Verordnungsgeber standen die Daten des Intensivregisters zur Verfügung; unabhängig davon war ihm eine Abfrage der Situation in den Thüringer Kliniken ohne weiteres möglich und wurde sehr wahrscheinlich auch durchgeführt. Auch die oben bereits erläuterten Daten aus den Täglichen Situationsberichten und dem Epidemiologischen Bulletin 17/2020 des Robert Koch-Instituts standen dem Verordnungsgeber zur Verfügung. Die Grafik über den Verlauf der Neuerkrankungen wurde erstmals im Situationsbericht vom 15.04.2020 veröffentlicht, konnte daher vom Verordnungsgeber berücksichtigt werden. Davor hatte das Robert Koch-Institut bereits wochenlang eine Grafik zum Verlauf der Neuerkrankungen veröffentlicht, die zwar weniger genau war, weil in ihr bei den Fällen, bei denen der Erkrankungsbeginn nicht bekannt war, keine Schätzung des Erkrankungsbeginns vorgenommen, sondern ersatzweise das Meldedatum verwendet wurde (z. B. Täglicher Situationsbericht vom 01.04.2020, S. 4, Abb. 3), aber auch dieser Grafik war zu entnehmen, dass der Höhepunkt der Neuerkrankungen bereits Mitte März erreicht war. Die am 15.04.2020 veröffentlichte Grafik kam daher keinesfalls überraschend, sondern entsprach ziemlich genau dem, was bereits wochenlang in den Situationsberichten zum Verlauf der Neuerkrankungen veröffentlicht wurde. Der Verordnungsgeber konnte danach wissen, dass die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland bereits seit Mitte März sank. Es gab danach für ihn keinen Grund für die Annahme, es könnte doch noch eine Welle von COVID-19-Patienten auf die Thüringer Kliniken zukommen. Dafür hätte es eine Trendumkehr geben müssen, für die es keinerlei Anhaltspunkte gab. Der Verordnungsgeber konnte aus den Daten des Robert Koch-Instituts auch erkennen, dass es keine Hinweise auf die Wirksamkeit des am 22. März beschlossenen Lockdowns gab, so dass für den Fall der Aufhebung des Lockdowns auch nicht mit einem erneuten Anstieg der Infektionen zu rechnen war. Schließlich war für den Verordnungsgeber auch ohne weiteres erkennbar, dass selbst für den Fall eines - entgegen den sich aus dem bisherigen Verlauf der Epidemie ergebenden Erwartungen - erneuten Anstieges der Neuinfektionen aufgrund der enormen Zahl freier Betten (528 freie Intensivbetten bei 56 COVID-19-Patienten am 16. April) noch ausreichend Zeit bliebe, um auf die veränderte Situation zu reagieren. Es gab also auch bei einem ungeachtet der klaren Datenlage verbliebenen Misstrauen hinsichtlich der Stabilität der Entwicklung keinen Grund für eine vorsorgliche Verlängerung des Lockdowns. Und nicht zuletzt hätte es der Landesregierung zu denken geben und das Vertrauen in die eigene Bewertung der Situation stärken müssen, dass sich Schreckensszenarien wie die aus dem Strategiepapier des Bundesinnenministeriums vom März ganz offensichtlich als science fiction erwiesen hatten. 4. Soweit die Minimierung der Infektionen als eigenständiges Ziel, unabhängig von der Frage, ob eine Überlastung des Gesundheitssystems drohte, verfolgt wurde, ist das Kontaktverbot in Bezug auf dieses Ziel als erforderlich anzusehen, da ohne ein Kontaktverbot die Erreichung des Ziels nicht in gleicher Weise gefördert werden konnte. Es ist aber nicht verhältnismäßig im engeren Sinne. a. Für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne sind der Nutzen der Maßnahmen und die Kosten, die sich aus den Freiheitseinschränkungen und ihren Kollateralschäden und Folgekosten zusammensetzen, gegeneinander abzuwägen. Dafür müssen die Vorteile und die Nachteile beschrieben, gewichtet und bewertet werden (Murswiek, Verfassungsrechtliche Probleme der Corona-Bekämpfung. Stellungnahme für die Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ des Landtags Rheinland-Pfalz, S. 24, https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2-12-17.pdf). b. Als Nutzen des Lockdowns wäre die Zahl der verhinderten COVID-19-Todesfälle und schweren Erkrankungen anzusehen, wobei, präzise formuliert, nach dem Nutzen zu fragen ist, den der Verordnungsgeber zum Zeitpunkt des Verordnungserlasses am 18.04.2020 unter Berücksichtigung seines Einschätzungsspielraumes berechtigterweise erwarten durfte. Hierzu ist erneut darauf zu verweisen, dass der Verordnungsgeber wissen musste, dass die Zahl der Neuinfektionen bereits seit Mitte März sank, dass die effektive Reproduktionszahl seit Beginn des Lockdowns am 23.03.2020 um den Wert 1 schwankte und ein positiver Effekt des bereits dreieinhalb Wochen andauernden Lockdowns nicht erkennbar war. Auch die Grafik betreffend den Verlauf der Neuerkrankungen zeigte eine nahezu gleichmäßig abfallende Kurve ohne erkennbare Stufung, so dass auch an ihr ein Effekt des Lockdowns nicht ablesbar war. Dafür, dass die Zahl der Neuerkrankungen durch die Verlängerung des Lockdowns mit der Verordnung vom 18.04.2020 signifikant beeinflusst werden könnte, gaben die Daten des Robert Koch-Instituts keinerlei Anhaltspunkte. Der Verordnungsgeber konnte somit allenfalls eine sehr geringfügige Reduzierung der Zahl der Neuerkrankungen (und damit der Todesfälle) erwarten. Tatsächlich zeigte die Fortschreibung der Kurve der Neuerkrankungen in den Täglichen Situationsberichten dann auch nach dem 18.04.2020 keinen erkennbaren Effekt der Verlängerung des Lockdowns. Dass der Lockdown seit dem 23. März keinen messbaren Effekt hatte, ist auch insofern nicht überraschend, als die WHO erst in einer im Oktober 2019 veröffentlichten Metastudie zur Wirksamkeit von sog. nicht-pharmazeutischen Interventionen (non-pharmaceutical interventions = NPI) bei Influenzaepidemien zu dem Ergebnis kam, dass es für die Wirksamkeit sämtlicher untersuchter Maßnahmen (Arbeitsstättenschließungen, Quarantäne, social distancing u.d.) nur geringe oder gar keine Evidenz gebe (Nonpharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza, https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/). Ob diese Studie von der Bundesregierung oder der Landesregierung vor der Entscheidung über den Lockdown zur Kenntnis genommen wurde, ist dem Gericht nicht bekannt, angesichts der Folgenschwere der Entscheidung konnte aber erwartet werden, dass die verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Lockdowns bzw. NPIs ausgewertet werden. Inzwischen gibt es mehrere wissenschaftliche Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass die in der Corona-Pandemie in verschiedenen Ländern angeordneten Lockdowns nicht mit einer signifikanten Verringerung von Erkrankungs- und Todeszahlen verbunden waren. Eine im August in der Fachzeitschrift EClinicalMedicine veröffentlichte Beobachtungsstudie (Chaudhry, A country level analysis measuring the impact of government actions, country preparedness and socioeconomic factors on COVID-19 mortality and related health outcomes, https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-5370%2820%2930208-X), in der die 50 Länder mit den meisten registrierten Fällen von COVID-19 zum Stichtag 01.04.2020 untersucht und Daten aus öffentlich zugänglichen Zahlen für den Zeitraum 01.04. bis 01.05.2020 ausgewertet wurden, kam zu dem Ergebnis, dass die Faktoren, die am stärksten mit der Zahl der COVID-19-Todesfälle in einem Land korrelieren, die Adipositasrate, das Durchschnittsalter der Bevölkerung und das Ausmaß der Einkommensunterschiede sind. Zwischen der Schwere und Dauer der Lockdowns und der Zahl der COVID-19-Todesfälle, zwischen Grenzschließungen und COVID-19-Todesfällen und zwischen durchgeführten Massentests und COVID-19-Todesfällen konnte dagegen keine Korrelation festgestellt werden, was für fehlende oder jedenfalls nur schwache Kausalität spricht. Diese Ergebnisse wurden durch eine im November veröffentlichte Studie (De Larochelambert, Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full), in welcher für 160 Länder der Einfluss verschiedenster Faktoren auf die Anzahl der COVID-19-Todesfälle untersucht wurde, und zuletzt durch eine Studie von Bendavid/Ioannidis bestätigt (Bendavid/Ioannidis, Assessing mandatory stay-at-home and business closure effects on the spread of COVID-19, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13484; Hinweise auf weitere Studien bei Kuhbandner, Warum die Wirksamkeit des Lockdowns wissenschaftlich nicht bewiesen ist). Auch der im November zunächst nur für einen Monat (“Wellenbrecherlockdown“) angeordnete und inzwischen zweimal verlängerte Lockdown erbringt offensichtlich noch einmal den Beweis, dass sich mit Lockdowns das Infektionsgeschehen und insbesondere die Zahl der tödlich verlaufenden Fälle nicht signifikant beeinflussen lässt. Nach dem aktuellen Thesenpapier der Autorengruppe um Schrappe (Thesenpapier 7 vom 10.01.2021, S. 5, 24f, http://www.matthias.schrappe.com/index_htm_files/Thesenpap7_210110_endfass.pdf) ist die Lockdown-Politik gerade für die vulnerablen Gruppen, für die COVID-19 die größte Gefahr darstellt, wirkungslos. Zu demselben Ergebnis kommt auch der bereits erwähnte CoDAG-Bericht Nr. 4 des Instituts für Statistik der LMU München. c. Hinsichtlich der Kosten des Lockdowns ist zunächst erneut festzuhalten, dass es sich bei den mit dem Lockdown verbundenen Freiheitseinschränkungen um die umfassendsten und weitreichendsten Grundrechtseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik handelte. Schon daraus ergibt sich, dass die Freiheitseinschränkungen ein so großes Gewicht haben, dass sie allenfalls dann gerechtfertigt sein können, wenn die Gefahr, deren Bekämpfung sie dienten, ganz außergewöhnlich groß war (Murswiek, aaO, S. 33) und durch die Maßnahmen des Lockdowns zugleich ein großer positiver Effekt erwartet werden konnte, was aber nach dem Gesagten nicht der Fall war. Zu der unmittelbaren Wirkung der Freiheitseinschränkungen kommen die Kollateralschäden und Folgeschäden hinzu. Diese lassen sich (vgl. Murswiek, aaO, S. 33-38) wie folgt differenzieren: aa) Ökonomisch bewertbare Schäden (1) Gewinneinbußen/Verluste von Unternehmen/Handwerkern/Freiberuflern, die unmittelbare Folgen der an sie adressierten Freiheitseinschränkungen sind (2) Gewinneinbußen/Verluste von Unternehmen/Handwerkern/Freiberuflern, die mittelbare Folgen der Lockdown-Maßnahmen sind (z.B. Gewinneinbußen von Zulieferern von unmittelbar betroffenen Unternehmen; Gewinneinbußen, die aus der Unterbrechung von Lieferketten resultieren und z.B. zu Produktionsausfällen führten; Gewinneinbußen, die aus Reisebeschränkungen resultierten) (3) Lohn- und Gehaltseinbußen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit (4) Konkurse/Existenzvernichtungen (5) Folgekosten von Konkursen/Existenzvernichtungen Dazu mit Murswiek (aaO, S. 33f): „Die meisten dieser Schäden werden sich ziemlich genau ermitteln lassen. Sie sind insgesamt mit Sicherheit gigantisch. Eine Vorstellung von ihrer Größenordnung erhält man, wenn man sich vor Augen hält, welche Summen der Staat als Corona-Hilfen in den Wirtschaftskreislauf einspeist. So umfasst der von der Bundesregierung beschlossene „Corona-Schutzschild“ 353,3 Mrd. Euro Zuschüsse und zusätzlich 819,7 Mrd. Euro Garantien, also insgesamt über 1 Billion Euro. Es handelt sich, wie die Bundesregierung sagt, um das größte Hilfspaket in der Geschichte Deutschlands. Hinzu kommen Hilfen der Länder. Da die staatlichen Hilfen großenteils Kredite beziehungsweise Kreditgarantien umfassen, stehen ihnen nicht notwendigerweise entsprechend hohe Verluste der privaten Wirtschaft gegenüber. Andererseits werden die privaten Verluste jedenfalls wesentlich größer sein als die staatlichen Entschädigungen oder als verlorene Zuschüsse gezahlten Hilfsgelder. Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands sind wirtschaftliche Schäden in dieser Größenordnung durch eine staatliche Entscheidung verursacht worden. Was die Bewertung der Schäden der Privatwirtschaft und der privaten Haushalte angeht, so muss berücksichtigt werden, dass die Einbußen zum Teil durch staatliche Leistungen kompensiert worden sind oder noch kompensiert werden. Die staatlichen Leistungen vermindern also den ökonomischen Schaden der privaten Wirtschaftssubjekte. Sie vermindern aber nicht den volkswirtschaftlichen Gesamtschaden, denn sie belasten ja die öffentlichen Haushalte und somit letztlich die Steuerzahler. Diese Kosten dürfen bei der Berechnung der Nachteile des Lockdown nicht unter den Tisch fallen.“ bb) Leben und Gesundheit der Menschen in Deutschland (1) die Zunahme häuslicher Gewalt gegen Kinder und Frauen (2) Zunahme von Depressionen infolge sozialer Isolation (3) Angst-Psychosen/Angst-Störungen infolge Corona-Angst (4) andere psychische Störungen/nervliche Überlastung wegen familiärer/persönlicher/beruflicher Probleme infolge des Lockdown 65) Zunahme von Suiziden, beispielsweise infolge von Arbeitslosigkeit oder Insolvenz(6) gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge von Bewegungsmangel (7) Unterlassung von Operationen und stationären Behandlungen, weil Krankenhausbetten für Coronapatienten reserviert wurden (8) Unterlassung von Operationen, stationären Behandlungen, Arztbesuchen, weil Patienten Infizierung mit Covid-19 befürchten Diese Folgen hätten vor der Entscheidung über den Lockdown jedenfalls grob abgeschätzt werden müssen. Für die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist es vorliegend ausreichend, wenn zur Erläuterung einzelne Schlaglichter geworfen werden: Zu (1): Für Berlin wurde durch die Senatsverwaltung für das erste Halbjahr 2020 ein Anstieg der Kindesmisshandlungen um 23% berichtet (Gewalt eskaliert in Berlin immer häufiger. Der Tagesspiegel vom 02.07.2020, https://www.tagesspiegel.de/berlin/corona-krise-trifft-frauen-und-kinder-besonders-gewalt-eskaliert-in-berlin-immer-haeufiger/25970410.html). Laut einer repräsentativen Befragungstudie (Steinert/Ebert, Gewalt an Frauen und Kindern in Deutschland während COVID-19-bedingten Ausgangsbeschränkungen, https://drive.google.com/file/d/19Wqpby9nwMNjdgO4_FCqqlfYyLJmBn7y/view) wurden in der Zeit des Lockdowns im Frühjahr rund 3 Prozent der Frauen in Deutschland zu Hause Opfer körperlicher Gewalt, 3,6 Prozent wurden von ihrem Partner vergewaltigt, in 6,5 Prozent aller Haushalte wurden Kinder gewalttätig bestraft. Zu (5): Die Zahl der Suizide, die in Deutschland statistisch erfasst wird, liegt für das Jahr 2020 zwar noch nicht vor, einen Hinweis auf einen möglicherweise erheblichen Anstieg der Suizide gibt aber folgende Mitteilung der Senatsinnenverwaltung Berlin: Bis Oktober gab es bei der Berliner Feuerwehr unter dem Stichwort „Beinahe Strangulierung/ Erhängen, jetzt wach mit Atembeschwerden“ (Einsatzcode 25D03) 294 Einsätze, im Jahr 2018 gab es dagegen nur sieben und im Jahr 2019 nur drei solcher Einsätze (Möglicher Suizid: Zahl der Rettungseinsätze steigt massiv an. Berliner Zeitung vom 10.11.2020, htttps://www.berliner-zeitung.de/news/berliner-feuerwehr-zahl-der-einsaetze-wegen-moeglichem-suiziden-steigt-massiv-an-li.117723) Zu (7): Während des Lockdowns im Frühjahr wurden in Deutschland mehr als 908.000 Operationen abgesagt, und zwar nicht nur sog. elektive Operationen wie die Implantation von Kniegelenks- und Hüftgelenksendoprothesen, Kniegelenksarthroskopien, Katarakt-Operationen u.ä., sondern auch 52.000 Krebs-Operationen (In Deutschland wurden fast eine Million Operationen abgesagt. WELT v. 29.05.2020, https://www.welt.de/wirtschaft/article208557665/Wegen-Corona-In-Deutschland-wurden-908-000-OPsaufgeschoben.html). Laut einer im British Medical Journal im November veröffentlichten Meta-Analyse (Hanna, Mortality due to cancer treatment delay: systematic review and meta-analysis, BMJ 2020, 371, https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4087) erhöht bereits eine vierwöchige Verschiebung einer Krebstherapie das Sterberisiko je nach Krebsart um sechs bis 13 Prozent, ein Aufschub von acht Wochen bei Brustkrebs das Sterberisiko um 13 Prozent, ein Aufschub um zwölf Wochen um 26 Prozent. Ohne dies hier näher beziffern zu können, kann danach kein Zweifel daran bestehen, dass die Absage von Operationen auch in Deutschland zu Todesfällen geführt hat. Zu (8): In einer Studie des Klinikums Hochrhein Waldshut-Tiengen (Kortüm, Corona-Independent Excess Mortality Due to Reduced Use of Emergency Medical Care in the Corona Pandemic: A Population-Based Observational Study, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.27.20220558v1) wurde die Übersterblichkeit im Landkreis Waldshut (170.000 Einwohner) im April 2020 untersucht. Dort starben im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 im April 165 Menschen, 2020 waren es 227, was einer Übersterblichkeit von 37 Prozent entspricht. Von den 62 zusätzlichen Todesfällen ließen sich aber nur 34 mit Corona in Verbindung bringen, 28 und damit 45% der Übersterblichkeit gingen auf andere Todesursachen zurück. Die Studienautoren führen diese Fälle auf die reduzierte Nutzung medizinischer Notfallstrukturen zurück, wofür auch spricht, dass mehr als doppelt so viele Menschen als im Vergleichsdurchschnitt tot alleine zu Hause aufgefunden wurden. Ähnliche Untersuchungen für andere Regionen Deutschlands fehlen. Kuhbandner hat aber mit einer Gegenüberstellung der Anzahl der Todesfälle in Deutschland im Zeitraum 1.-47. Kalenderwoche mit dem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 und der Anzahl der mit oder am SARS-CoV-2-Virus verstorbenen Personen gezeigt, dass nur 51,1% der Übersterblichkeit auf mit oder am SARS-CoV-2-Virus verstorbene Personen zurückgeht (Kuhbandner, Über die ignorierten Kollateralschäden von Lockdowns, https://www.heise.de/tp/features/Ueber-die-ignorierten-Kollateralschaeden-von-Lockdowns-4993947.html?seite=all). Dies bedeutet zwar nicht, dass sämtliche anderen Übersterblichkeitstodesfälle als Kollateralschäden des Lockdowns gewertet werden könnten, insbesondere die starke Übersterblichkeit in der 33. Kalenderwoche ist vermutlich auf eine Hitzewelle zurückzuführen. Dennoch geben diese Zahlen einen deutlichen Hinweis auf Todesfälle, die auf unterbliebene oder verspätete Inanspruchnahme medizinischer Versorgung aus Angst vor Corona-Infektionen zurückzuführen sind. cc) Ideelle Schäden (1) Bildungseinbußen und Beeinträchtigung der psychosozialen Entwicklung von Kindern durch Ausfall oder Einschränkungen des Schulunterrichts bzw. der Schließung anderer Bildungseinrichtungen (2) Verlust an kulturellen Anregungen/Erlebnissen durch Schließung von Theatern, Konzert- oder Opernhäusern und vielen anderen kulturellen Einrichtungen (3) Verlust musischer Entfaltungsmöglichkeiten durch Verbote, die gemeinsames Musizieren in Orchestern oder Chören unterbinden (4) Verlust von Gemeinschaftserlebnissen/persönlichem sozialem Miteinander durch Verbot von Zusammenkünften in Vereinen, Verbot von Veranstaltungen, Verbot von Ansammlungen, Schließung von Kneipen usw. (5) Einschränkung sozialer Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder durch Schließung von Kindergärten (6) Isolierung von Kindern in Wohnungen ohne Kontakte zu anderen Kindern durch Schließung von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen Zu (1) Die Schule ist nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung, sondern ein Ort sozialen Lernens. Durch die Schulschließungen entfällt das soziale Lernen praktisch vollständig, die Vereinzelung der Kinder und Jugendlichen wird gefördert. Homeschooling kann gerade von Eltern in migrantischen oder bildungsfernerem Milieu nicht geleistet werden. Die soziale Spaltung der Gesellschaft wird daher verstärkt. Auch das Erlernen der deutschen Sprache bei Kindern aus migrantischen Familien wird massiv gestört. Zu diesen Problemen gibt es inzwischen eine Vielzahl von Berichten aus der Praxis (exemplarisch: „Der Stand in Deutsch? Der ist bei einem Drittel der Schüler katastrophal“. WELT vom 11.01.2021, https://www.welt.de/politik/deutschland/plus224000152/Geschlossene-Schulen-Was-das-fuer-Kinder-in-sozialen-Brennpunktenbedeutet.html), wissenschaftliche Studien stehen - soweit ersichtlich - noch aus. dd) Folgekosten (1) von Bund und Ländern an die Wirtschaftssubjekte geleistete Corona-Hilfen (2) Steuerausfälle infolge der Einschränkung der Wirtschaftstätigkeit durch den Lockdown (3) Kurzarbeitergeld und Arbeitslosenhilfe, die infolge des Lockdown gezahlt werden mussten (4) Sozialhilfe für infolge des Lockdown auf Sozialhilfe angewiesene Menschen Allein der „Corona-Schutzschild“, ein am 27.03.2020 beschlossenes Gesetzespaket, hatte ein Volumen von 1,173 Billionen Euro (353,3 Mrd. Euro Hilfsleistungen, 819,7 Mrd. Euro Garantien. Die letzten Bundeshaushalte hatten ein Volumen von 356,4 Mrd. Euro (2019) und 346,6 Mrd. Euro (2018). Auch wenn die gegebenen Garantien nicht per se „verloren“ sind, dürften die Belastungen insgesamt die Höhe von mehreren Bundeshaushalten erreichen (Murswiek, aaO, S. 38). ee) gesundheitliche und ökonomische Schäden in Ländern des Globalen Südens Der Lockdown im Frühjahr in Thüringen war Teil eines aus 16 Lockdowns der Bundesländer zusammengesetzten, ganz Deutschland umfassenden Lockdowns, der wiederum im Zusammenhang mit der Lockdown-Politik in nahezu allen Ländern der westlichen Welt gesehen werden muss. Daher ist es berechtigt und notwendig, auch nach den Auswirkungen dieser Politik auf die Länder des Globalen Südens zu fragen. Die hier bereits eingetretenen bzw. noch zu erwartenden Kollateralschäden sind enorm. Gründe sind die Unterbrechung von Anti-Tuberkulose-Programmen, die Unterbrechung von Impfprogrammen gegen Kinderkrankheiten, Unterbrechungen in der Nahrungsmittelversorgung durch den Zusammenbruch von Lieferketten u.a.m. Die UN rechnet mit dem Hungertod von mehr als 10.000 Kindern pro Monat im ersten Pandemiejahr (Mehr als 10.000 Kinder verhungern wegen Corona jeden Monat, RP Online vom 28.07.2020, https://rp-online.de/panorama/coronavirus/mehr-als-10000-kinder-verhungern-jeden-monat-krise-durch-corona-verschaerft_aid-52446949). Allein in Afrika werden laut Bundesentwicklungsminister Müller zusätzlich 400.000 Opfer durch Malaria und HIV und eine halbe Million Tuberkulose-Tote als Folge des Lockdowns erwartet (Mehr Corona-Opfer durch Lockdown als durch das Virus: In Afrika wurden die Krisen massiv verschärft, Berliner Zeitung vom 01.10.2020, https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/mehr-tote-durch-lockdown-als-durch-corona-in-afrika-hat-die-pandemie-die-krisen-massiv-verschaerft-li.108228). Laut einem Artikel von John Ioannidis (Global perspective of COVID-19 epidemiology for a full-cycle pandemic, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13423) sollen in den nächsten 5 Jahren sogar 1,4 Millionen zusätzliche Tuberkulose-Tote zu befürchten sein. Langfristig werde die Übersterblichkeit durch die Maßnahmen wahrscheinlich deutlich größer als die Zahl der COVID-19-Toten sein. Da die Lockdown-Politik in Thüringen ein - wenn auch natürlich sehr kleiner - Teil einer nahezu alle westlichen Industrieländer betreffenden Lockdown-Politik ist, sind diese Schäden, soweit sie nicht aus von den betroffenen Staaten selbst zu verantwortenden politischen Entscheidungen resultieren, sondern indirekte Folge der Lockdowns in den Industrieländern sind, auch anteilig ihr zuzurechnen und deshalb grundsätzlich in die Verhältnismäßigkeitsprüfung mit einzustellen. d. Nach dem Gesagten kann kein Zweifel daran bestehen, dass allein die Zahl der Todesfälle, die auf die Maßnahmen der Lockdown-Politik zurückzuführen sind, die Zahl der durch den Lockdown verhinderten Todesfälle um ein Vielfaches übersteigt. Schon aus diesem Grund genügen die hier zu beurteilenden Normen nicht dem Verhältnismäßigkeitsgebot. Hinzu kommen die unmittelbaren und mittelbaren Freiheitseinschränkungen, die gigantischen finanziellen Schäden, die immensen gesundheitlichen und die ideellen Schäden. Das Wort „unverhältnismäßig“ ist dabei zu farblos, um die Dimensionen des Geschehens auch nur anzudeuten. Bei der von der Landesregierung im Frühjahr (und jetzt erneut) verfolgten Politik des Lockdowns, deren wesentlicher Bestandteil das allgemeine Kontaktverbot war (und ist), handelt es sich um eine katastrophale politische Fehlentscheidung mit dramatischen Konsequenzen für nahezu alle Lebensbereiche der Menschen, für die Gesellschaft, für den Staat und für die Länder des Globalen Südens. Löffler I www.K1.de I www.gesellschaftsrechtskanzlei.com I Gesellschaftsrecht I Corona I Zusammenkünfte I Versammlungsgesetz I Erfurt I Thüringen I Sachsen I Sachsen-Anhalt I Hessen I Deutschland 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiengesellschaft | Die Aktiengesellschaft kann Strukturvorteile für sich beanspruchen. Kleinteilige Stückelung des Grundkapitals in Aktien und erleichterte Übertragbarkeit der Aktien sind ebenso Vorteile der Aktiengesellschaft wie die mögliche Anonymisierung des Aktieninhabers. Der Aktionär verfolgt im Wesentlichen Anlageinteressen. Die Trennung von Gesellschafterstellung und Management in der Aktiengesellschaft ist deshalb nur konsequent. Der Vorstand leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung. Der Vorstand ist keinerlei Weisungen unterworfen und zwar weder seitens der Aktionäre, noch seitens des Aufsichtsrates. Die Aktiengesellschaft eignet sich deshalb auch für Konstellationen, in denen die Trennung von Gesellschafterstellung und Management von großer Bedeutung ist, z.B. für die Unternehmensnachfolge oder bei verschiedenen Gesellschafterstämmen. Die Aktiengesellschaft hat Imagevorteile. Der Aktiengesellschaft wird ein größeres wirtschaftliches Gewicht beigemessen. Die Aktiengesellschaft unterliegt einem strengen rechtlichen Rahmen und ist standardisiert. Dadurch und aufgrund der Existenz eines zwingenden Aufsichtsrates verbindet der Geschäftspartner eine größere Kontrolle des Managements und damit eine höhere Seriösität der Aktiengesellschaft. Ein Vorstand einer Aktiengesellschaft wird vom außenstehenden Dritten höher bewertet als der Geschäftsführer einer GmbH.Zum Aktienrecht erfahren Sie Weiteres systematisiert und unter Verweis auf die wesentlichen Gerichtsentscheidungen unter Grundlagen, ausgewählte Themen und Vorratsgesellschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktienrechtlichen Beschlussmängelklage und Insolvenz, Meldepflichten nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) | Urteil des BGH vom 19.07.2011, Az.: II ZR 246/09I.Der BGH hat mit dem Urteil vom 19.07.2011 Folgendes entschieden:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktienrechtlicher Differenzhaftungsanspruch: Voraussetzungen, Vergleich und Aufrechnungsvereinbarung über den Differenzhaftungsanspruch | Urteil des BGH vom 06.12.2011, II ZR 149/10I.Der BGH hat mit Urteil vom 06.12.2011 entschieden:
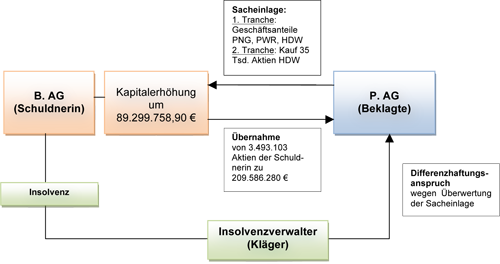 Mit der Klage begehrte der Kläger unter anderem Zahlung dieser 171.443.837 €. Das Landgericht Frankfurt am Main wies die Klage ab. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main als Berufungsgericht wies die Berufung des Klägers zurück. Die dagegen gerichtete Revision des Klägers hatte Erfolg. Der BGH hob das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main auf und verwies die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück.III.Der BGH gelangt zu seinem Ergebnis auf folgendem Weg:1.Keine Befreiung der Aktionäre von ihren Leistungspflichten (§ 66 Abs. 1 AktG)§ 66 Abs. 1 AktG besagt:„Die Aktionäre und ihre Vormänner können von ihren Leistungspflichten nach den §§ 54 und 65 nicht befreit werden. Gegen eine Forderung der Gesellschaft nach den §§ 54 und 65 ist die Aufrechnung nicht zulässig.“§ 54 Abs. 1 AktG besagt:„Die Verpflichtung der Aktionäre zur Leistung der Einlagen wird durch den Ausgabebetrag der Aktien begrenzt.“2.Der aktienrechtliche Differenzhaftungsanspruch fällt ebenfalls unter § 66 Abs. 1 AktG.2.1Geringster Ausgabebetrag (§ 9 Abs. 1 AktG)Nach dem BGH ist es allgemein anerkannt, dass der Aktionär bei einer Überbewertung von Sacheinlagen den Differenzbetrag zwischen dem Wert der Sacheinlage und dem geringsten Ausgabebetrag in Geld zu leisten hat. Dieser sog. „Differenzhaftungsanspruch“ wird aus § 36a Abs. 2 AktG in Verbindung mit §§ 183, 188 Abs. 2 Satz 1 AktG, aus der mit der Übernahme bzw. mit der Zeichnung zwangsläufig verbundenen Kapitaldeckungszusage, aus dem Verbot in § 9 Abs. 1 AktG, Aktien für einen geringeren Betrag als den Nennbetrag (oder den auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals) auszugeben sowie aus einer Analogie zu § 9 Abs. 1 GmbHG abgeleitet.2.2Aufgeld (§ 9 Abs. 2 AktG)Ein gesetzlicher Differenzhaftungsanspruch besteht nach dem BGH aber auch insoweit, als der Wert der Sacheinlage zwar den geringsten Ausgabebetrag nach § 9 Abs. 1 AktG, nicht aber auch das Aufgeld nach § 9 Abs. 2 AktG deckt. Das Aufgeld ist bei der Aktiengesellschaft (anders als bei der GmbH) Teil des Ausgabebetrags und der mitgliedschaftlichen Leistungspflicht der Aktionäre nach § 54 Abs. 1 AktG, von der sie nach § 66 Abs. 1 AktG grundsätzlich nicht befreit werden können. Nach dem BGH wäre eine andere Sicht insbesondere auch damit nicht vereinbar, dass eine Wertdeckung im Umfang des Aufgelds auch erforderlich ist, um eine Verwässerung der Anteile der - regelmäßig - von der Sachkapitalerhöhung ausgeschlossenen Aktionäre (§ 255 Abs. 2 AktG) zu verhindern.Etwas anderes ergibt sich nach dem BGH auch nicht aus den Vorschriften über die Durchführung der Kapitalerhöhung sowie die Prüfung durch Sachverständige und durch das Registergericht. § 188 Abs. 2 Satz 1 AktG verweist zur Durchführung der Anmeldung der Kapitalerhöhung auf § 36a Abs. 2 Satz 3 AktG, wonach der Wert der Sacheinlage auch das Aufgeld abdecken muss. Soweit § 183 Abs. 3 AktG bzw. § 205 Abs. 5 Satz 1 AktG nach seinem Wortlaut die Prüfung durch Sachverständige als Mindestanforderung durch die Verweisung auf § 34 Abs. 1 Nr. 2 AktG nur auf den geringsten Ausgabebetrag erstreckt, widerspricht die Norm nach Ansicht des BGH dem Art. 10 Abs. 2 der sog. „Kapitalrichtlinie“ (Zweite Richtlinie 77/91/EWG des Rates vom 13. Dezember 1976 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen). Art. 10 Abs. 2 der Kapitalrichtlinie verlangt nach Ansicht des BGH und der Literatur, dass der Sachverständigenbericht auch angibt, ob der Wert auch dem Mehrbetrag entspricht. Schließlich kann man nach dem BGH aus dem Umstand, dass das Registergericht nach § 184 Abs. 3 Satz 1 AktG bzw. § 205 Abs. 7 Satz 1 AktG die Eintragung ablehnen kann, wenn der Wert der Sacheinlage hinter dem geringsten Ausgabebetrag zurückbleibt, nur etwas für die Prüfungskompetenz des Registergerichts, nichts aber für den Umfang der Verpflichtungen des Sacheinlegers (Inferenten) ableiten.3.Trotz des Befreiungs- und Aufrechnungsverbots des § 66 Abs. 1 AktG ist ein Vergleich über den Differenzhaftungsanspruch zulässig.3.1Voraussetzungen eines Vergleichs über den DifferenzhaftungsanspruchDafür spricht bereits, dass der Vergleich in § 66 Abs. 1 AktG - im Gegensatz etwa zu § 50 Abs. 1, § 93 Abs. 4 Satz 3 oder § 117 Abs. 4 AktG - nicht erwähnt ist. Die Tatsache, dass im Rahmen des § 66 Abs. 1 AktG keine Befreiung möglich ist, schließt einen Vergleich bei tatsächlicher oder rechtlicher Ungewissheit nicht aus. Zwar gilt auch für den Differenzhaftungsanspruch das Befreiungs- und Aufrechnungsverbot des § 66 Abs. 1 AktG, mit dem die Kapitalaufbringung und die Kapitalerhaltung gesichert werden soll. Ein Vergleich über Ansprüche, die unter § 66 Abs. 1 AktG fallen, ist nach der Rechtsprechung und der Literatur aber trotzdem zulässig, wenn der Vergleich wegen tatsächlicher oder rechtlicher Ungewissheit über den Bestand oder Umfang des Anspruchs geschlossen wird und sich dahinter nicht nur eine Befreiung in der Form eines Vergleichs versteckt.Auch wenn durch den Abschluss eines Vergleichs objektiv eine Befreiung des Aktionärs von seinen Leistungspflichten eintreten kann, so steht doch wegen der Unklarheit, ob und in welchem Umfang ein Anspruch besteht, eine solche Befreiung bei einem Vergleichsschluss, der die durch die Unklarheit gezogenen Grenzen nicht überschreitet, gerade nicht fest. Nach der Rechtsprechung des BGH ist ein Vergleich, durch den die Ungewissheit darüber, was der Gesetzeslage entspricht, durch gegenseitiges Nachgeben beseitigt wird, trotz eines Widerspruchs zu zwingendem Recht wirksam, wenn der Vergleichsinhalt den Bereich nicht verlässt, der bei objektiver Beurteilung ernstlich zweifelhaft ist. Die Beurteilung, ob ein Vergleich ernsthaft gewollt ist und sein Inhalt den Bereich nicht verlässt, der ernstlich zweifelhaft ist, obliegt nach Ansicht des BGH in erster Linie dem Tatrichter. Vor Abschluss eines Vergleichs über den Differenzhaftungsanspruch muss regelmäßig weder ein Wertgutachten eingeholt werden noch muss sonst der Wert der Sacheinlage fachlich überprüft werden.Auch der Grundsatz der effektiven Kapitalaufbringung steht bei Einlageansprüchen oder einlageähnlichen Ansprüchen einem Vergleichsschluss nicht entgegen, wenn gerade die Unsicherheit beseitigt werden soll, ob das Kapital aufgebracht ist. Ein vollständiges Vergleichsverbot würde den Vorstand zwingen, trotz Zweifel am Bestand der Forderung und an den Erfolgsaussichten ein gerichtliches Verfahren einzuleiten und bis zu einem Urteil durchzuführen, oder von vorneherein wegen der die Chancen übersteigenden finanziellen Risiken der Prozessführung auf eine Geltendmachung zu verzichten.3.2Keine Zustimmung der Hauptversammlung erforderlichEin Vergleich bedarf nach Überzeugung des BGH auch nicht in Analogie zu § 50 Satz 1, § 93 Abs. 4 Satz 3, § 117 Abs. 4 AktG der Zustimmung der Hauptversammlung, da es diesbezüglich an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt. Nach ihrem Zweck lassen sich die Zustimmungserfordernisse der §§ 50 Satz 1, 93 Abs. 4 Satz 3, 117 Abs. 4 AktG nicht auf Ansprüche nach § 66 Abs. 1 AktG übertragen. Das Zustimmungserfordernis in § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG soll der Gefahr einer kollegialen Verschonung einzelner Vorstandsmitglieder und der wechselseitigen (Selbst-)Befreiung von Haftungsansprüchen vorbeugen. Eine solche Gefahr besteht beim Abschluss eines Vergleichs über einen unter § 66 Abs. 1 AktG fallenden Anspruch nicht, weil sich der Anspruch gegen den Aktionär richtet und der Vorstand bei pflichtwidrigem Vergleichsschluss seinerseits nach § 93 AktG haftet. § 50 Satz 1 AktG soll die Gesellschaft vor einem Verzicht oder einem Vergleich über die Ansprüche der Gesellschaft zu einem Zeitpunkt schützen, der noch in der zeitlichen Nähe der Gründung liegt und in dem sich die Auswirkungen der schädigenden Handlung noch nicht abschließend übersehen lassen.Ein Vergleich über den Differenzhaftungsanspruch gemäß § 66 Abs. 1 AktG rührt auch nicht an der Kernkompetenz der Hauptversammlung, über die Verfassung der Aktiengesellschaft zu bestimmen. Er bedarf nach Ansicht des BGH mangels wesentlicher Bedeutung für die Gesellschaft auch deshalb nicht der Zustimmung der Hauptversammlung.3.3Keine relative Unwirksamkeit gegenüber den Gläubigern der GesellschaftAuch die §§ 93 Abs. 5 Satz 3, 117 Abs. 5 Satz 2 AktG (relative Unwirksamkeit des Verzichts/Vergleichs den Gläubigern gegenüber) sind nach Ansicht des BGH nicht entsprechend anzuwenden. Der Schutz der Gläubiger der Gesellschaft vor einem kollusiven Zusammenwirken von Organen und Aktionären zu ihrem Nachteil gebietet eine entsprechende Anwendung nicht, weil ein Vergleich von vorneherein nur bei Ungewissheit über das Bestehen oder den Umfang der Schuld in Betracht kommt.3.4FazitDer BGH ist vorliegend wie das Berufungsgericht zur der Auffassung gelangt, dass die Beklagte und die Schuldnerin mit der Vereinbarung vom 28.06.2000 wirksam einen wegen tatsächlicher und rechtlicher Unsicherheit über den Bestand oder den Umfang des Differenzhaftungsanspruchs „echten“ Vergleich abgeschlossen haben, mit dem die Beklagte an die Schuldnerin einen Ertragszuschuss in Höhe von 325.000 Euro leisten sollte.4.Die Beklagte konnte allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen gegenüber dem nach dem Vergleich geschuldeten Ertragszuschuss mit ihrem Kaufpreisanspruch für die 2. Tranche aufrechnen.Die Aufrechnungsbeschränkung nach § 66 Abs. 1 Satz 2 AktG für den Differenzhaftungsanspruch gilt für die in einem Vergleich über diesen Anspruch vereinbarte Forderung fort. Nach der Rechtsprechung des BGH ändert ein Vergleich i.S.d. § 779 BGB das ursprüngliche Schuldverhältnis nur insoweit, als in ihm streitige oder ungewisse Punkte geregelt werden; im Übrigen besteht das ursprüngliche Rechtsverhältnis nach Inhalt und Rechtsnatur unverändert fort. Da der Vergleich in der Vereinbarung vom 28. Juni 2000 die Rechtsnatur der Forderung nicht veränderte, gelten deshalb auch die Beschränkungen des § 66 Abs. 1 AktG fort.Da der Gesellschaft im Gegensatz zum Aktionär die Aufrechnung nach § 66 Abs. 1 Satz 2 AktG nicht verboten ist, sind Aufrechnungsvereinbarungen zulässig, wenn die Gesellschaft ihrerseits die Aufrechnung erklären könnte. Die Gesellschaft kann nach Rechtsprechung und Literatur die Aufrechnung aber nur erklären, wenn die Forderung des Aktionärs gegen die Gesellschaft vollwertig, fällig und liquide ist. Die Vollwertigkeit ist nicht nach den subjektiven Vorstellungen der Parteien bei der Vereinbarung, sondern objektiv zu bestimmen; der Aktionär ist für die Vollwertigkeit grundsätzlich darlegungs- und beweisbelastet.Das Berufungsgericht hatte angenommen, dass eine solche Vollwertigkeit der Kaufpreisforderung wegen einer ausreichenden Sicherheit (Zurückbehaltungsrecht der Beklagten an ihren HDW-Aktien bis zur Kaufpreiszahlung) vorhanden gewesen war. Der BGH stellte insofern klar: Eine Forderung ist zwar auch vollwertig, wenn sie in voller Höhe durch eine Sicherheit gedeckt ist. Eine Sicherheit macht die Forderung aber nur dann vollwertig, wenn sie für den Fall verwertet werden kann, dass die Forderung nicht durchsetzbar ist. Eine solche Verwertungsbefugnis gibt das Zurückbehaltungsrecht nicht. Da im Übrigen das Berufungsgericht zur Vollwertigkeit der Gegenforderung der Beklagten keine Feststellungen getroffen hatte, konnte der BGH nicht selbst entscheiden und musste deshalb die Sache an das Berufungsgericht zurückverweisen (§ 563 Abs. 1S. 1 ZPO).Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Erfurt/ Thüringen Januar 2012 Mit der Klage begehrte der Kläger unter anderem Zahlung dieser 171.443.837 €. Das Landgericht Frankfurt am Main wies die Klage ab. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main als Berufungsgericht wies die Berufung des Klägers zurück. Die dagegen gerichtete Revision des Klägers hatte Erfolg. Der BGH hob das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main auf und verwies die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück.III.Der BGH gelangt zu seinem Ergebnis auf folgendem Weg:1.Keine Befreiung der Aktionäre von ihren Leistungspflichten (§ 66 Abs. 1 AktG)§ 66 Abs. 1 AktG besagt:„Die Aktionäre und ihre Vormänner können von ihren Leistungspflichten nach den §§ 54 und 65 nicht befreit werden. Gegen eine Forderung der Gesellschaft nach den §§ 54 und 65 ist die Aufrechnung nicht zulässig.“§ 54 Abs. 1 AktG besagt:„Die Verpflichtung der Aktionäre zur Leistung der Einlagen wird durch den Ausgabebetrag der Aktien begrenzt.“2.Der aktienrechtliche Differenzhaftungsanspruch fällt ebenfalls unter § 66 Abs. 1 AktG.2.1Geringster Ausgabebetrag (§ 9 Abs. 1 AktG)Nach dem BGH ist es allgemein anerkannt, dass der Aktionär bei einer Überbewertung von Sacheinlagen den Differenzbetrag zwischen dem Wert der Sacheinlage und dem geringsten Ausgabebetrag in Geld zu leisten hat. Dieser sog. „Differenzhaftungsanspruch“ wird aus § 36a Abs. 2 AktG in Verbindung mit §§ 183, 188 Abs. 2 Satz 1 AktG, aus der mit der Übernahme bzw. mit der Zeichnung zwangsläufig verbundenen Kapitaldeckungszusage, aus dem Verbot in § 9 Abs. 1 AktG, Aktien für einen geringeren Betrag als den Nennbetrag (oder den auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals) auszugeben sowie aus einer Analogie zu § 9 Abs. 1 GmbHG abgeleitet.2.2Aufgeld (§ 9 Abs. 2 AktG)Ein gesetzlicher Differenzhaftungsanspruch besteht nach dem BGH aber auch insoweit, als der Wert der Sacheinlage zwar den geringsten Ausgabebetrag nach § 9 Abs. 1 AktG, nicht aber auch das Aufgeld nach § 9 Abs. 2 AktG deckt. Das Aufgeld ist bei der Aktiengesellschaft (anders als bei der GmbH) Teil des Ausgabebetrags und der mitgliedschaftlichen Leistungspflicht der Aktionäre nach § 54 Abs. 1 AktG, von der sie nach § 66 Abs. 1 AktG grundsätzlich nicht befreit werden können. Nach dem BGH wäre eine andere Sicht insbesondere auch damit nicht vereinbar, dass eine Wertdeckung im Umfang des Aufgelds auch erforderlich ist, um eine Verwässerung der Anteile der - regelmäßig - von der Sachkapitalerhöhung ausgeschlossenen Aktionäre (§ 255 Abs. 2 AktG) zu verhindern.Etwas anderes ergibt sich nach dem BGH auch nicht aus den Vorschriften über die Durchführung der Kapitalerhöhung sowie die Prüfung durch Sachverständige und durch das Registergericht. § 188 Abs. 2 Satz 1 AktG verweist zur Durchführung der Anmeldung der Kapitalerhöhung auf § 36a Abs. 2 Satz 3 AktG, wonach der Wert der Sacheinlage auch das Aufgeld abdecken muss. Soweit § 183 Abs. 3 AktG bzw. § 205 Abs. 5 Satz 1 AktG nach seinem Wortlaut die Prüfung durch Sachverständige als Mindestanforderung durch die Verweisung auf § 34 Abs. 1 Nr. 2 AktG nur auf den geringsten Ausgabebetrag erstreckt, widerspricht die Norm nach Ansicht des BGH dem Art. 10 Abs. 2 der sog. „Kapitalrichtlinie“ (Zweite Richtlinie 77/91/EWG des Rates vom 13. Dezember 1976 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen). Art. 10 Abs. 2 der Kapitalrichtlinie verlangt nach Ansicht des BGH und der Literatur, dass der Sachverständigenbericht auch angibt, ob der Wert auch dem Mehrbetrag entspricht. Schließlich kann man nach dem BGH aus dem Umstand, dass das Registergericht nach § 184 Abs. 3 Satz 1 AktG bzw. § 205 Abs. 7 Satz 1 AktG die Eintragung ablehnen kann, wenn der Wert der Sacheinlage hinter dem geringsten Ausgabebetrag zurückbleibt, nur etwas für die Prüfungskompetenz des Registergerichts, nichts aber für den Umfang der Verpflichtungen des Sacheinlegers (Inferenten) ableiten.3.Trotz des Befreiungs- und Aufrechnungsverbots des § 66 Abs. 1 AktG ist ein Vergleich über den Differenzhaftungsanspruch zulässig.3.1Voraussetzungen eines Vergleichs über den DifferenzhaftungsanspruchDafür spricht bereits, dass der Vergleich in § 66 Abs. 1 AktG - im Gegensatz etwa zu § 50 Abs. 1, § 93 Abs. 4 Satz 3 oder § 117 Abs. 4 AktG - nicht erwähnt ist. Die Tatsache, dass im Rahmen des § 66 Abs. 1 AktG keine Befreiung möglich ist, schließt einen Vergleich bei tatsächlicher oder rechtlicher Ungewissheit nicht aus. Zwar gilt auch für den Differenzhaftungsanspruch das Befreiungs- und Aufrechnungsverbot des § 66 Abs. 1 AktG, mit dem die Kapitalaufbringung und die Kapitalerhaltung gesichert werden soll. Ein Vergleich über Ansprüche, die unter § 66 Abs. 1 AktG fallen, ist nach der Rechtsprechung und der Literatur aber trotzdem zulässig, wenn der Vergleich wegen tatsächlicher oder rechtlicher Ungewissheit über den Bestand oder Umfang des Anspruchs geschlossen wird und sich dahinter nicht nur eine Befreiung in der Form eines Vergleichs versteckt.Auch wenn durch den Abschluss eines Vergleichs objektiv eine Befreiung des Aktionärs von seinen Leistungspflichten eintreten kann, so steht doch wegen der Unklarheit, ob und in welchem Umfang ein Anspruch besteht, eine solche Befreiung bei einem Vergleichsschluss, der die durch die Unklarheit gezogenen Grenzen nicht überschreitet, gerade nicht fest. Nach der Rechtsprechung des BGH ist ein Vergleich, durch den die Ungewissheit darüber, was der Gesetzeslage entspricht, durch gegenseitiges Nachgeben beseitigt wird, trotz eines Widerspruchs zu zwingendem Recht wirksam, wenn der Vergleichsinhalt den Bereich nicht verlässt, der bei objektiver Beurteilung ernstlich zweifelhaft ist. Die Beurteilung, ob ein Vergleich ernsthaft gewollt ist und sein Inhalt den Bereich nicht verlässt, der ernstlich zweifelhaft ist, obliegt nach Ansicht des BGH in erster Linie dem Tatrichter. Vor Abschluss eines Vergleichs über den Differenzhaftungsanspruch muss regelmäßig weder ein Wertgutachten eingeholt werden noch muss sonst der Wert der Sacheinlage fachlich überprüft werden.Auch der Grundsatz der effektiven Kapitalaufbringung steht bei Einlageansprüchen oder einlageähnlichen Ansprüchen einem Vergleichsschluss nicht entgegen, wenn gerade die Unsicherheit beseitigt werden soll, ob das Kapital aufgebracht ist. Ein vollständiges Vergleichsverbot würde den Vorstand zwingen, trotz Zweifel am Bestand der Forderung und an den Erfolgsaussichten ein gerichtliches Verfahren einzuleiten und bis zu einem Urteil durchzuführen, oder von vorneherein wegen der die Chancen übersteigenden finanziellen Risiken der Prozessführung auf eine Geltendmachung zu verzichten.3.2Keine Zustimmung der Hauptversammlung erforderlichEin Vergleich bedarf nach Überzeugung des BGH auch nicht in Analogie zu § 50 Satz 1, § 93 Abs. 4 Satz 3, § 117 Abs. 4 AktG der Zustimmung der Hauptversammlung, da es diesbezüglich an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt. Nach ihrem Zweck lassen sich die Zustimmungserfordernisse der §§ 50 Satz 1, 93 Abs. 4 Satz 3, 117 Abs. 4 AktG nicht auf Ansprüche nach § 66 Abs. 1 AktG übertragen. Das Zustimmungserfordernis in § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG soll der Gefahr einer kollegialen Verschonung einzelner Vorstandsmitglieder und der wechselseitigen (Selbst-)Befreiung von Haftungsansprüchen vorbeugen. Eine solche Gefahr besteht beim Abschluss eines Vergleichs über einen unter § 66 Abs. 1 AktG fallenden Anspruch nicht, weil sich der Anspruch gegen den Aktionär richtet und der Vorstand bei pflichtwidrigem Vergleichsschluss seinerseits nach § 93 AktG haftet. § 50 Satz 1 AktG soll die Gesellschaft vor einem Verzicht oder einem Vergleich über die Ansprüche der Gesellschaft zu einem Zeitpunkt schützen, der noch in der zeitlichen Nähe der Gründung liegt und in dem sich die Auswirkungen der schädigenden Handlung noch nicht abschließend übersehen lassen.Ein Vergleich über den Differenzhaftungsanspruch gemäß § 66 Abs. 1 AktG rührt auch nicht an der Kernkompetenz der Hauptversammlung, über die Verfassung der Aktiengesellschaft zu bestimmen. Er bedarf nach Ansicht des BGH mangels wesentlicher Bedeutung für die Gesellschaft auch deshalb nicht der Zustimmung der Hauptversammlung.3.3Keine relative Unwirksamkeit gegenüber den Gläubigern der GesellschaftAuch die §§ 93 Abs. 5 Satz 3, 117 Abs. 5 Satz 2 AktG (relative Unwirksamkeit des Verzichts/Vergleichs den Gläubigern gegenüber) sind nach Ansicht des BGH nicht entsprechend anzuwenden. Der Schutz der Gläubiger der Gesellschaft vor einem kollusiven Zusammenwirken von Organen und Aktionären zu ihrem Nachteil gebietet eine entsprechende Anwendung nicht, weil ein Vergleich von vorneherein nur bei Ungewissheit über das Bestehen oder den Umfang der Schuld in Betracht kommt.3.4FazitDer BGH ist vorliegend wie das Berufungsgericht zur der Auffassung gelangt, dass die Beklagte und die Schuldnerin mit der Vereinbarung vom 28.06.2000 wirksam einen wegen tatsächlicher und rechtlicher Unsicherheit über den Bestand oder den Umfang des Differenzhaftungsanspruchs „echten“ Vergleich abgeschlossen haben, mit dem die Beklagte an die Schuldnerin einen Ertragszuschuss in Höhe von 325.000 Euro leisten sollte.4.Die Beklagte konnte allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen gegenüber dem nach dem Vergleich geschuldeten Ertragszuschuss mit ihrem Kaufpreisanspruch für die 2. Tranche aufrechnen.Die Aufrechnungsbeschränkung nach § 66 Abs. 1 Satz 2 AktG für den Differenzhaftungsanspruch gilt für die in einem Vergleich über diesen Anspruch vereinbarte Forderung fort. Nach der Rechtsprechung des BGH ändert ein Vergleich i.S.d. § 779 BGB das ursprüngliche Schuldverhältnis nur insoweit, als in ihm streitige oder ungewisse Punkte geregelt werden; im Übrigen besteht das ursprüngliche Rechtsverhältnis nach Inhalt und Rechtsnatur unverändert fort. Da der Vergleich in der Vereinbarung vom 28. Juni 2000 die Rechtsnatur der Forderung nicht veränderte, gelten deshalb auch die Beschränkungen des § 66 Abs. 1 AktG fort.Da der Gesellschaft im Gegensatz zum Aktionär die Aufrechnung nach § 66 Abs. 1 Satz 2 AktG nicht verboten ist, sind Aufrechnungsvereinbarungen zulässig, wenn die Gesellschaft ihrerseits die Aufrechnung erklären könnte. Die Gesellschaft kann nach Rechtsprechung und Literatur die Aufrechnung aber nur erklären, wenn die Forderung des Aktionärs gegen die Gesellschaft vollwertig, fällig und liquide ist. Die Vollwertigkeit ist nicht nach den subjektiven Vorstellungen der Parteien bei der Vereinbarung, sondern objektiv zu bestimmen; der Aktionär ist für die Vollwertigkeit grundsätzlich darlegungs- und beweisbelastet.Das Berufungsgericht hatte angenommen, dass eine solche Vollwertigkeit der Kaufpreisforderung wegen einer ausreichenden Sicherheit (Zurückbehaltungsrecht der Beklagten an ihren HDW-Aktien bis zur Kaufpreiszahlung) vorhanden gewesen war. Der BGH stellte insofern klar: Eine Forderung ist zwar auch vollwertig, wenn sie in voller Höhe durch eine Sicherheit gedeckt ist. Eine Sicherheit macht die Forderung aber nur dann vollwertig, wenn sie für den Fall verwertet werden kann, dass die Forderung nicht durchsetzbar ist. Eine solche Verwertungsbefugnis gibt das Zurückbehaltungsrecht nicht. Da im Übrigen das Berufungsgericht zur Vollwertigkeit der Gegenforderung der Beklagten keine Feststellungen getroffen hatte, konnte der BGH nicht selbst entscheiden und musste deshalb die Sache an das Berufungsgericht zurückverweisen (§ 563 Abs. 1S. 1 ZPO).Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Erfurt/ Thüringen Januar 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktienrechtsnovelle 2016 | KurzüberblickDas Gesetz zur Änderung des Aktiengesetzes (Aktienrechtsnovelle 2016) ist am 30.12.2015 im Bundesgesetzblatt verkündet worden und am 31.12.2015 in Kraft getreten. Diese möchten wir Ihnen kurz vorstellen:1. Verbot von Inhaberaktien bei nichtbörsennotierten AktiengesellschaftenNicht börsennotierte Gesellschaften dürfen Inhaberaktien nur noch dann ausgeben, wenn das Recht der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer Aktien ausgeschlossen wird und die Inhaberaktien in einer Sammelurkunde verbrieft sind, die bei einer Wertpapiersammelbank oder einem Zentralverwahrer hinterlegt werden muss. Solange keine Sammelurkunde hinterlegt ist, muss die Gesellschaft entsprechend § 67 AktG ein Aktienregister führen (vgl. § 10 Abs. 1 AktG n.F.). Nach der Übergangsregelung ist die Neuregelung nicht auf Gesellschaften anzuwenden, deren Satzung vor Inkrafttreten der Neuregelung durch notarielle Beurkundung festgestellt wurde.2. Fälligkeit des DividendenanspruchsDer Dividendenanspruch ist künftig erst am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag fällig, es sei denn, die Hauptversammlung oder die Satzung bestimmt eine spätere Fälligkeit (vgl. § 58 Abs. 4 Satz 2 und 3 AktG n.F.).3. Dreiteilbarkeit der AufsichtsratsmitgliederDie Dreiteilbarkeit der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder ist nach § 95 Satz 3 AktG n.F. nur noch bei Gesellschaften erforderlich, die eine solche aufgrund mitbestimmungsrechtlicher Vorgaben zu beachten haben.4. EinberufungsverlangenIm Rahmen der Regelung zur Einberufung einer Hauptversammlung auf Verlangen einer Minderheit ist in § 122 Abs. 1 Satz 3 sowie Abs. 3 Satz 5 AktG n.F. nun klargestellt, dass bei der Ermittlung der Vorbesitzzeit (nunmehr 90 Tage) vom Zeitpunkt des Zugangs des Einberufungsverlangens bei der Gesellschaft (nicht vom Tag der Hauptversammlung) zurückzurechnen ist und die Antragsteller die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands bzw. des Gerichts über den Antrag halten müssen.5. AktionärslisteIn einem neuen § 123 Abs. 5 AktG n.F. wird nun mit Verweis auf § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG eine (inhaltlich zur derzeit geltenden Regelung unveränderte) Nachweisregelung für Namensaktien aufgenommen.6. WandelschuldverschreibungBislang sehen die Vorschriften zu Wandelschuldverschreibungen nur ein Umtauschrecht des Gläubigers, nicht aber auch eines der Gesellschaft als Schuldnerin vor. Nun wird klargestellt, dass auch ein Wandlungsrecht der Gesellschaft („umgekehrte Wandelanleihe″) vorgesehen werden kann, mit dem diese die Anleihen gegen Gewährung von Anteilen in Grundkapital umwandelt. Zur Bedienung der umgekehrten Wandelanleihe kann bedingtes Kapital geschaffen werden (vgl. § 192 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 AktG n.F.). Die in § 192 Abs. 3 Satz 1 AktG enthaltene Grenze zur Schaffung von bedingtem Kapital in Höhe von 50% des Nennbetrags des Grundkapitals gilt künftig nicht, wenn die bedingte Kapitalerhöhung nur zu dem Zweck beschlossen wird, der Gesellschaft die Erfüllung eines Umtauschs zu ermöglichen, den die Gesellschaft aufgrund eines Umtauschrechts durchführt, das ihr für den Fall ihrer drohenden Zahlungsunfähigkeit zusteht oder zu dem sie zum Zweck der Abwendung einer Überschuldung berechtigt ist (vgl. § 192 Abs. 3 Satz 3-5 AktG n.F.).7. Stimmrechtslose VorzugsaktienStimmrechtslose Vorzugsaktien können nun ohne zwingend nachzuzahlenden Vorzug ausgegeben werden. Zudem ist klargestellt, dass der Vorzug entweder in einer Vorab- oder in einer Mehrdividende bestehen kann. Die Nachzahlbarkeit einer Vorabdividende kann in der Satzung ausgeschlossen werden (vgl. § 139 Abs. 1 Satz 2 und 3 AktG n.F.). In diesem Fall haben die Vorzugsaktionäre bereits dann ein Sonderstimmrecht, wenn der Vorzugsbetrag in einem Jahr teilweise nicht gezahlt wird (vgl. § 140 Abs. 2 Satz 2 AktG n.F.).8. Kommunale AufsichtsratsmitgliederFür Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt worden sind, wird klargestellt, dass eine Berichtspflicht, bei der sie grundsätzlich keiner Verschwiegenheitspflicht unterliegen, sowohl auf Gesetz oder Satzung als auch auf einem Rechtsgeschäft beruhen kann (vgl. § 394 Satz 3 AktG n.F.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANLEGERFONDS - Widerruf der Beteiligung auch nach vielen Jahren bei fehlerhafter Widerrufsbelehrung | Der Bundesgerichtshof hat am 18. März 2014 in seinem Urteil, Az. II ZR 109/13, eine wichtige Entscheidung im Zusammenhang mit einer Anlage als atypisch stiller Gesellschafter getroffen. Wenn eine Fondsbeteiligung in einer 'Haustürsituation' erworben wurde und der Fonds eine falsche Widerrufsbelehrung verwendete, kann der Anleger sich noch nach vielen Jahren nach seinem Beitritt zu dieser Kapitalbeteiligung von dieser durch Widerruf trennen, weil die Widerrufsfrist nicht abgelaufen ist. Dabei hat der Bundesgerichtshof die Anforderungen an eine mustergültige Widerrufbelehrung verschärft. Geringfügige Abweichungen der Widerrufsbelehrung vom gesetzlichen Mustertext können schädlich sein.Im konkreten Fall wurde folgende Widerrufsbelehrung verwendet:„Widerrufsrecht. Sie können Ihre Beitrittserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, Email) widerrufen. Die Frist beginnt einen Tag, nachdem Sie diese Belehrung, eine Abschrift Ihrer Beitrittserklärung sowie den atypisch stillen Gesellschaftsvertrag (im Emissionsprospekt enthalten) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: … .Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) heraus-zugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.“Das als Anlage 2 zu dem 2004 geltenden § 14 BGB-InfoV aF im Bundesgesetzblatt veröffentlichte Muster wies zum Widerrufsrecht und zu den Widerrufsfolgen dagegen folgenden Text auf:"WiderrufsrechtSie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von [zwei Wochen] ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) [oder durch Rücksendung der Sache] widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs [oder der Sache]. Der Widerruf ist zu richten an:WiderrufsfolgenIm Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren [und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben]. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. [Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind [auf unsere Kosten und Gefahr] zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.]"Die verwendete Widerrufsbelehrung weicht in dem über den Fristbeginn belehrenden Teil von dem Muster ab, indem anstelle des Fristbeginns nach dem Muster („frühestens mit Erhalt dieser Belehrung“) über einen Fristbeginn „einen Tag, nachdem Sie diese Belehrung, eine Abschrift Ihrer Beitrittserklärung sowie den atypisch stillen Gesellschaftsvertrag (im Emissionsprospekt enthalten) erhalten haben“ belehrt wird.Die Widerrufsbelehrung war auch deshalb fehlerhaft, weil sie keinen Hinweis auf die rechtlichen Folgen des Widerrufs der stillen Gesellschaft enthält. Der Widerruf einer stillen Gesellschaft führt dazu, dass diese nach den Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft abzuwickeln ist. Der Anleger kann einen Anspruch auf das sog. „Abfindungsguthaben“ geltend machen.Wurde die Fondsbeteiligung ganz oder teilweise fremdfinanziert, besteht die Möglichkeit sich u.U. bei der kreditfinanzierenden Bank schadlos zu halten, wenn das Abfindungsguthaben den in den Fonds eingezahlten Betrag unterschreitet.Der Leitsatz des BGH im Urteil, Az. II ZR 109/13 lautet wie folgt:„BGB § 312 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 (in der ab dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung), § 355 (in der Fassung vom 23. Juli 2002); BGB-InfoV § 14 Abs. 1 und 3 (in der Fassung vom 5. August 2002)Der Unternehmer, der eine den gesetzlichen Anforderungen nach § 312 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BGB (in der ab dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung), § 355 Abs. 2 BGB (in der Fassung vom 23. Juli 2002) nicht genügende Widerrufsbelehrung verwendet, kann sich auf die Schutzwirkung des § 14 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV (in der Fassung vom 5. August 2002) nicht berufen, wenn er den Text der Musterbelehrung einer eigenen inhaltlichen Bearbeitung unterzieht; ob die Abweichungen von der Musterbelehrung nur in der Aufnahme von insoweit zutreffenden Zusatzinformationen zugunsten des Belehrungsempfängers bestehen, ist unerheblich.“Näheres entnehmen sie bitte unserer Websitehttp://www.gesellschaftsrechtskanzlei.com/bgh-urteil-vom-18-maerz-2014-ii-zr-10913Auch wenn die Beitrittsverträge älter als 10 Jahre sind, sollte der Anleger die Widerrufsbelehrung von einem auf Gesellschaftsrecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen lassen, um zu klären, ob ein Widerruf im konkreten Einzelfall noch möglich ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwachsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwachsung Erfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArbG Berlin, Urteil vom 1. November 2018 – 41 Ca 1674/18 | § 613a Abs 1 S 1 BGB, § 138 Abs 1 ZPO, § 138 Abs 2 ZPO, § 24 KSchG, § 1 Abs 2 S 1 Alt 3 KSchG 1. Die Kündigungsschutzklage gegen eine Kündigung ist unbegründet, wenn die kündigende ehemalige Arbeitgeberin zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung auf Grund eines vorherigen Betrieb(steil)übergangs gemäß § 613 a Absatz 1 Satz 1 BGB nicht mehr Arbeitgeberin der gekündigten Arbeitnehmerin war. 2. Trägt die Arbeitnehmerin konkrete Anhaltspunkte für einen Betriebsteilübergang vor, muss nach § 138 Absatz 1, 2 ZPO ein Insolvenzverwalter substantiiert erwidern, soweit es sich um Vorgänge aus seinem Wahrnehmungsbereich handelt. Die Vorgänge bei einer von der Insolvenzschuldnerin abhängigen nicht insolventen Tochtergesellschaft, die auf Betreiben und mit Zustimmung der Schuldnerin als damaliger Konzernmutter und des damaligen Sach- und jetzt Insolvenzverwalters in Erfüllung eines von der Schuldnerin/dem Sachverwalter ausgehandelten Kaufvertrages über mehrere Millionen Euro stattfanden, liegen jedenfalls bis zum Vollzug des Verkaufs der Tochtergesellschaft im Wahrnehmungsbereich des Insolvenzverwalters, so der Insolvenzverwalter nicht konkret etwas Gegenteiliges vorträgt. 3. Werden übergangsfähige Teile eines Betriebsteils von verschiedenen Erwerbern übernommen und ist in diesem Falle einer Betriebsteilspaltung im Wege der Einzelrechtsnachfolge eine Zuordnung des Arbeitsverhältnisses einer in Elternzeit befindlichen Arbeitnehmerin zwar zur Ausgangseinheit (hier: Station der Fluggesellschaft), aber mangels vertraglicher Regelung oder tatsächlichen Schwerpunkts nicht zu den übergegangenen Teilen der Ausgangseinheit möglich, wird der Arbeitnehmerin nicht der Schutz des § 613a BGB genommen: die Arbeitnehmerin hat in diesem Fall ein Wahlrecht. TenorI. Die Klage wird abgewiesen. II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. III. Der Wert des Streitgegenstandes des Urteils wird auf 26.001,78 Euro festgesetzt. TatbestandDie Parteien streiten über die Wirksamkeit einer betriebsbedingten Kündigung aus Anlass der Insolvenz der Schuldnerin. Der Beklagte ist der Insolvenzverwalter über das Vermögen der Schuldnerin. Randnummer2 Die am ... geborene, verheiratete und drei Kindern unterhaltspflichtige Klägerin (im Folgenden: die klägerische Partei) ist bei der Schuldnerin (zurechenbar) seit dem 13.09.2004 als Copilotin angestellt. Mit Schreiben der Schuldnerin vom 06.02.2017 wurde die klägerische Partei "wunschgemäß ab 01.03.2017 von der Station Berlin zur Station Stuttgart versetzt". Für Februar 2017 erhielt die Klägerin eine Abrechnung über einen Betrag i.H.v. 8.667,26 Euro (Anlage K2). Die Klägerin befand sich ab einem nicht mitgeteilten Zeitpunkt bis zum 15.01.2018 in Elternzeit. Mit Schreiben vom 16.01.2018, der Klägerin am 18.01.2018 zugegangen, kündigte die Schuldnerin der Klägerin zum 30.04.2018. Mit der am 08.02.2018 bei Gericht per Fax eingegangenen Klage begehrt die klägerische Partei die Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung. Randnummer3 Die Schuldnerin hatte ein eigenes Luftverkehrsbetreiberzeugnis (Air Operator Certificate (AOC)). Ihr fliegendes Personal war in Deutschland an den Flughäfen Berlin-Tegel, Düsseldorf, München, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Leipzig, Köln, Hamburg und Paderborn stationiert. Die Schuldnerin flog u.a. Kurz- und Mittelstrecken. Letztere mit Flugzeugen der Airbus (A) - 320-Familie (A319, A320 und A321) („A 320“ steht teils für die A320 - Familie, teils für das Muster „A320“ der A320 - Familie). Die Flugzeuge waren zuletzt von Leasinggebern ("Lessoren") im "Dry-Lease" (Leasing nur der Maschinen) geleast. Randnummer4 Aus wirtschaftlichen Gründen entschloss sich die Schuldnerin im Jahr 2016 neben dem eigenwirtschaftlichen Flugbetrieb als ein weiteres Geschäftsfeld "Wet-Lease" für andere Luftfahrtunternehmen aufzubauen. Von "Wet-Lease" spricht man in der Luftverkehrswirtschaft, wenn ein Luftfahrtunternehmen einem anderen Luftfahrtunternehmen Flugzeuge nebst Kraftstoff ("wet") und Bedienungspersonal für den Einsatz auf Strecken des anderen Luftfahrtunternehmens nach dessen Vermarktung und auf dessen Rechnung überlässt. Bei längerfristigen Leasingverträgen erhalten die im Wet-Lease fliegenden Flugzeuge häufig die Lackierung (das Signet) der entleihenden Fluggesellschaft. Randnummer5 Ende 2016 schlossen Gesellschaften des L.-Konzerns ("L. Group"; hier auch: „L.“) und die Schuldnerin für sechs Jahre einen Wet-Lease - Vertrag für 38 von der Schuldnerin betriebene Flugzeuge der A320-Familie ab (hier: "Wet-Lease - Rahmenvertrag" - von der EU-Kommission auch "Roof-Wetlease" genannt). Dies in Form einer "ACMIO" - Vereinbarung. "ACMIO" ist ein Akronym und steht für "Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance, Overhead" (Flugzeug, Personal, Wartung, Versicherung, Gemeinkosten), wobei "Overhead" hier auch die (Kosten für die) Personaleinsatzplanung durch die Schuldnerin meint. Die Ausdrücke „ACMIO“ und „Wet-Lease“ werden hier synonym verwendet. Die Schuldnerin kommunizierte unternehmensintern die mit L. getroffene Wet-Lease - Vereinbarung als "ACMIO-Operation". Randnummer6 Nach dem Muster der Schreiben vom 14.12.2016 bzw. 19.12.2016 (Anlagen K34) wurde interessiertem Flugpersonal ein Wechsel an die Stationen Köln bzw. Stuttgart u.a. mit der Erläuterung angeboten, dass der Einsatz dann "dedicated im Wetlease/ACMIO" erfolge. Randnummer7 Im Januar 2017 genehmigte die EU-Kommission den "Wet-Lease - Rahmenvertrag". Am 14.02.2017 schloss die Schuldnerin mit der PV Cockpit einen "Rahmen-Interessenausgleich zur Umstrukturierung der A. Berlin für das Cockpitpersonal" (Anlage B8). Darin wird zwischen "ausschließlichen ACMI-Stationen" und "'gemischten Stationen'" unterschieden. Mit "ausschließlichen ACMIO-Stationen" waren die Stationen Köln, Hamburg und Stuttgart gemeint. Randnummer8 Gemäß dem Wet-Lease - Rahmenvertrag flog die Schuldnerin auf ihrem AOC bis zum Insolvenzantrag mit 38 Flugzeugen im Wet-Lease für Gesellschaften der L.-Group: fünf Flugzeuge für die L.-Tochter "A. Airlines" und 33 Flugzeuge für die L.-Tochter "E. GmbH" (auch: "deutsche E." oder "E. Deutschland" genannt). Die E. GmbH hat ihren Sitz in Deutschland. Sie ist Teil der "E. Group". Die "E. Group" ist Teil der "L. Group". Die 33 für die E. GmbH fliegenden Airbus-Maschinen sollten mit der Lackierung von E., das Kabinenpersonal in Uniformen von E. fliegen. Die Personalplanung für das Personal der Air Berlin/E. - Wet-Lease - Flotte erfolgte weiterhin durch die Schuldnerin. Randnummer9 Reicht die Kapazität eines Flughafens nicht zur Befriedigung der Nachfrage, so werden die Zeitfenster ("Slots") für das Starten und Landen auf dem Flughafen ("Flughafenslots") rationiert. Die Vergabe der Slots ist dann durch die EU-Verordnung (EWG) Nr. 95/93 und damit öffentlich-rechtlich geregelt. Besitzt eine Fluggesellschaft einen Slot, kann sie diesen über das sog. "grandfathering" zeitlich unbegrenzt halten. Die Slots für kontingentierte Flughäfen - das sind u.a. alle größeren deutschen Flughäfen - sind für die Fluggesellschaften von großem wirtschaftlichem Wert. Slots können nicht frei, sondern nur nach Maßgabe der EU-Verordnung übertragen werden. Demgemäß innerhalb eines Konzerns oder durch Erwerb einer ganzen Luftverkehrsgesellschaft. In Kombination kann ein Konzern-Muttergesellschaft Slots auf eine Tochtergesellschaft übertragen und dann die Tochtergesellschaft mit diesen Slots an eine andere Luftverkehrsgesellschaft veräußern. Randnummer10 Die Schuldnerin kooperierte mit der "Luftfahrtgesellschaft W. mbH" (LGW). Diese hatte keine eigenen Flugstreckenrechte und keine eigenen Flugzeuge mehr. Die LGW leaste von der Schuldnerin „dry“ 20 "Q400" - Flugzeuge (Turboprop - Regionalflugzeuge) und leaste diese "wet" (d.h. mit Benzin, vor allem aber mit eigenem Personal) an die Schuldnerin zurück. Das AOC der LGW erstreckte sich nicht auf den Betrieb von Airbus-Flugzeugen. Im Mai/Juni 2017 kaufte die Komplementärin der Schuldnerin die LGW zu einem geringen Kaufpreis. Durch den Erwerb der LGW war es der Schuldnerin im Oktober 2017 möglich, Slots auf die LGW zu übertragen und die LGW für mehrere Millionen Euro an "L." zu veräußern. Randnummer11 Am 15.08.2017 wurde über das Vermögen der Schuldnerin ein Insolvenzantragsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Der Geschäftsbetrieb der Schuldnerin wurde vorerst weiter geführt. Randnummer12 Am 12.10.2017 gab die Schuldnerin u.a. folgende "Erklärung" ab (Anlage B1): Randnummer13 "1. Beendigung der Flugzeug-Leasingverträge ... sukzessive bis zum 31.01.2018. Das Wet-Lease - Programm der Schuldnerin für E. wurde also von 33 auf 13, d.h. um 20 Airbus-Flugzeuge verkürzt. Im L.-Kaufvertrag ("L.-SPA") war zugleich vereinbart worden, dass die LGW mit ihren 20 Flugzeugen des Typs Q400 statt für die Schuldnerin für die E. im Wet-Lease fliegen sollte. Randnummer15 Am 12.10.2017 hatte "L." an die Schuldnerin 16 A320- und ein A319-Flugzeug ("dry") geleast. Nur letzteres wurde nach dem 27.10.2017 von der Schuldnerin noch eingesetzt (im Wet-Lease für die E. GmbH). Randnummer16 Am 13.10.2017 verkaufte die Schuldnerin ihre Anteile an der LGW an die L. C. Holding GmbH (hier: "L.-Kaufvertrag", der Beklagte spricht synonym vom "L.-SPA"). "Unter dem L.-SPA hatte sich die AB KG [die Schuldnerin] dazu verpflichtet, bis zum Vollzugstag am 09. Januar 2018 den operativen Betrieb der LGW aufrechtzuerhalten, Unterstützung beim Aufrechterhalten des bisherigen Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) der LGW sowie bei der Erweiterung des AOC der LGW auf den Flugzeug-Typ Airbus A320 zu leisten und Flughafen-Slots (Zeitnischen) in die LGW einzubringen" (Schriftsatz des Beklagten vom 23.10.2018, Bl. 429 d.A.). Im Rahmen der Stilllegung wurde die Wet-Lease-Vereinbarung zwischen der LGW und der Schuldnerin beendet "und zwischen der E. GmbH (EW) als Leasingnehmer und der LGW als Leasinggeber neu abgeschlossen. Unter dieser neuen Vereinbarung hat sich die LGW verpflichtet, ... mit Erteilung des AOC für den Flugzeug-Typ Airbus A320 .. Flugzeuge dieses Flugzeug-Typs an die E. im Rahmen eines Wetlease zu vermieten. In dem L.-SPA ... haben die Parteien vereinbart, dass mit Erweiterung des AOC der LGW auf den Flugzeug-Typ Airbus A320 auch bis zu 13 Flugzeuge dieses Typs im Wetlease für die EW eingesetzt werden sollen. Hierzu haben die Parteien zusätzlich vereinbart, dass die LGW entsprechend bis zu 13 Besatzungsäquivalente für den Betrieb der A320 Flugzeuge einstellen soll" (Schriftsatz des Beklagten vom 23.10.2018, S. 28 f., Bl. 429 f. d.A.). Zugleich sollte die Deutsche L. AG die beschriebene Head- und Sublease - Struktur übernehmen, für die Flugzeuge des Typs A320 ohne Festlegung der Anzahl der Flugzeuge. Randnummer17 Die EU-Kommission fasste den kartellrechtlich zu prüfenden Vertrag zunächst unter anderem wie folgt zusammen (Amtsblatt 2017/C 379/08): Randnummer18 "LGW: Bis zum 28. Oktober 2017 betrieb LGW im Rahmen von Wet-Lease - Vereinbarungen an A. Berlin vermietete Luftfahrzeuge für Kurzstreckenlinien nach Düsseldorf und Berlin, in erster Linie als Zubringer für Air-Berlin-Tätigkeiten. LGW soll als Zweckgesellschaft für die Fortsetzung des gegenwärtig von A. Berlin betriebenen Flugplans im Rahmen einer Wet-Lease - Vereinbarung mit der L.-Gruppe vom Dezember 2016 dienen. Vor dem Zusammenschluss soll ein Zeitnischen-Paket für die Wintersaison 2017/2018 sowie für die Sommersaison 2018 (einschließlich Zeitnischen für die Flughäfen Berlin-TXL, DUS, FRA und MUC) auf LGW zur Nutzung durch die L.-Gruppe übertragen werden." Randnummer19 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:379:FULL&from=DE) Randnummer20 Später beschrieb die EU-Kommission den Inhalt des Kaufvertrages u.a. wie folgt: Randnummer21 "(10) Prior to closing of the acquisition, A. Berlin would transfer to LGW up to [...] A320 aircraft and corresponding crew, as well as airport slots at notably Duesseldorf, Hamburg, Munich, Berlin Tegel and Zurich airports, which are further described in the next paragraph. As a result of the Transaction, L. would also acquire the aircraft, crew and airport slots that would have thus been transferred to LGW. Randnummer22 (11) The slots that would be transferred by A. Berlin to LGW are slots for the Winter 2017/18 IATA Season and the Summer 2018 IATA Season. They consist of two different groups of slots. One group is ... (the "LGW slots"). The second group is made up of some of the slots that were held by Air Berlin and used by Air Berlin (not LGW) on various routes, including in particular slots at Duesseldorf and Berlin Tegel airports, before A. Berlin ceased its operations (the "surplus slots"). Randnummer23 (12) According to L., the acquisition of LGW is designed to ensure continuity of the cooperation between A. Berlin and L. (through its subsidiaries E. and A.) under the wetlease agreement established in December 2016 (the "Roof Wetlease"). ... Randnummer24 (22) According to L., the proposed acquisition of LGW has different objectives: (i) the discontinuation of the services that LGW provided to Air Berlin and the replacement of Air Berlin by LGW in the framework of the Roof Wetlease between A. Berlin and L.; (ii) the permanent integration of the aircraft and crew deployed under the Roof Wetlease into L.; and (iii) the takeover of an additional slot package (the LGW slots and the surplus slots)“ (CELEX_32017M8633_EN) Randnummer25 Am 24.10.2017 teilte der Generalbevollmächtigte der Schuldnerin in der Sitzung des vorläufigen Gläubigerausschusses mit: "dass der letzte A. Berlin - Flug am 27.10.2017 stattfinden wird. Danach wird der Geschäftsbetrieb der KG nur noch reduziert mit Ausnahme der noch bis zum Closing fortzuführenden Wetlease-Verträge und des Overheads fortgeführt." Der Gläubigerausschuss beschloss daraufhin einstimmig "die dann vollständige Betriebseinstellung zum 31.01.2018". Randnummer26 Am 27.10.2017 endete der Sommerflugplan 2017 und fand der letzte eigenwirtschaftliche Flug der Schuldnerin statt. Am 28.10.2017 begann der Winterflugplan 2017/2018. Randnummer27 Mit E-Mail vom 30.10.2017 (Anlage K8) wandte sich die Schuldnerin an alle ihre Mitarbeiter. Darin teilte sie u.a. mit, dass die L. Group 1.300 Stellen ausschreibe. Für a.berlin Mitarbeiter gebe es ein vereinfachtes Bewerbungsverfahren: "An den Stationen Hamburg, Düsseldorf, Köln und Stuttgart wird die `E. Deutschland´ neue First Officer, Kapitäne, Flugbegleiter und Purser unter Berücksichtigung der relevanten Vorerfahrungen der a.berliner einstellen." Randnummer28 Die LGW suche zum nächstmöglichen Zeitpunkt Piloten und Flugbegleiter für die Standorte Berlin und Stuttgart. Gesucht würden Kapitäne und First Officer der A-320-Familie. Bewerben könnten sich außerdem "Ready Entry Cabin Crew Member und Ready Entry Senior Cabin Crew Member". Cabin Crew Castings fänden am 31.10.2017 und am 03.11.2017 statt. Randnummer29 Das für das Wet-Lease für die L. Group benötigte Personal bezeichnete die Schuldnerin als "kleineres Team". Dies sehe wie folgt aus: Randnummer30 "COCKPIT-BESCHÄFTIGTE: Die Piloten der Stationen Hamburg, Stuttgart und Köln sind in ihren Dienstplänen für den weiteren Flugbetrieb vorgesehen. ... Randnummer31 CABIN-BESCHÄFTIGTE: Die Cabin Crews der Stationen Hamburg, Stuttgart, Köln und Frankfurt/Main sind in ihren Dienstplänen für den weiteren Flugbetrieb vorgesehen. ... Randnummer32 BODEN-BESCHÄFTIGTE: 700 Kolleginnen und Kollegen am Boden ..." Randnummer33 Die Mitarbeiter, die nicht zum "kleineren Team" gehörten, würden ab dem 01.11.2017 freigestellt werden. Randnummer34 Am 01.11.2017 wurde über das Vermögen der Schuldnerin das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Über den 01.11.2017 hinaus erbrachte die Schuldnerin mit anfänglich noch 13 Flugzeugen nur noch Flugleistungen im Rahmen des "Wet-Lease" für E.. Dies mit fünf A320- und acht A319 - Maschinen mit den Kennzeichen D-ABNI, D-ABNN, D-ABNT, D-ABNU, D-ASTX, D-ABGH, D-ABGQ, D-ABGP, D-ABGN, D-ABGR, D-ABGJ, D-ABNH und D-ABGK. Randnummer35 Am 17.11.2017 schloss die Schuldnerin mit der PV Cockpit einen Interessenausgleich (Anlage B5). Darin heißt es u.a.: "für einen Zeitraum bis maximal 31. Januar 2108 werden voraussichtlich auf zunächst 13, ab Dezember 2017 neun im Besitz der A. Berlin LV KG [die Schuldnerin] verbleibenden Luftfahrzeugen lediglich Flüge und Dienstleistungen im Rahmen des sog. "Wet Lease" für die E. GmbH von den Stationen Hamburg, Köln und Stuttgart aus erbracht." Mit Anhörungsschreiben vom 20.11.2017 nebst Anlage (Anlage B8) hörte die Schuldnerin die Personalvertretung zur betriebsbedingten Kündigung der klägerischen Partei an. Mit Schreiben vom 28.11.2017 kündigte die Schuldnerin den Piloten und dem Bodenpersonal ohne Sonderkündigungsschutz. Am 21.12.2017 genehmigte die EU-Kommission den L.-Kaufvertrag (bezogen auf die LGW). Nach dem 31.12.2017 führte die Schuldnerin keine Wet-Lease - Flüge mehr aus. Am 09.01.2018 wurde der Verkauf der Gesellschaftsanteile der Schuldnerin an der LGW an die L.-Gesellschaft vollzogen. Am 17.01.2018 wurde der Beklagte zum Insolvenzverwalter bestellt. Im Januar 2018 wurde dem Kabinenpersonal (ohne Sonderkündigungsschutz) gekündigt. Zum 31.01.2018 erlosch das AOC der Schuldnerin. Randnummer36 Mit ihrer Klage begehrt die klägerische Partei die Feststellung der Unwirksamkeit der ausgesprochenen Kündigung. Randnummer37 Die klägerische Partei behauptet: Randnummer38 Die Schuldnerin habe das Wet-Lease - Geschäft für E. bereits ab dem 01.02.2017 aufgenommen. An den Stationen Köln, Stuttgart und Hamburg ausschließlich. Die an diesen Stationen stationierten Crew-Mitglieder seien nicht mehr auf den Strecken der Schuldnerin geflogen, sondern in einem "dedicated Einsatz" im Wet-Lease (Beweis: Anlagenkonvolut K34). Randnummer39 Noch vor dem Insolvenzantrag habe die Deutsche L. AG 15 Flugzeuge der Airbus A320 - Familie zu Eigentum erworben und diese für den vereinbarten Rahmen - Wet-Lease an die Schuldnerin zurückgeleast (Beweis: Interne Mitteilung vom 12.10.2017, Anlage K8). Randnummer40 Der am 12.10.2017 abgeschlossene L.-Kaufvertrag habe entsprechend der Erklärung der L. gegenüber der EU-Kommission auch die Vertragsabrede enthalten, Besatzungen der Schuldnerin auf die LGW zu übertragen (Anlage K11 (Pressemitteilung der EU-Kommission vom 21.12.2017)) und Anlage K12 (Entscheidung der EU-Kommission vom 21.12.2017)). Randnummer41 Die LGW habe das Wet-Lease - Geschäft der Schuldnerin für die E. GmbH übernommen. Dies von den nationalen und internationalen Flughäfen aus, an denen nach Rn. 61 Fn. 47, 48 der Entscheidung der EU-Kommission vom 21.12.2017 (Anlage K12), die L. Group von der Schuldnerin Slots erhalten habe. Randnummer42 Die LGW habe ihre Mitarbeiter unmittelbar nach dem 27.10.2017 mit einer internen Mitarbeiter-Information gemäß der Anlage K15 u.a. wie folgt informiert: Randnummer43 "... am 27.10.2017 ist ... der letzte Flug unserer Muttergesellschaft a.berlin unter eigener Flugnummer gelandet. Zum 1.11.2017 tritt die LGW in einen Wet-Lease mit unserem neuen Partner E., ... Die vollständige Eingliederung in die E. ... erfolgt dann im Januar 2018 vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe. Neben unseren 20 Q400 Maschinen werden wir ab Dez 2017 mit fünf A320 und ab Jan 2018 mit zusätzlichen acht A319 als ein bedeutendes AOC ... darstellen. ... ab Dez 2017 [werden wir] mit der Produktion auf fünf Airbus A320 starten, die wir ex TXL [Tegel] und STR [Stuttgart] bereedern werden. Diese zeitnahe Übernahme des Geschäfts mit qualifiziertem Personal ist Kernbestandteil unserer neuen Wet Lease Vereinbarung. ... Zusätzlich zu den bereits eingeführten A320 werden wir weitere acht A319 in TXL und STR in Produktion bringen. ... Eure LGW Geschäftsführung!" Randnummer44 Die LGW nutze 13 zuvor im Besitz der Schuldnerin befindliche Flugzeuge der A320 - Familie weiter. Im Einzelnen handele es sich um die oben aufgeführten, zuletzt von der Schuldnerin bis Ende Dezember im Wet-Lease für E. geflogene Flugzeuge (Beweis: Zeugnis K., (ehemaliger) Geschäftsführer LGW). Dazu habe sich die L. von der EU-Kommission genehmigen lassen, die entsprechenden Leasingverträge auf sich übertragen zu dürfen (Anlage K12 (Seite 7, Rn. 15); Anlage K13 (Seite 4, Rn. 13)). In der mündlichen Verhandlung erklärte die Klägervertreterin, dass man im Internet mithilfe der jeweiligen Flugzeug-Kennzeichen leicht die Verwendungsgeschichte eines jeden Flugzeuges ermitteln könne. Randnummer45 Da das AOC der LGW sich nicht auf A320-Flugzeuge erstreckt habe, habe die LGW mit Hilfe der Schuldnerin die Flugbetriebshandbücher („Operation Manual") der Schuldnerin übernommen und nur durch ihr Logo ersetzt (Zeugnis K.). Zudem habe die LGW Betriebsmittel wie die für Personal- Flug- und Flugzeugplanung wichtige Software „AIMS“ von der Schuldnerin übernommen (Zeugnis K.). Gleichzeitig habe die LGW ehemaliges A320-Flugpersonal der Schuldnerin angeworben (Stellenausschreibungen, Anlagen K17 - K20, ohne Datum) und übernommen (ohne Beweisantritt). Randnummer46 Ausweislich der internen Mitteilung der Schuldnerin vom 12.10.2017 (Anlage K8) habe die Deutsche L. Group sich zunächst Zugriff auf 81 im Besitz der Schuldnerin befindlicher Flugzeuge gesichert. Nach kartellrechtlichen Bedenken der EU-Kommission zuletzt effektiv auf 57 Flugzeuge. Diese dienten unter anderem der Erweiterung des Flugbetriebs unter anderem der E. GmbH oder der für die E. GmbH im Wet-Lease fliegenden Schwestergesellschaft E. Europe GmbH. Die E. Europe GmbH habe für Standorte in DUS, CGN, STR und MUC (Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart, München) unbefristete Stellen für Kapitäne und First Officer ausgeschrieben (Anlagen K9, K10 (ohne Datum; Ausdrucksdatum 11.12.2017)). Randnummer47 Die klägerische Partei rügt eine fehlende soziale Rechtfertigung der Kündigung nach § 1 Abs. 2 KSchG auf Grund eines Betriebs(teil)übergangs und auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Sozialauswahl i.S.d. § 1 Abs. 3 KSchG; eine Unwirksamkeit nach § 613a Abs. 4 BGB; eine nicht ordnungsgemäße Anhörung der Personalvertretung; eine Unwirksamkeit nach § 17 KSchG auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Massenentlassungsanzeige und eines nicht ordnungsgemäßen Konsultationsverfahrens. Auf die nähere Begründung wird verwiesen. Randnummer48 Die klägerische Partei beantragt zuletzt sinngemäß: Randnummer49 Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien nicht durch die Kündigung vom 28.11.2017 aufgelöst worden ist. Randnummer50 Der Beklagte beantragt, Randnummer51 die Klage abzuweisen. Randnummer52 Der Beklagte behauptet, dass die klägerische Partei Weisungen allein von der "Crew Planning" in der Zentrale in Berlin erhalten habe. Ausschließlich die Unternehmenszentrale in Berlin sei für den gesamten Flugbetrieb an allen Stationen europa- und weltweit zuständig gewesen. Es habe an den Stationen auch keine weisungsbefugten Funktionsträger gegeben, die den Flugverkehr hätten aufrechterhalten können (Beweis: Zeugen). Randnummer53 Der Unterschied zwischen dem „Wet-Lease“ und dem eigenwirtschaftlichen Verkehr seien lediglich die Rechnungsempfänger gewesen. Auch beim Wet-Lease seien die Flugzeuge in einem einheitlichen Flugverkehr unter Nutzung des AOC nach Maßgabe der Nominated Persons und der Personalleitung in der Zentrale der Schuldnerin betrieben worden. Die Personalplanung für das Wet-Lease sei ebenfalls zentral durch die Schuldnerin erfolgt. Piloten seien sowohl im eigenwirtschaftlichen Flugverkehr als auch "für ACMIO" geflogen, nur nicht - wenn möglich - am demselben Tag. Das Wet-Lease der Schuldnerin nach dem 27.10.2017 sei nicht "auf Dauer" angelegt gewesen. Die Schuldnerin sei "von allen Stationen" aus im Wet-Lease geflogen. Eine Beschränkung auf die Stationen Köln, Stuttgart und Hamburg sei erst im Rahmen der Abwicklung erfolgt. Weder habe es eine feste Zuordnung von Flugzeugen zum Wet-Lease, noch des Flugpersonals zu bestimmten Flugzeugen oder Flugstrecken gegeben. Randnummer54 Es sei nicht klar, ob gerade diejenigen A320, die von der Schuldnerin zum Wet-Lease eingesetzt wurden, nunmehr von der LGW betrieben würden. Wenn überhaupt, seien maximal 13 von bis zu 38 Flugzeugen der A320-Familie im Rahmen des Wet-Lease im Einsatz befindlichen Maschinen betroffen. Es seien lediglich noch vereinzelt Flüge durchgeführt worden. Die eingesetzten maximal 13 Flugzeuge seien wöchentlich reduziert worden (ab dem 28.10.2107 dreizehn A320/A319 - Flugzeuge, ab dem 25.11.2017 elf, ab Dezember 2017 sukzessive weniger und am letzten Tag des Flugverkehrs, d.h. am 31.12.2017, lediglich noch acht (Beweis: Zeugen)). Randnummer55 Der Beklagte ist der Ansicht, er habe in der Absicht einer vollständigen Betriebsstilllegung gehandelt. Die Betriebsstilllegungsabsicht sei genügend durch die Einstellung des eigenwirtschaftlichen Flugverkehrs am 27.10.2017 und des fremdwirtschaftlichen am 31.12.2017 manifestiert worden. Randnummer56 Die Schuldnerin habe lediglich einen nicht in einzelne Betriebsteile unterteilbaren einheitlichen Flugbetrieb geführt, der nur als insgesamt eigenständig bestehende Einheit habe funktionieren können. Der Flugbetrieb der Schuldnerin sei ein unteilbarer Flugbetrieb. Dies ergebe sich u.a. auch aus § 24 KSchG und aus dem TV PV. Randnummer57 Ein einzelnes Flugzeug sei kein übergangsfähiger Betriebsteil, sondern Betriebsmittel. Es fehle an einem eigenständigen Teilzweck. Es fehle auch an der Voraussetzung "auf Dauer", da die Besatzungen eines Flugzeugs ständig wechselten. Anders als bei Seeschiffen gebe es keine feste Zuordnung von Personal zu einer bestimmten Maschine. "Teilweise" hätte das Crew- und Kabinenpersonal "mehrfach täglich das Flugzeug gewechselt" und sei auf unterschiedlichen Strecken geflogen. Schon aus sicherheitstechnischen Gründen sei eine Umlaufplanung mit derselben Crew nicht möglich gewesen. Mangels Vorgesetzte vor Ort seien die einzelnen Stationen kein Betriebsteil. Ebenso wenig das organisatorisch nicht verselbständigte Roof-Wet-Lease. Das Insolvenz - Wet-Lease über den 27.10.2017 hinaus habe keine organisatorisch selbständige Teileinheit geschaffen. Es fehle u.a. die notwendige Dauerhaftigkeit. Randnummer58 Die klägerische Partei habe die primäre Darlegungs- und Beweislast für einen Betriebs(teil)übergang. Eine sekundäre des Beklagten sei mangels substantiierten Vortrags der klägerischen Partei nicht ausgelöst. Im Übrigen könne man vom Beklagten keinen Vortrag für negative Tatsachen und für nicht in seine Sphäre fallende Vorgänge verlangen. Bezeichnend könne die klägerische Partei auch keinen Erwerber für ihr konkretes Arbeitsverhältnis benennen und bleibe im Vagen. Es sei dem Beklagten weder möglich noch zumutbar, Erkundigungen einzuholen. Etwaige - bestrittene - Betriebsteilübergänge nach der Betriebsstilllegung seien weder von der Schuldnerin beabsichtigt noch für sie absehbar gewesen. Randnummer59 Hinsichtlich des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und auf die Sitzungsprotokolle verwiesen. EntscheidungsgründeDie Kündigungsschutzklage ist zulässig, jedoch unbegründet. Randnummer61 Dies, weil Randnummer62 (1.) die Begründetheit einer Kündigungsschutzklage das Bestehen des Arbeitsverhältnisses zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung voraussetzt; 1. Eine Kündigungsschutzklage ist unbegründet, wenn zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung der kündigende bisherige Arbeitgeber nicht mehr Arbeitgeber ist: "Stützt ein Arbeitnehmer eine Kündigungsschutzklage gegen einen Betriebsveräußerer allein auf die Behauptung, der Betrieb sei bereits vor der Kündigung auf einen Erwerber übergegangen, so führt dies zur Unschlüssigkeit der Klage. Ein Erfolg im Kündigungsschutzprozess setzt nämlich nach der punktuellen Streitgegenstandstheorie voraus, dass zum Zeitpunkt der Kündigung (noch) ein Arbeitsverhältnis besteht. Das gilt auch im Falle des Betriebsübergangs. Die Kündigung eines Betriebsveräußerers nach Betriebsübertragung geht damit mangels bestehendem Arbeitsverhältnis ins Leere; eine gleichwohl erhobene Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung ist aber unbegründet, denn ein Arbeitsverhältnis besteht - und zwar schon nach dem eigenen Vorbringen des gegen den Veräußerer vorgehenden Klägers - nicht mehr" (BAG [15.12.2005] - 8 AZR 202/05 - Rn. 37 m.w.N. = NZA 2006, 597 = NJW 2006, 2141 = AP Nr. 294 zu § 613a BGB = EzA § 613a BGB 2002 Nr. 45 (Druckmaschinen); vgl. schon BAG [20.03.2003] - 8 AZR 312/02 - Rn. 29 = NZA 2003, 1338 = NJW 2003, 3581 = EzA § 613a BGB 2002 Nr. 7; BAG [18.04.2002] - 8 AZR 346/01 - Rn. 32 m.w.N. = NZA 2002, 1207 = AP Nr. 232 zu § 613a BGB = EzA § 613a BGB Nr. 207; ebenso BAG [20.03.2014] - 8 AZR 1/13 - Rn. 27 m.w.N. = NJW 2014, 2604 = AP Nr. 450 zu § 613a BGB = EzA § 613a BGB 2002 Nr. 152). Randnummer64 2. Das Vorliegen des Ob und Wann eines Betriebs(teil)übergangs hängt von dem zugrunde zu legendem Sachverhalt und nicht von den Rechtsansichten der Parteien ab. Einer Klageabweisung steht nicht entgegen, dass der Beklagte die Darlegungs- und Beweislast für einen Betriebsteilübergang vor dem Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung hat (1); diesen jedoch bestreitet und die Unklarheit des Zeitpunkts des außerhalb seiner Sphäre liegenden, nur vom Gericht angenommenen Betriebsteilübergangs betont (2) und die Grundsätze des BAG zum gleichwertigen Parteivorbringen zu beachten sind (3). Randnummer65 (1) Der Beklagte ist darlegungs- und beweispflichtig dafür, dass zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung schon gar kein Arbeitsverhältnis mehr bestand (BAG [12.11.1998] - 8 AZR 282/97 - juris Rn. 25 = NJW 1999, 1131 = NZA 1999, 310 = AP Nr. 186 zu § 613a BGB = EzA § 613a BGB Nr. 170; Wemheuer, in: Gallner/Mestwerdt/Nägele, Kündigungsschutzrecht, 6. Aufl. 2018, BGB, § 613a Rn. 55). Randnummer66 (2) Auf das Bestreiten eines Betriebsteilübergangs und auf die Problematisierung des genauen Zeitpunkts des Betriebsteilübergangs durch den Beklagten kommt es nicht an. Es handelt sich um Rechtstatsachen, die weder von Einreden der Parteien noch von deren taktischen Überlegungen abhängen. Entscheidend ist, ob sich aus dem der gerichtlichen Entscheidung zugrunde zu legendem Sachverhalt ein die klägerische Partei betreffender Betriebsteilübergang vor dem 18.01.2018 ergibt oder nicht. Randnummer67 (3) Der klägerischen Partei kommen nicht die Grundsätze des "gleichwertigen Parteivorbringens" zugute. Danach kann die klägerische Partei sich das in Widerspruch zu ihrem Sachvortrag stehende Vorbringen des Beklagten wenigstens hilfsweise zu Eigen machen und ihre Klage (auch) hierauf stützen (vgl. BAG [18.04.2002] - 8 AZR 346/01 - Rn. 29 m.w.N., a.a.O.). Nach Ansicht des BAG soll ein Fall des hilfsweise Sich-zu-eigen-Machens schon immer dann - offenbar stillschweigend - vorliegen, wenn eine klägerische Partei sich nicht nur auf einen Betriebs(teil)übergang beruft, sondern die Klage auch auf andere Unwirksamkeitsgründe stützt (vgl. BAG [15.12.2005] - 8 AZR 202/05 - Rn. 38, a.a.O. (Druckmaschinen)). Aber auch wenn man dies hier zugunsten der klägerischen Partei annimmt, führt das nicht zu einem Obsiegen "auf jeden Fall": "Wenn das Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt der Kündigung nach den festgestellten Umständen allerdings tatsächlich nicht mehr besteht, ist die Kündigungsschutzklage im Ergebnis unbegründet" (BAG [15.12.2005] - 8 AZR 202/05 - Rn. 37 m.w.N., a.a.O. (Druckmaschinen)). Randnummer68 3. Auf Grund eines vorherigen Betriebsteilübergangs auf die LGW (oder auf andere Erwerberinnen) war die Schuldnerin am 18.01.2018 nicht mehr Arbeitgeberin der klägerischen Partei. Randnummer69 Dies folgt aus folgenden Voraussetzungen: Randnummer70 (1) Die von der Schuldnerin betriebene Station Stuttgart war eine dauerhafte übergangsfähige wirtschaftliche Einheit i.S.d. § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB. 3.1 Die von der Schuldnerin betriebene Station Stuttgart war eine übergangsfähige wirtschaftliche Einheit auf Dauer (ein "Betriebsteil") i.S.d. § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB schon bei der Schuldnerin. Randnummer72 Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die den Parteien bekannte Entscheidung der entscheidenden Kammer ArbG Berlin [19.07.2018] - 41 Ca 15666/17 - juris verwiesen. Randnummer73 3.2 Die ACMIO-Station Stuttgart ging entweder ganz oder zum Teil auf die LGW über. Randnummer74 Auch insofern kann zunächst auf die Ausführungen des ArbG Berlin [19.07.2018] - 41 Ca 15666/17 - juris verwiesen werden. Genügte es dort im Rahmen des § 1 KSchG festzustellen, dass der Beklagte durch seinen eigenen Vortrag selbst konkrete Anhaltspunkte für einen Betriebsteilübergang zumindest die ACMIO-Stationen betreffend vorgetragen, jedoch nicht ausgeräumt hat, ist hier darüber hinaus positiv festzustellen, dass ein Betriebsteilübergang vor dem 18.01.2018 stattfand. Randnummer75 Die Begründung erfolgt zweistufig: zunächst wird dargelegt, dass die LGW Funktionsnachfolgerin der Schuldnerin hinsichtlich eines Wet-Lease zugunsten der E. ist. Dass eine bloße Funktionsnachfolge noch keine Betriebsnachfolge ist, ändert nichts daran, dass ohne eine Funktionsnachfolge (im vorliegenden Zusammenhang) eine Betriebsnachfolge schlecht möglich erscheint. In einem zweiten Schritt ist darzulegen, dass die LGW nicht nur Funktionsnachfolgerin, sondern auch Betriebsnachfolgerin bezogen auf die ACMIO-Station Stuttgart geworden ist. Randnummer76 3.2.1 Die LGW ist Funktionsnachfolgerin der Schuldnerin bezogen auf die Station Stuttgart. Randnummer77 Vor der Insolvenzeröffnung am 01.11.2017 flog die Schuldnerin vom Flughafen Stuttgart aus mit A319/320 - Maschinen im Wet-Lease für die E., d.h. sie stellte der E. die von der Schuldnerin von Dritten „dry“ geleaste Maschinen nebst dem dazu benötigtem Flugpersonal. Die LGW flog hingegen vor der Insolvenzeröffnung im Wet-Lease für die Schuldnerin, aber nicht im Wet-Lease für E.. Das AOC der LGW beinhaltete vor dem 01.11.2017 auch nicht den Betrieb von Flugzeugen aus der A320-Familie. Randnummer78 Nach den Erklärungen der L. Group gegenüber der EU-Kommission diente der Erwerb der LGW durch L. der Sicherung der Kontinuität des Wet-Lease - Rahmenvertrages und der Ersetzung („replacement“) der Schuldnerin durch die LGW. Der Wet-Lease - Rahmenvertrag betraf die (ausschließlichen (klägerische Partei)/“reinen“ (Rahmen-Interessenausgleich)/überwiegenden (Beklagter)) ACMIO-Stationen Stuttgart, Köln, Hamburg und „gemischte“ Stationen. Im L.-Kaufvertrag verpflichtete sich die Schuldnerin, bis zum Vollzugstag am 09.01.2018 den operativen Betrieb der LGW aufrechtzuerhalten und die LGW bei der Erweiterung der AOC auf den Flugzeug-Typ Airbus A320 zu unterstützen. Randnummer79 Die Schuldnerin flog zunächst geplant maximal bis zum 31.01.2018, dann tatsächlich lediglich bis zum 31.12.2017 im Wet-Lease für E.. Randnummer80 Es wird hier als unstreitig angesehen, dass die LGW eine Erweiterung ihres AOC auf Flugzeuge der A320-Familie erlangt hat und Flugzeuge dieser Muster-Familie flog. Nicht eine Funktionsnachfolge, sondern eine Betriebsnachfolge ist im Streit. Ausweislich der Erklärung der L. gegenüber der EU-Kommission diente der L.-Kaufvertrag der Fortführung des Wet-Lease - Rahmenvertrages, d.h. die LGW sollte anstelle der Schuldnerin die Wet-Lease - Dienstleistung zugunsten der E. übernehmen. Randnummer81 Im Lichte der Klarenberg-Entscheidung des EuGH wird eine Funktionsnachfolge auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass die L. Group möglicherweise Flugzeuge der LGW teilweise anders einsetzte als zuvor die Schuldnerin. Ebenso wenig wie bei einer Betriebsnachfolge bedurfte es einer 1:1 - Funktionsnachfolge. Randnummer82 3.2.2 LGW war bezogen auf die Wet-Lease - Station Stuttgart nicht nur Funktionsnachfolgerin, sondern auch Betriebsteilnachfolgerin. Randnummer83 (1) Wesentliche Betriebsmittel eines Luftverkehrsunternehmens sind die von ihm eingesetzten Flugzeuge. Dies auch dann, wenn diese nicht im Eigentum des Unternehmens stehen, sondern lediglich geleast sind. Randnummer84 Ob darüber hinaus auch die Slots einzubeziehen sind, kann hier offenbleiben. Im Überlassungsbereich kommt den Slots keine entscheidende Bedeutung zu (vgl. schon ArbG Berlin [19.07.2018] - 41 Ca 15666/17 - juris). Die Unklarheit des Vortrags der Parteien in diesem Punkt ist daher unschädlich. Einerseits heißt es, dass es für die Flugzeug- und Arbeitnehmerüberlassung (i.w.S.) („Wet-Lease“) zugunsten der Schuldnerin für E. keiner eigenen Slots der Schuldnerin bedurfte und die LGW als reines Wet-Lease - Unternehmen der Schuldnerin ohne eigene „Streckenrechte“ agiert habe (so die klägerische Partei), andererseits soll es nach dem Bericht der EU-Kommission (zuletzt) eigene „LGW-slots“ (und zusätzliche Slots („surplus slots“)) gegeben haben. Randnummer85 (2) Keine Seite hat sich nun die Mühe gemacht, die im Internet recherchierbare Historie der einzelnen zuletzt bei der Schuldnerin im Wet-Lease für E. eingesetzten 13 A320/A319 - Flugzeuge im Einzelnen darzulegen. Die klägerische Partei hat zum Beweis lediglich das Zeugnis des (ehemaligen) Geschäftsführers der LGW angeboten. Der Beklagte bestreitet mit Nichtwissen. Er behauptet zudem, dass der L.-Kaufvertrag der Vertragspartnerin nicht vorschreibe, welche Flugzeuge die LGW bzw. L. letztlich wie einsetzt. Ein Einsatz vormaliger Wet-Lease - Flugzeuge der Schuldnerin bei der LGW werde daher bestritten. Randnummer86 (3) Eine Vernehmung des von der klägerischen Partei angebotenen Zeugen ist gleichwohl nicht notwendig: Für einen Betriebsteilübergang kommt es nicht darauf an, ob genau die Flugzeuge, die die Schuldnerin nach der Insolvenzeröffnung zuletzt im Wet-Lease für E. flog, auch von der LGW für das Wet-Lease für E. übernommen wurden. Ausreichend ist, dass die LGW mit 13 Flugzeugen der ehemaligen A. Berlin - Flotte im Wet-Lease für E. flog. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die LGW im Wet-Lease für E. mit Flugzeugen mit der Lackierung des insolventen Konkurrenten Air Berlin statt mit A320/319 - Flugzeugen der Air Berlin/E. - Insolvenz - Wet-Lease - Flotte mit der Lackierung von E. flog. Aber selbst wenn man diese im Grunde rein theoretische Möglichkeit einbezieht, schließt dies nicht einen Betriebsteilübergang aus. Es kommt für den Betriebsteilübergang nicht auf die konkrete Maschine, sondern darauf an, dass die LGW bestehende Wet-Lease - Linien der Schuldnerin mit ehemaligen Maschinen der Schuldnerin unter Ausnutzung der durch E. und der Schuldnerin geschaffenen Organisation, definiert durch die Station, dortigen Slots, korrespondierende Slots an den Zielflughäfen, die dadurch ermöglichte Linienflugplanung sowie entsprechende Flugbuchungen der Kunden der E., die davon abhängigen Umlaufplanungen der Schuldnerin für Flugzeuge und Personal über den 31.12.2017 hinaus und Hand in Hand mit der Schuldnerin die konkrete Flugzeug- und Personaleinsatzplanung der Schuldnerin jedenfalls bis zum 31.12.2017 übernommen hat. Das ist das, was hier "Flugzeug-Organisation" genannt wurde und auch „Umlauf-Organisation“ genannt werden kann. Es kommt nicht auf das individuelle Flugzeug, sondern darauf an, dass irgendein Flugzeug, das sich zuvor im Besitz der Schuldnerin als Leasingnehmerin befand, tatsächlich von der LGW wie zuvor von der Schuldnerin eingesetzt wird und dies unter Ausnutzung und Fortführung der vorherigen ACMIO-Organisation der Schuldnerin. Randnummer87 (4) Selbst wenn man die Behauptungen der klägerischen Partei bezüglich der "fliegenden" Übernahme der A. Berlin/E. - Insolvenz - Wet-Lease - Airbus-Flotte durch die LGW als streiterheblich erachtete, wären diese - zugunsten des Beklagten - nach § 138 Abs. 1, 2 ZPO unstreitig. Denn der Beklagte hätte auf den substantiierten Vortrag der klägerischen Partei substantiiert eingehen müssen. Die Vorgänge bei der LGW lagen bis zum Vollzug des L.-Kaufvertrages am 09.01.2018 im Geschäfts- und Verantwortungsbereich auch der Schuldnerin. Die LGW war bis zum 09.01.2018 Konzerntochter der Schuldnerin als Konzernmutter. Die LGW war völlig abhängig von den Entscheidungen der Schuldnerin bzw. des Sachwalters. Wenn die restliche A. Berlin/E. - Insolvenz - Wet-Lease - Airbus-Flotte von der "rechten Hand" der Schuldnerin in die "linke Hand" der Konzerntochter LGW wechselte, kann sich der Beklagte nicht formal auf das konzernrechtliche Trennungsprinzip zurückziehen. Nach dem L.-SPA hatte sich die Schuldnerin verpflichtet, dass die Insolvenz - Wet-Lease - Produktion zunächst von der Schuldnerin weiter- und im "fliegenden Wechsel" von der eigenen Konzerntochter LGW fortgeführt wurde. Die LGW hatte ersichtlich kein wirtschaftliches Eigengewicht, sondern war bloßes Faktotum der Schuldnerin als herrschender Konzernmutter. Es kann zwar real ganz anders gewesen sein. Dafür bedürfte es eines substantiierten Vortrages durch substantiierte Darlegung, welche A320 - Flugzeuge die LGW auf Ihr AOC bis zum 08.01.2108 übertragen ließ und mit welchen A320 - Flugzeugen sie bis zum 08.01.2018 unter der Ägide der Schuldnerin geflogen ist. Randnummer88 3.3 Die Übernahme der Station Stuttgart oder Teile davon durch die LGW erfolgte vor dem 18.01.2018. Randnummer89 3.3.1 Dies folgt aus den Grundsätzen zur Bestimmung des Zeitpunktes eines Betriebs(teil)übergangs: Randnummer90 Maßgeblich ist die Betriebsübergangsrichtlinie in der autonomen Auslegung durch den EuGH. Konkret ist das die Leitentscheidung "Celtec" des EuGH, der das BAG folgen muss und nachzuzeichnen versucht: "Der Übergang der Arbeitsverträge und Arbeitsverhältnisse gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 77/187 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen erfolgt notwendigerweise zu demselben Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen übergeht. Der Zeitpunkt dieses Übergangs entspricht dem Zeitpunkt, zu dem die Inhaberschaft, mit der die Verantwortung für den Betrieb der übertragenen Einheit verbunden ist, vom Veräußerer auf den Erwerber übergeht. Dies ist ein genau bestimmter Zeitpunkt, der nicht nach Gutdünken des Veräußerers oder Erwerbers auf einen anderen Zeitpunkt verlegt werden kann" (EuGH [26.05.2005] - C-478/03 - "Celtec" - juris Leitsatz und Tenor zu 1. = NZA 2005, 681 = AP Nr. 1 zu Richtlinie 77/187/EWG); folgend BAG [13.12.2007] - 8 AZR 1107/06 - Rn. 25 = AP Nr. 338 zu § 613a BGB; BAG [21.02.2008] - 8 AZR 77/07 - Rn. 19 = NZA 2008, 825 = AP Nr. 343 zu § 613a BGB (Hotel); BAG [27.10.2005] - 8 AZR 568/04 - Rn. 24 = NZA 2006, 668 = AP Nr. 292 zu § 613a BGB = EzA § 613a BGB 2002 Nr. 42). Mit anderen Worten des BAG: "Die Inhaberschaft geht dann über, wenn der neue Betriebsinhaber die wirtschaftliche Einheit nutzt und fortführt" (BAG [13.12.2007] - 8 AZR 1107/06 - Rn. 25 m.w.N., a.a.O.). "Der Betriebsübergang tritt mit dem Wechsel in der Person des Betriebsinhabers ein, also mit dem Wechsel der Person, die für den Betrieb der übertragenen Einheit als Inhaber verantwortlich ist. Verantwortlich ist die Person, die den Betrieb im eigenen Namen führt und nach außen als Betriebsinhaber auftritt (vgl. Senat 15. Dezember 2005 - 8 AZR 202/05 [... a.a.O.]). Maßgeblich ist der Zeitpunkt, in dem der neue Inhaber die Geschäftstätigkeit tatsächlich weiterführt oder wieder aufnimmt. Die bloße Möglichkeit zu einer unveränderten Fortsetzung der Betriebstätigkeit genügt für die Annahme eines Betriebsübergangs nicht. Einer besonderen Übertragung einer irgendwie gearteten Leitungsmacht bedarf es wegen des Merkmals der Fortführung des Betriebs nicht. Der bisherige Inhaber muss seine wirtschaftliche Betätigung in dem Betrieb oder Betriebsteil einstellen" (BAG [21.02.2008] - 8 AZR 77/07 - Rn. 19 = NZA 2008, 825 = AP Nr. 343 zu § 613a BGB (Hotel)). Randnummer91 Auf den Zeitpunkt des Übertragungsvertrages (Münchener Kommentar/Müller-Glöge, BGB, 6. Aufl. 2012, § 613a Rn. 59) bzw. Verpflichtungsgeschäfts (KR/Treber, 11. Aufl. 2016, § 613a BGB, Rn. 71) kommt es nicht an. Ist der Zeitpunkt der tatsächlichen Übernahme der arbeitstechnischen Organisations- und Leitungsmacht im eigenen Namen nicht exakt zu bestimmen, soll allerdings "auf das im Übernahmevertrag enthaltene Datum zurückgegriffen werden" können (so Erman/Edenfeld, BGB, 14. Aufl. 2014, § 613a Rn. 41). Randnummer92 Unerheblich ist das Ob und das Wann eines Übergangs von Eigentum (Münchener Kommentar/Müller-Glöge, a.a.O., Rn. 59 m.w.N.), das Bestehen eines Rücktrittsrechts (BAG [15.12.2005] - 8 AZR 202/05 - Rn. 51, a.a.O. (Druckmaschinen); KR/Treber, a.a.O., Rn. 58) oder die Frage, für wessen Rechnung wann ein Betrieb geführt wird (Schaub/Ahrendt, Arbeitsrechts-Handbuch, 17. Aufl. 2017, § 117 Rn. 28; Steffan, in: Ascheid/Preis/Schmidt, Kündigungsrecht, 5. Aufl. 2017, § 613a BGB Rn. 49 m.w.N.). Der bloße Gesellschafterwechsel ist kein Betriebsübergang (Steffan, a.a.O., Rn. 50 m.w.N.), entsprechend definiert der Zeitpunkt des Gesellschafterwechsels auch nicht notwendig den Zeitpunkt eines Betriebsübergangs. Randnummer93 "Erfolgt die Übernahme der Betriebsmittel in mehreren Schritten, ist der Betriebsübergang jedenfalls in dem Zeitpunkt erfolgt, in dem die wesentlichen, zur Fortführung des Betriebs erforderlichen Betriebsmittel übergegangen sind und die Entscheidung über den Betriebsübergang nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (BAG [15.12.2005] - 8 AZR 202/05 - Rn. 43 m.w.N., a.a.O. (Druckmaschinen); Schaub/Ahrendt, a.a.O., Rn. 29; KR/Treber, a.a.O., Rn. 72; Kliemt/Teusch, in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 8. Aufl. 2017, § 613a BGB Rn. 47). Anfängliche Hindernisse und Verzögerungen werden für unerheblich erachtet (vgl. Karthaus/Richter, in: Däubler/Hjort/Schubert/Wolmerath, Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2017, BGB, § 613a Rn. 90; vgl. auch Willemsen/Müller-Bonanni, in: Henssler/Willemsen/Kalb, Arbeitsrecht, 8. Aufl. 2018, BGB, § 613a Rn. 84, 86; wohl eher gegenläufig Schaub/Ahrendt, Arbeitsrechts-Handbuch, a.a.O., Rn. 29). Randnummer94 Negativ setzt ein Betriebs(teil)übergang voraus, dass der bisherige Inhaber "in rechtlich relevanter Form die Leitung des Betriebs, d.h. die Koordination sämtlicher für das Erreichen des Betriebszwecks wesentlicher Faktoren im eigenen Namen, endgültig aufgibt" (Willemsen, in: Henssler/Willemsen/Kalb, Arbeitsrecht, 8. Aufl. 2018, BGB, § 613a Rn. 53 m.w.N.) Randnummer95 3.3.2 Für den zu entscheidenden Fall bedeutet dies einen Betriebsteilübergang der Station Stuttgart (unter anderem) auf die LGW vor dem 18.01.2018: Randnummer96 3.3.2.-1 Ein Betriebsteilübergang vor dem 18.01.2018 liegt vor, obwohl der Beklagte betont, dass der Zeitpunkt eines vermeintlichen Betriebsteilübergang gänzlich unklar sei - was die Nebulosität der gerichtlichen Auffassung von einem Betriebsteilübergang unterstreiche - und obwohl die klägerische Partei ihre Ausführungen zum Betriebsteilübergang überwiegend zeitlich nicht indiziert, d.h. nicht genau vorträgt, wann genau welches Flugzeug im ehemaligen Besitz der Schuldnerin von LGW im Rahmen des Wet-Lease eingesetzt wurde. Auch die damaligen Flugpläne von E. bezogen auf die Station Stuttgart „operated by“ vormals der Schuldnerin und für die Zeit ab dem 01.01.2018 „operated by“ LGW trägt keine Seite vor. Randnummer97 3.3.2.-2 Es kommt dem Beklagten - um dessen Vorteil und damit Darlegungslast geht es hier - auch kein Anscheinsbeweis zugute. Dieser kommt zwar auch im Bereich des § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB zum Zuge (Palandt/Weidenkaff, BGB, 77. Aufl. 2018, § 613a Rn. 12 m.w.N.), nach dem BAG aber vornehmlich für die Frage der Rechtsgeschäftlichkeit (BAG [03.07.1986] - 2 AZR 68/85 - Rn. 49, 62 = NZA 1987, 123 = EzA § 613a BGB Nr. 53 = AP Nr. 53 zu § 613a BGB; BAG [02.11.1988] - 2 AZR 192/88 - juris Rn. 26). Es mag zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen sein, ihn auch bei der Beurteilung des Übertragungszeitpunktes anzuwenden (so etwa LAG Hamm [27.05.2011] - 18 Sa 1587/09 - juris Rn. 56 f.). Was aber hier fehlt, ist ein „typischer Geschehensablauf“, d.h. ein „Sachverhalt, bei dem nach der Lebenserfahrung auf die Verursachung durch ein bestimmtes Verhalten geschlossen werden kann“ (BAG [30.09.2004] - 8 AZR 462/03 - Rn. 46 = NZA 2005, 43 = AP Nr. 275 zu § 613a BGB = EzA § 613a BGB 2002 Nr. 28). Randnummer98 3.3.2.-3 Es bleiben jedoch unstreitige Hilfstatsachen (vgl. zu diesen allgemein BGH [10.01.2017] - XI ZR 365/14 - Rn. 32 = BKR 2017, 164; BAG [20.11.2003] - 8 AZR 580/02 - Rn. 29 = NZA 2004, 489), die in der Gesamtschau die Annahme der Haupttatsache "Betriebsteilübergang vor dem 18.01.2017" rechtfertigen: Randnummer99 (1) Die gegenüber der EU-Kommission von „L.“ erklärte Absicht, den Wet-Lease Rahmenvertrag statt mit der Schuldnerin mit LGW fortzuführen. Dies vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Zusammenhangs mit kontinuierlichen und fortlaufend buchbaren Linienflügen von E. von den ACMIO-Stationen aus, für deren Betrieb zur Vermeidung von Betriebsstörungen E. sorgen musste. Randnummer100 (2) Die unstreitige Beendigung des Wet-Lease durch die Schuldnerin am 31.12.2017. Randnummer101 (3) Die Erlangung eines auf A320-Maschinen erweiterten AOC´s durch die LGW vor dem 31.12.2017. Randnummer102 (4) Der geplante und tatsächliche Vollzug des L.-Kaufvertrages am 09.01.2017. Randnummer103 (5) Die interne Mitteilung der Schuldnerin vom 30.10.2017 (Anlage K8) - fast gleichlautend mit der Stellenausschreibung der LGW (Anlage K17) -, mit der die Schuldnerin ihre Mitarbeiter animierte, sich bei der LGW für die Standorte Stuttgart und Tegel als Flugpersonal zu bewerben, im Fall des Kabinenpersonals schon am 31.10.2017 in Stuttgart und am 02. oder 03.11.2017 (Anlagen K17/K8) in Berlin. Diese interne Mitteilung wurde zwar von der klägerischen Partei vorgelegt, ist jedoch unstreitig, §§ 138 Abs. 1, 2 ZPO. Der Beklagte bestreitet nur außerhalb seiner Wahrnehmung liegende Ereignisse. Die interne Mitteilung ist aber vom jetzigen Beklagtenvertreter als damaliger Vertreter des damaligen Generalbevollmächtigten mit unterschrieben. Randnummer104 (6) Die interne Mitteilung der LGW an ihre Mitarbeiter (Anlage K15) mit konkreten Angaben zur weiteren operativen Planung nach dem 27.10.2017: danach wollte LGW im Dezember 2017 mit fünf A320 - und ab Januar mit acht A319 - Maschinen im Wet-Lease für E. fliegen. Randnummer105 (a) Die Anlage K15 hat zwar die klägerische Partei nur in Kopie und ohne weiteren Beweisantritt vorgelegt. Dies ist aber unschädlich, da der Beklagte sie nicht substantiiert bestritten hat. Der Beklagte betont zwar, dass er alles bestreite, was sich nicht in seiner Wahrnehmung und in seiner Anwesenheit abgespielt habe. Dies erfasst allerdings nicht die Anlage K15. Zum einen nicht, weil unklar ist, ob der Beklagte wirklich die Echtheit der Anlage K15 bestreiten und behaupten will, dass die klägerische Partei eine gefälschte Kopie vorgelegt habe. Zum anderen nicht, weil die interne Mitteilung gemäß der Anlage K15 nicht in einem maßgeblichen normativen Sinne außerhalb der Wahrnehmung des Beklagten steht: Die Anlage K15 ist eine interne Mitteilung der LGW unmittelbar nach dem letzten eigenwirtschaftlichen Flug der Schuldnerin am 27.10.2017. Zu diesem Zeitpunkt war die LGW 100%ige Konzerntochter der Schuldnerin. Erklärungen der damaligen Konzerntochter LGW ereigneten sich deshalb im Organisations- und damit im Wahrnehmungsbereich (im normativen Sinne) der Schuldnerin/des Beklagten. Wie die fast wörtliche Übereinstimmung der Anlagen K8 und K17 belegen, war der Schuldnerin am 30.10.2017 auch ohne weiteres ein mit der LGW abgestimmtes Verhalten möglich. Der Beklagte kann sich daher hinsichtlich der Erklärungen der Geschäftsführung der LGW nicht auf ein einfaches Bestreiten mit Nichtwissen zurückziehen. Randnummer106 Der Beklagte hat die Anlage K15 nicht bestritten, weil er auf den konkreten Vortrag der klägerischen Partei, welche zuvor für die Schuldnerin geflogene Flugzeuge von der LGW übernommen nur pauschal erwidert hat. Eine Partei ist als Ausfluss ihrer Wahrheitspflicht nach § 138 Abs. 2 ZPO verpflichtet, zu einem substantiiertem Vortrag der gegnerischen Partei substantiiert Stellung zu nehmen (vgl. BAG [20.11.2003] - 8 AZR 580/02 - NZA 2004, 489 (491 f.); BGH [11.03.2010] - IX ZR 104/08 - Rn. 16 = NJW 2010, 1357 = MDR 2010, 926), so „sich die behaupteten Umstände in ihrem Wahrnehmungsbereich verwirklicht haben“ (BGH [11.03.2010] - IX ZR 104/08 - Rn. 16 = NJW 2010, 1357 = MDR 2010, 926). Die vertragsgemäße Umsetzung des L.-Kaufvertrages mit Hilfe der von der Schuldnerin abhängigen Konzerntochter, von der für die Schuldnerin und Konzernmutter Millionen Euro abhingen, lag jedoch im Wahrnehmungsbereich der Schuldnerin bzw. des sie beaufsichtigenden damaligen Sach- und jetzt Insolvenzverwalters. Randnummer107 Da der Beklagte schon die Anlage K15 nicht bestritten hat, braucht nicht erörtert zu werden, ob der umstrittenen Auffassung des BGH zu folgen ist, dass das Bestreiten eines gegnerischen Vorbringens auch dann zu beachten ist, wenn es für die Partei günstig ist (vgl. BGH [23.06.1989] - V ZR 125/88 - Rn. 16 m.w.N. zum Streitstand = NJW 1989, 2756; dem BGH folgend Zöller/Greger, ZPO, 32. Aufl. 2018, § 138 Rn. 11). Randnummer108 (b) Der internen Mitteilung der LGW gemäß Anlage K15 ist die konkrete Einsatzplanung für die zuvor von LGW nicht geflogenen A320/319 - Maschinen zu entnehmen: ab Dezember 2017 mit fünf A320 und ab Januar 2018 mit weiteren acht A319 - Flugzeugen zu fliegen. Das „ab Januar 2018“ ist dabei als „ab Beginn des Monats Januar 2018“ zu lesen, da der „operative Support“ durch die Schuldnerin (nur) bis zum Jahreswechsel 2017/18 angekündigt wird. Zugleich wird deutlich gemacht, dass es um einen nahtlosen „fliegenden Wechsel“ geht: „Diese zeitnahe Übernahme des Geschäfts mit qualifiziertem Personal ist Kernbestandteil unserer neuen Wet Lease Vereinbarung“ (Anlage K15). Randnummer109 Die operative Planung der LGW gemäß Anlage K15 entspricht genau dem Volumen, das die klägerische Partei behauptet: 13 Maschinen. Gleicht man die von der klägerischen Partei angegebenen Flugzeug-Kennzeichen mit den Angaben des Beklagten in seiner Rückgabeliste ab, handelt es sich auch um genau fünf A320 - und acht A319 - Maschinen. Randnummer110 Die in der internen Mitteilung beschriebene sukzessive Übernahme des Wet-Lease - Geschäfts der Schuldnerin korrespondiert im Übrigen auch mit der von der klägerischen Partei nicht näher bestrittenen Behauptung des Beklagten, dass die Schuldnerin nach dem 27.10.2017 das Wet-Lease für E. anfänglich mit 13, ab dem 25.11.2017 mit elf, ab Dezember sukzessive mit weniger, und zuletzt am 31.12.2017 mit acht Flugzeugen im Wet-Lease für E. geflogen sei. Randnummer111 Nach allem tragen die Parteien selbst genügend als unstreitig zu behandelnde Hilfstatsachen vor, um auf die Haupttatsache eines „Betriebsteilübergangs vor dem 18.01.2018“ zugunsten des Beklagten schließen zu können. Randnummer112 3.3.2.-4 Ein Betriebsteilübergang auf die LGW wäre auch dann nicht ausgeschlossen, wenn die LGW auf Grund eines Pilotenmangels nicht wie ursprünglich geplant mit 13 A320/A319 - Maschinen, sondern mit weniger Flugzeugen im Wet-Lease für E. fliegen konnte. Randnummer113 Dies trotz des Erfordernisses der tatsächlichen Fortführung eines Betriebsteils. Zwar verlangt der EuGH und jetzt folgend das BAG zu Recht für einen Betriebs(teil)übergang, dass nicht nur eine Fortsetzungsmöglichkeit, sondern auch eine tatsächliche Fortführung der wirtschaftlichen Einheit erfolgt (vgl. Schaub/Ahrendt, a.a.O., Rn. 27 m.w.N.). Dieses Kriterium soll verhindern, einen bloßen Erwerber von Betriebsmitteln, der mit den Betriebsmitteln den Betrieb zwar fortführen könnte, es aber nicht will und nicht tut, vor den Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs zu bewahren. Das ist aber ein anderer Fall als der hier vorsorglich mit erwogene Fall einer zwar geplanten, aber wegen eines Pilotenmangels (anfänglich) nicht wie geplant zu 100% durchführbaren tatsächlichen Betriebsfortführung. Dazu muss man sich vergegenwärtigen, dass der Wet-Lease - Betrieb der Schuldnerin nach dem 27.10.2017 sich auf nur 13 Maschinen reduziert hatte und alles darauf angelegt war, für diesen Wet-Lease - Bereich eine Erweiterung des AOC der LGW für A320 - Maschinen zu erwirken und 13 A320/A319 - Maschinen auf dem AOC der LGW eintragen zu lassen. Die etwaige Situation, dass die LGW planwidrig auf Grund eines Pilotenmangels tatsächlich nur mit weniger Maschinen fliegen konnte/kann, ist dann keine andere, als eine Betriebsführung, die auf Grund eines arbeitsmarkt-, krankheits- oder streikbedingten Personalmangels nur eingeschränkt erfolgen kann. Entsprechend werden selbst vollständige Betriebspausen von wenigen Tagen oder Wochen für unschädlich angesehen (Bayreuther, in: Dornbusch/Fischermeier/Löwisch, AR Arbeitsrecht, 8. Aufl. 2015, BGB, § 613a Rn. 21 f.; vgl. auch EuGH [07.08.2018] - C-472/16 - "Colino Sigüenza" - Rn. 42 = NZA 2018, 1123): anfängliche Betriebseinschränkungen bei anfänglicher Fortführungsabsicht sind letztlich unerheblich (vgl. Willemsen, a.a.O., Rn. 76 f. ("Vorwirkung"); KR/Treber, a.a.O., Rn. 72). Randnummer114 3.4 Ein Übergang des Arbeitsverhältnisses der klägerischen Partei vor dem 18.01.2018 wäre auch durch weitere Übergänge von Teilen der Station Stuttgart nicht ausgeschlossen. Weder durch gleichzeitige noch durch nachträgliche Betriebsteilübergänge. Randnummer115 Die klägerische Partei legt Stellenanzeigen auch der E. Europe GmbH und zwar auch für eine Stationierung am Flughafen Stuttgart vor. Die E. Europe GmbH ist ein (auch) im Wet-Lease für die E. GmbH fliegendes Unternehmen, nicht anders wie zuvor die Schuldnerin oder jetzt die LGW. Randnummer116 Das wäre eine bloße unerhebliche Funktionsnachfolge, wenn die E. Europe GmbH mit eigenen Maschinen und eigenem Personal neben der LGW einen Teil der Produktion der ehemaligen A. Berlin/E. - Wet-Lease - Operation übernommen hätte. Randnummer117 Es besteht aber hier die konkrete Möglichkeit, dass die E. Europe GmbH zuvor von der Schuldnerin geleaste - Flugzeuge - zumal wenn die L. Lessor war und/oder diese schon mit der Lackierung von E. zur Verfügung standen - für ein Wet-Lease zugunsten der E. GmbH einsetzte und dies zu einem teilweisen Betriebsteilübergang bezogen auf die Station Stuttgart auf die E. Europe GmbH geführt hat. Randnummer118 Entsprechend besteht auch die konkrete Möglichkeit, dass die deutsche E. GmbH die bei Air Berlin freigewordenen Flugzeuge, insbesondere die aus der A. Berlin/E. - Wet-Lease - Flotte, statt durch eine Wet-Leasinggeberin ganz in Eigenregie betrieben hat. Zumindest nach der internen Mitteilung der Schuldnerin (Anlage K8) suchte nicht nur die E. Europe GmbH, sondern (auch) die "E. Deutschland" Flugpersonal. Randnummer119 Die Parteien machen dazu keine Angaben, so dass der obige Indizienschluss nicht in Frage gestellt ist. Selbst wenn, wäre er nur durch eine Fallunterscheidung in Form eines Trilemmas zu ergänzen: Randnummer120 3.4.1 Entweder es hat zu keiner Zeit ein Betriebsteilübergang (und vielleicht nur eine Funktionsnachfolge) auf die weiteren Kandidaten E. GmbH und E. Europe GmbH stattgefunden. Dann bleibt es beim Betriebsteilübergang auf die LGW vor dem 18.01.2018: Randnummer121 Der LGW käme nicht die Rechtsprechung zugute, dass die Übernahme eines Betriebsteils noch nicht automatisch die Übernahme des gesamten Betriebes bedeutet bzw. hier - übertragen - die Übernahme des Teils eines Betriebsteils noch nicht die Übernahme des ganzen Betriebsteils bedeutet. Hier liegt der Fall vor, dass die LGW jedenfalls ab dem 01.01.2018 das Wet-Lease der Schuldnerin zumindest im Umfang von 13 A320 - Flugzeugen für die E. GmbH von den Stationen Stuttgart, Köln/Bonn, Hamburg übernommen hat bzw. sie hier so gestellt wird (§ 138 Abs. 2 ZPO). Darüber flog die LGW im Wet-Lease für die E. Group mit zuvor schon von der LGW betriebenen rd. 20 Q400 - Flugzeugen. Die Parteien erklären sich zwar nicht dazu, mit wie vielen A320 - Maschinen die Schuldnerin für E. vor der Insolvenzeröffnung am 01.11.2017 im Wet-Lease von diesen Stationen aus geflogen ist. Da die gemischten Stationen von den reinen ACMIO-Stationen zu trennen sein dürften, sind die 13 übernommenen A320-Flugzeuge nicht auf 33, sondern auf eine geringere Anzahl an Flugzeugen zu beziehen. Das stellt aber nicht einen Betriebsteilübergang in Frage: die Rechtsprechung zur Hauptbelegschaft passt hier nicht, da bei Übernahme von wesentlichen sächlichen Betriebsmitteln nicht nach Prozenten, sondern danach zu fragen ist, ob schon beim Arbeitgeber eine übergangsfähige organisatorische wirtschaftliche Einheit, die sich nicht nur auf die Durchführung eines einzelnen Vorhabens beschränkt, bestand und ob die nur teilweise Übernahme wesentlicher Betriebsmittel die Wahrung der Identität in Frage stellt. Man mag zwar bei einer sehr deutlichen Reduktion Identitätsfragen stellen (so BAG [26.04.2007] - 8 AZR 695/05 - Rn. 60 = ZIP 2007, 2136 = AP Nr. 4 zu § 125 InsO (Aero Lloyd/Aero Flight): Übernahme von drei von 21 Flugzeugen)). Diese Fragen sind aber nur rhetorisch, da die Identität einer Fluggesellschaft nicht von der Anzahl der von ihr geflogenen Flugzeugen abhängt. Auch wenn man dies anders sähe, ist sie jedenfalls hier zu bejahen: der Flugbetrieb von 13 von 33 Flugzeugen im Einsatz wie zuvor bei der Schuldnerin ist kein anderer wie der von 33 von 33: die Identität der übernommenen Einheit ändert sich nicht. In anderer Perspektive: die LGW bzw. die von ihr übernommene Airbus-Flotte hätte entsprechend umgekehrt keine andere Identität gehabt, wenn die LGW das Wet-Lease statt nur mit 13 mit 33 A320- zuvor von der Schuldnerin genutzter Maschinen geflogen wäre. Eine Fluggesellschaft ist keine andere, ob sie nun mit 13 oder 33 A320-Flugzeugen fliegt. Randnummer122 3.4.2 Hat neben dem Übergang auf die LGW ein weiterer Übergang eines Teils der Station Stuttgart auf eine andere Gesellschaft der E. Group stattgefunden, dann entweder vor dem 18.01.2018 oder nach dem 18.01.2018. Randnummer123 3.4.2.-1 Wenn vor dem 18.01.2018, dann wäre nicht überhaupt ein Betriebsteilübergang (siehe oben), sondern lediglich die Zuordnung des Arbeitsverhältnisses der klägerischen Partei problematisch (siehe unten). Randnummer124 3.4.2.-2 Wenn nach dem 18.01.2018 wird ein vorheriger Betriebsteilübergang auf die LGW nicht nachträglich annulliert. Den Überlegungen, einen Durchgangs-Betriebsübergang bei einer Kettenübertragung zu vermeiden (vgl. etwa Willemsen, a.a.O., Rn. 58 m.w.N.), ist entweder nicht zu folgen oder - wenn als grundsätzlicher Möglichkeit doch - sie finden jedenfalls hier keine Anwendung, da ein Direkt-Betriebsübergang zu Recht schon immer dann verneint wird, wenn der Ersterwerber "den Vorteil der konkret existierenden Betriebsorganisation jedenfalls für ein notwendiges Durchgangsstadium nutzbar machen will", wozu wenige Monate oder Tage ausreichen können (vgl. Willemsen, a.a.O., Rn. 66). Randnummer125 3.5 Das Arbeitsverhältnis der klägerischen Partei war der übergegangenen Station Stuttgart zugeordnet und selbst im Fall einer hypothetischen Betriebsteilspaltung zuordbar: Randnummer126 3.5.1 Der Stationsort der klägerischen Partei war auf ihren Wunsch hin von Berlin-Tegel nach Stuttgart verlegt worden. Die vertragliche Festlegung des Stationsortes vermittelt im Normalfall unproblematisch eine organisatorische Zuordnung des Flugpersonals zur betreffenden Station. Randnummer127 Ob und unter welchen Voraussetzungen etwas anderes gilt, wenn die „eigene“ Station stillgelegt wurde und man in einer noch betriebenen Station eingesetzt wird (vgl. zum Meinungsstand Münchener Kommentar/Müller-Glöge, a.a.O., Rn. 87 m.w.N.; Staudinger/Annuß, 2016, BGB, § 613a Rn. 146 m.w.N.), bedarf hier keiner Entscheidung, sondern betrifft möglicherweise das Kabinenpersonal in Frankfurt. Randnummer128 Die organisatorische Zuordnung des Arbeitsverhältnisses der klägerischen Partei wird auch nicht dadurch geändert oder beendet, dass die klägerische Partei sich zuletzt in Elternzeit befand (vgl. explizit für Elternzeit: Schaub/Ahrendt, a.a.O., § 118 Rn. 4; vgl. auch für Altersteilzeit: Bachner, in: Kittner/Zwanziger/Deinert/Heuschmid, Arbeitsrecht, 9. Aufl. 2017, § 97 Rn. 12; für ruhende Arbeitsverhältnisse: Breinlinger, in: Boecken/Düwell/Diller/Hanau, Arbeitsrecht, 2016, BGB § 613a Rn. 70). Wenn es seitens des BAG heißt, dass die Zuordnung bei einem Arbeitsverhältnis ohne Beschäftigungspflicht nach dem zuletzt innegehabten Arbeitsplatz erfolge (BAG [31.01.2018] - 8 AZR 27/07 - Rn. 50 = NZA 2008, 705), betrifft dies andere Fallkonstellationen als die hiesige. Hier wurde während einer möglicherweise arbeitspflichtfreien Zeit der maßgebliche Stationsort ausdrücklich einvernehmlich geändert. Randnummer129 3.5.2 Auch im Fall einer anfänglichen Betriebsteilspaltung wäre das Arbeitsverhältnis der klägerischen Partei einer Erwerbergesellschaft zuordbar: Randnummer130 Die Parteien haben nicht vorgetragen, ob die klägerische Partei beschäftigungs-/mutterschutz- oder elternzeitbedingt überhaupt tatsächlich von ihrer neuen Station Stuttgart aus gearbeitet hat. Selbst im Fall eines Übergangs der Station auf mehrere Betriebsteilerwerber und damit verbundener Zuordnungsprobleme würde der Übergang eines Arbeitsverhältnisses daran nicht scheitern: wie im Fall der Betriebsspaltung im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge i.V.m. Art. 12 GG (vgl. BAG [19.10.2017] - 8 AZR 63/16 - Rn. 46 = NJW 2018, 885 = AP Nr. 470 zu § 613a BGB (Betriebsspaltung/Wahlrecht) wäre - erst recht wegen Art. 6 GG (vgl. auch BVerfG [08.06.2016] - 1 BvR 3634/13 - Rn. 25 = NZA 2016, 939) - der klägerischen Partei im Fall einer Betriebsteilspaltung im Rahmen einer Einzelrechtsnachfolge ein Wahlrecht einzuräumen (vgl. zum Streitstand bei § 613a BGB: KR/Treber, a.a.O., Rn. 83 m.w.N.; Steffan, a.a.O., Rn. 88; Erfurter Kommentar/Preis, 18. Aufl. 2016, BGB, § 613a Rn. 72 m.w.N.; zögerlich Zwanziger, in: Däubler/Deinert/Zwanziger, KSchR, 10. Aufl. 2017, BGB, § 613a Rn. 65: "selten"). Randnummer131 3.6 Art. 6 GG steht einem Unterliegen der klägerischen Partei nicht entgegen. Anders als in der Entscheidung des BVerfG [08.06.2016] - 1 BvR 3634/13 - Rn. 25 = NZA 2016, 939 und diese exekutierend des BAG [26.01.2017] - 6 AZR 442/16 - = NZA 2017, 577 verlangt ein verfassungsrechtlich gebotener Mutter-/Elternschutz hier nicht eine Änderung des Ergebnisses durch Fiktion des maßgeblichen Zeitpunkts des Betriebsteilübergangs. Die klägerische Partei verliert zwar formal gegen die Schuldnerin, weil ihr elternzeitbedingt später als „die anderen“ Piloten und Pilotinnen gekündigt wurde. Mutter- und elternschutzrechtlich geht es aber nicht darum, ob die klägerische Partei formal gegen den Beklagten gewinnt oder verliert, sondern darum, ob der klägerischen Partei entgegen Art. 6, 12 GG der Schutz des § 613a BGB genommen wird. Die Feststellung einer Nicht-mehr-Arbeitgeber-Stellung der Schuldnerin zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung ist jedoch lediglich Konsequenz der Sachlogik des automatischen Übergangs eines Arbeitsverhältnisses auf einen Dritten im Fall eines Betriebs(teil)übergangs - letztlich zu Gunsten der klägerischen Partei. Randnummer132 4. Die Kostenentscheidung folgt aus den § 46 Abs. 2 ArbGG i.V.m. §§ 91, 269 Abs. 3 ZPO. Dabei wurde der Weiterbeschäftigungsantrag als unbedingt gestellt interpretiert. Die Festsetzung des Streitwerts im Urteil beruht auf § 46 Abs. 2 ArbGG i.V.m. § 42 Abs. 2 GKG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArbG Brandenburg, Urteil vom 15. Juli 2020 – 2 Ga 6/20 | § 32 Abs 2 RABerufsO, § 1 KSchG Verlässt ein als Außensozius auftretender Rechtsanwalt die Kanzlei und wird diese fortgeführt, handelt es sich immer um den Fall des Ausscheidens aus einer Sozietät § 32 II BORA (juris: RABerufsO), wenn dieser angestellter Anwalt war. Tenor1. Dem Antragsgegner und Verfügungsbeklagtem wird aufgegeben es zu unterlassen, Personen, die im Außenverhältnis mit dem Antragsteller in einem konkreten Mandatsverhältnis stehen, ohne Hinweis auf das diesen nach § 32 der Berufsordnung der Rechtsanwälte zustehende Wahlrecht, wer künftig nach Trennung der (Außen-) Sozietät „Fachanwaltskanzlei S.“ zum 31.07.2020 die noch laufenden Mandate des zu diesem Zeitpunkt ausscheidenden Antragstellers bearbeiten soll, hinzuweisen, anzuschreiben, anzusprechen oder in sonstiger Weise anzugehen; gegenüber Personen, die im Außenverhältnis mit dem Antragsteller in einem konkreten Mandatsverhältnis stehen, zu behaupten, der Antragsteller nehme derzeit seinen Jahresurlaub bis zum 31.07.2020, ist tatsächlich aber bereits aus der Kanzlei ausgeschieden, weshalb die weitere Vertretung des Mandanten nunmehr in Händen des Antragsgegners liege; schriftlich, in persönlichen Gesprächen oder auf sonstige Weise mit Personen, die im Außenverhältnis mit dem Antragsteller in einem konkreten Mandatsverhältnis stehen, eine Vereinbarung zu erzeugen, nach der diese Mandanten nach dem Ausscheiden des Antragstellers die Fortführung des Mandats in der Kanzlei des Antragsgegners ausdrücklich wünschen, ohne zuvor diese Personen über die ebenfalls bestehende Möglichkeit der Fortführung des Mandats durch den Antragsteller zu unterrichten 2. Dem Antragsteller und Verfügungswiderbeklagtem wird aufgegeben es zu unterlassen, an Mandanten des Antragsgegners und Verfügungsbeklagten im Zusammenhang der Beendigung der Außensozietät Schreiben mit folgenden Inhalten zu versenden: „Ohne Ihre Erklärung müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Angelegenheit vom 03. August durch Herrn Rechtsanwalt S. bearbeitet werden wird“ „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihnen durch die weitere Bearbeitung der Sache durch Herrn Rechtsanwalt V. in seiner Fachanwaltskanzlei keine zusätzlichen Kosten entstehen.“ 3. Dem Antragsgegner und Verfügungsbeklagten wird für jeden einzelnen und zukünftigen Fall der Zuwiderhandlung gegen das jeweilige Unterlassungsgebot ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 Euro angedroht. 4. Im Übrigen werden die Anträge zurückgewiesen. 5. Der Verfügungskläger trägt 85 und der Verfügungsbeklagte 15 Prozent der Kosten des Rechtsstreites. 6. Der Streitwert wird festgesetzt auf 54.000 Euro TatbestandDie Parteien streiten über die Ansprache von Mandanten aufgrund des bevorstehenden Ausscheidens des Verfügungsklägers aus dem Arbeitsverhältnis zu dem Verfügungsbeklagten.Randnummer2 Der Verfügungsbeklagte schloss mit dem Verfügungskläger am 12.06.2003 einen Arbeitsvertrag, wonach der Verfügungskläger bei dem Verfügungsbeklagten als Rechtsanwalt eingestellt wurde. Seine regelmäßige Arbeitszeit betrug bis Ende Juni 2003 30 Stunden und ab dem 01.07.2003 40 Stunden wöchentlich. Der Verfügungskläger verdiente zuletzt durchschnittlich 4.500,00 Euro brutto. Ihm wurde ein Mercedes B Klasse Fahrzeug auch zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt.Randnummer3 Der Verfügungskläger bearbeitete im Wesentlichen die verkehrsrechtlichen, sozialrechtlichen und medizinrechtlichen Mandate der Kanzlei, das heißt, er beriet die Mandanten, analysierte deren Wünsche, übernahm die außergerichtliche sowie gerichtliche Vertretung in allen Instanzen und wirkte an der Ausgestaltung von Rechtsgeschäften mit.Randnummer4 Der Verfügungsbeklagte bearbeitete vor allem Mandate im Bereich des Arbeitsrechtes und Strafrechtes.Randnummer5 Auf dem Briefkopf der Anwaltskanzlei des Verfügungsbeklagten ist oben mittig ausgeführt: „Fachanwaltskanzlei“, eine Zeile darunter der Name des Verfügungsbeklagten „S.“. Auf der rechten Seite des Briefes ist zunächst der Verfügungsbeklagte als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Fachanwalt für Strafrecht genannt, darunter der Verfügungskläger als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht, Sozialrecht und Medizinrecht. Daneben führt der Briefkopf das Sekretariat RA S. sowie das Sekretariat RA V. mit jeweils eigenständiger Durchwahl auf.Randnummer6 Ende Juni 2020 veränderte Verfügungsbeklagte den von ihm verwendeten Briefkopf dahingehend, dass hinter dem Namen des Verfügungsklägers ein Sternchen mit dem Zusatz „angestellter Anwalt“ aufgenommen wurde.Randnummer7 Mit Schreiben vom 27. Januar 2020 kündigte der Verfügungsbeklagte das Arbeitsverhältnis sowie die Vereinbarung über die Überlassung eines Firmenfahrzeuges zum 31.07.2020 (Vgl. Blatt 28 der Akte).Randnummer8 Mit Schreiben vom 26.06.2020 stellte der Verfügungsbeklagte den Verfügungskläger von der Erbringung der arbeitsvertraglichen Verpflichtungen unter Fortzahlung der Vergütung frei, nachdem der Verfügungskläger den Verfügungsbeklagten am Vortag mitgeteilt hatte, dass er sich als Rechtsanwalt beruflich selbstständig machen werde.Randnummer9 Am 29.06.2020 wandte sich der Verfügungsbeklagte (Vgl. Anlage 11, Bl. 49 f. der Akte) an einen Mandanten der Kanzlei dessen Angelegenheit zuvor durch den Verfügungskläger bearbeitet wurde und teilte diesem mit, dass das Amtsgericht Brandenburg an der Havel für den 7. Oktober 2020 um 11:30 Uhr Termin in seiner Sache anberaumt habe, weshalb er ihn um die Vereinbarung eines Besprechungstermines bitte. Darüber hinaus schrieb er:Randnummer10 „Da Rechtsanwalt V. derzeit seinen Jahresurlaub bis zum 31.07.2020 nimmt, tatsächlich aber bereits aus der Kanzlei ausgeschieden ist, liegt Ihre weitere Vertretung nunmehr in meinen Händen.Randnummer11 Als Fachanwalt für Strafrecht bin ich seit Jahrzehnten auch auf dem Gebiet des Ordnungswidrigkeitsrechts tätig; es ist mir daher ein Anliegen, Sie erfolgreich in Ihrer Angelegenheit zu verteidigen. …“Randnummer12 Auf eine mögliche Weitervertretung des durch den Verfügungskläger wies der Verfügungsbeklagte nicht hin. Der Verfügungsbeklagte sendete ähnliche Schreiben auch an die Mandanten B., R. und G..Randnummer13 Die Parteien wandten sich an die Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg, welche mit Schreiben vom – jedenfalls an den Verfügungskläger – 25.06.2020 mitteilte, dass sämtliche Mandanten über die Beendigung der Mitarbeit zu unterrichten seien. Aus § 32 Abs. 1 i.V.m. § 32 Abs. 2 BORA folge, dass beim Ausscheiden aus der Sozietät eine Befragung zur Fortsetzung des Mandats auf die Mandate des ausscheidenden (Schein-)Sozius zu beschränken sei. Nach Maßgabe von § 32 BORA solle bei der Beendigung eines gesellschaftsrechtlich zu wertenden Mitarbeiterverhältnisses die Entscheidung über die Fortsetzung (!) in die Hände der Mandanten gelegt werden. Das Schreiben enthielt weitere Hinweise zu gebührenrechtlichen Abrechnungen. Abschließend empfahl die Anwaltskammer den Parteien sich kurzfristig auf einen Rundschreibetext zu verständigen und sämtliche Mandanten von Rechtsanwalt V. anzuschreiben und auf möglichst kurzfristige Rückantwort zur Fortsetzung des Mandates zu dringen.Randnummer14 Mit der Antragsschrift übersandte der Verfügungskläger den Entwurf eines Antwortschreibens, das die PassagenRandnummer15 „Ohne Ihre Erklärung, müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Angelegenheit vom 3. August an durch Herrn Rechtsanwalt S. bearbeitet werden wird“.Randnummer16 „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihnen durch die weitere Bearbeitung in der Sache durch Herrn Rechtsanwalt V. in seiner Fachanwaltskanzlei keine zusätzlichen Kosten entstehen.“Randnummer17 Der Verfügungsbeklagte hat gegenüber dem Verfügungskläger die entsprechenden Passagen beanstandet und von diesem Unterlassung gefordert.Randnummer18 Der Verfügungskläger macht mit dem am 06.07.2020 bei Gericht eingegangenen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung geltend, dass der Verfügungsbeklagte es unterlassen solle, Mandanten, die mit dem Verfügungskläger in einem Mandatsverhältnis stünden, ohne Hinweis auf das diesen nach § 32 BORA zustehende Wahlrecht zur Fortführung des Mandates anzuschreiben. Er solle keine unwahren Behauptungen über die Urlaubsnahme bzw. das Ausscheiden des Verfügungsklägers aus der Kanzlei verbreiten und nicht die Fortführung von Mandaten ohne Hinweis auf die Möglichkeit der Fortführung des Mandates durch den Verfügungskläger erreichen.Randnummer19 Er solle Auskunft über die Personen erteilen, denen er mitgeteilt habe, dass der Verfügungskläger derzeit im Urlaub sei und bereits aus der Kanzlei ausgeschieden wäre. Schließlich seien diesen Personen auch die tatsächlichen Umstände gegenüber richtig zu stellen.Randnummer20 Darüber hinaus begehrt der Verfügungskläger Auskunft über die zu versandten Briefe, eingegangene Antworten und Übergabe derjenigen Akten, zu den Mandanten, die sich auf die nach den Anträgen formulierten Mandanteninformationen gemeldet hätten.Randnummer21 Schließlich solle der Verfügungsbeklagte eine Liste zu allen laufenden Mandaten der Rechtsanwaltskanzlei herausgeben, die Vollständigkeit der Liste an Eides statt versichern und es unterlassen, den Verfügungskläger auf den Briefköpfen als „angestellter Anwalt“ zu bezeichnen bzw. die Briefköpfe sonst vor dem 01. August 2020 zu ändern.Randnummer22 Der Verfügungskläger begehrt darüber hinaus, dass der Verfügungsbeklagte es unterlässt, auf eine etwaige Kooperation oder Zusammenarbeit mit anderen Fachanwälten für Sozialrecht bzw. Verkehrsrecht hinzuweisen.Randnummer23 Er trägt vor, dass anzunehmen sei, dass der Beklagte weitere Schreiben des Inhalts, dass der Verfügungskläger derzeit seinen Jahresurlaub bis zum 31.07.2020 nehme, tatsächlich aber bereits aus der Kanzlei ausgeschieden sei und die weitere Vertretung nunmehr in den Händen des Verfügungsbeklagten liege, verschicke.Randnummer24 Daraus ergebe sich, dass der Verfügungsbeklagte gegen die ihm aus dem Schreiben der Rechtsanwaltskammer vom 25.06.2020 bekannte berufsrechtliche Regelung des § 32 BORA verstoße und gleichzeitig unerlaubte Direktwerbung betrieben habe.Randnummer25 Zwar sei der Verfügungsbeklagte nach § 32 Abs. 3 BORA grundsätzlich berechtigt, eine Klärung herbeizuführen, von wem die Mandanten der Anwaltskanzlei zukünftig betreut werden wollten, jedoch seien die Mandanten über die Wahlmöglichkeit zwischen den Sozietätsmitgliedern und über die Folgen der Wahl zu belehren. Das heißt sie müssten über die die Entlassung des nicht gewählten Sozietätsmitglieds aus dem Mandatsvertrag unterrichtet werden.Randnummer26 Bei dem Arbeitsverhältnis habe es sich auch um eine Außensozietät gehandelt, da der Verfügungskläger von Beginn an auf dem Briefkopf der Anwaltskanzlei als gleichberechtigter Anwalt ohne einen etwaigen Zusatz - wie als angestellter Anwalt oder freier Mitarbeiter oder ähnliches - geführt worden sei.Randnummer27 Der Verfügungskläger müsse Auskunft erhalten, an wen außer den Mandanten B. und S. der Verfügungsbeklagte ähnliche Schreiben geschickt habe.Randnummer28 Für eine Nachvollziehbarkeit mache es sich auch erforderlich, dass dem Verfügungsbeklagten aufgegeben werde, Auskunft darüber zu erteilen, welche Person dem Antragsgegner auf das unter e) im Klageantrag formulierte Anschreiben wie geantwortet haben.Randnummer29 Auch bestehe insoweit Wiederholungsgefahr.Randnummer30 Auch hinsichtlich des Antrages auf Erstellung einer Liste zu allen laufenden Mandaten bestehe ein Verfügungsgrund und Anspruch.Randnummer31 So sei zu berücksichtigen, dass es sich nicht um den Fall des Ausscheidens eines Außensozius aus einer Sozietät handele, sondern um den Fall der Auflösung einer Sozietät zweier Anwälte, einer geht, der andere bleibt, das sei eine Auflösung.Randnummer32 Der Verfügungskläger könne seine Pflicht, die zugleich sein Recht sei, alle Mandanten der Kanzlei danach zu befragen, wer zukünftig die laufenden Mandate im Fall der sich jetzt auflösenden Sozietät weiter bearbeiten solle, nur dann erfüllen, wenn er die entsprechenden Daten zu den Mandanten für die entsprechende Befragung und Information erhielte. Dazu sei der Verfügungsbeklagte durch anwaltliches Berufsrecht und auch als Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis, in dem keine Regelung über ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot gelte, verpflichtet. Die Ansprüche seien auch fällig, da § 32 Abs. 1 BORA davon spreche, dass der Anspruch bei Auflösung - nach Absatz 2 BORA im Fall des Ausscheidens - gegeben sei.Randnummer33 Daraus sei zu schlussfolgern, dass es nicht etwa auf den letzten Tag des rechtlichen Bestehens der Sozietät ankäme, sondern vielmehr auf die tatsächliche Handhabung. Auch der Verfügungsbeklagte selbst weise ja in dem beanstandeten Schreiben darauf hin, dass der Verfügungskläger bereits aus der Sozietät ausgeschieden sei.Randnummer34 Schließlich sei der Verfügungskläger auf den Briefköpfen der Kanzlei ohne den Sternchenzusatz als „angestellter Anwalt“ aufzuführen.Randnummer35 So regele § 2 S. 2 des Arbeitsvertrages, dass der Antragsteller als Rechtsanwalt eingestellt werde und die Bezeichnung der Zulassung führe und nach diesem Zeitpunkt auch auf dem Briefkopf geführt werde. Daraus ergebe sich, dass beide Parteien mit der Regelung verbunden hätten, dass der Verfügungskläger auf dem Briefkopf als Scheinsozius und ohne jeden Hinweis auf ein Anstellungsverhältnis geführt werde. Dies sei tatsächlich auch 17 Jahre lang gelebt worden. Auch habe der Verfügungskläger eine eigene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abschließen müssen.Randnummer36 Da der Verfügungsbeklagte im Schreiben vom 01.07.2020 an den Verfügungskläger jedoch diesen Sternchenzusatz aufnahm, muss die Veränderung ohne entsprechende Vereinbarung mit dem Verfügungskläger erfolgt sein.Randnummer37 Da der Verfügungsbeklagte den Verfügungskläger mit Schreiben vom 13.07.2020, dass er gegebenenfalls seine Mandanten auf die Möglichkeit der Vertretung durch Kooperationsanwälte im Bereich Verkehrsrecht und Sozialrecht hinweisen werde, habe der Verfügungskläger auch einen entsprechenden Unterlassungsanspruch, da ein solcher Hinweis den Vorgaben über die Benachrichtigung von Mandanten bei der Auflösung einer Sozietät oder bei Ausscheiden eines Gesellschafters gemäß § 32 Abs. 1 und 2 BORA widerspreche.Randnummer38 Werbung sei einem Rechtsanwalt nur erlaubt, soweit sie über die berufliche Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet und nicht auf die Erteilung eines Auftrags im Einzelfall gerichtet sei. Ein Hinweis auf eine Kooperation stelle jedoch Werbung dahingehend dar, dass die bisher vom Verfügungskläger in Sozietät mit dem Verfügungsbeklagten bearbeiteten konkreten Mandate allein auf die Anwälte B. und/oder G. übergehen sollten.Randnummer39 Er beantragt:Randnummer40 1. Dem Antragsgegner im Wege der einstweiligen Verfügung vorläufig aufzugeben:Randnummer41 a) es zu unterlassen, zum Zwecke der beabsichtigten Fortführung einzelfallbezogener Mandate solche Personen, die im Außenverhältnis (auch) mit dem Antragsteller in einem konkreten Mandatsverhältnis stehen, ohne Hinweis auf das diesen nach § 32 der Berufsordnung der Rechtsanwälte zustehende Wahlrecht, wer künftig nach Trennung der (Außen-) Sozietät „Fachanwaltskanzlei S.“ zum 31.07.2020 die noch laufenden Mandate des zu diesem Zeitpunkt ausscheidenden Antragstellers bearbeiten soll, hinzuweisen, anzuschreiben, anzusprechen oder in sonstiger Weise anzugehen;Randnummer42 b) es zu unterlassen, gegenüber Personen, die im Außenverhältnis (auch) mit dem Antragsteller in einem konkreten Mandatsverhältnis stehen, zu behaupten, der Antragsteller nehme derzeit seinen Jahresurlaub bis zum 31.07.2020, ist tatsächlich aber bereits aus der Kanzlei ausgeschieden, weshalb die weitere Vertretung des Mandanten nunmehr in Händen des Antragsgegners liege;Randnummer43 c) es zu unterlassen, schriftlich in persönlichen Gesprächen oder auf sonstige Weise mit Personen, die im Außenverhältnis (auch) mit dem Antragsteller in einem konkreten Mandatsverhältnis stehen, eine Vereinbarung zu erzeugen, nach der diese Mandanten nach dem Ausscheiden des Antragstellers die Fortführung des Mandats in der Kanzlei des Antragsgegners ausdrücklich wünschen, ohne zuvor diese Personen über die ebenfalls bestehende Möglichkeit der Fortführung des Mandats durch den Antragsteller statt des Antragsgegner keine zusätzlichen Kosten entstehen, die nicht auch bei Fortführung des Mandats durch den Antragsteller ebenfalls entstehen würden;Randnummer44 d) dem Antragsteller Auskunft unter Benennung von Vorname und Name, postalischer Anschrift mit Straße und Hausnummer sowie Postleitzahl und Ort, e-mail-Adresse (soweit bekannt), Telefonnummer, Name und Anschrift des Gegners, bisheriges Kanzlei-Aktenzeichen sowie, soweit vorhanden, dem behördlichen bzw. gerichtlichen Aktenzeichen darüber zu erteilen, welchen Personen, die im Außenverhältnis (auch) mit dem Antragsteller in einem konkreten Mandatsverhältnis stehen, er seit dem 25.06.2020 bereits schriftlich oder auf sonstige Weise mitgeteilt hat, der Antragsteller nehme derzeit seinen Jahresurlaub bis zum 31.07.2020, ist tatsächlich aber bereits aus der Kanzlei ausgeschieden, weshalb die weitere Vertretung des Mandanten nunmehr in Händen des Antragsgegners liege.Randnummer45 e) den Personen, die im Außenverhältnis (auch) mit dem Antragsteller in einem laufenden Mandatsverhältnis stehen und welchen er seit dem 25.06.2020 schriftlich oder auf sonstige Weise mitgeteilt hat, der Antragsteller nehme derzeit seinen Jahresurlaub bis zum 31.07.2020, ist tatsächlich aber bereits aus der Kanzlei ausgeschieden, weshalb die weitere Vertretung des Mandaten nunmehr in Händen des Antragsgegners liege, bis zum 21.07.2020 erneut schriftlich Auskunft zu erteilen, und zwar mit folgendem Inhalt:Randnummer46
f) dem Antragsteller bis zum 31.07.2020 Auskunft darüber zu erteilen, welche Personen dem Antragsgegner auf die unter e) formulierte Mandanteninformation geantwortet haben, und zwar durch Herausgabe an den Antragsteller zumindest von Abschriften dieser Antwortschreiben;Randnummer48 g) dem Antragsteller bis zum 03.08.2020 zumindest diejenigen Akten zu übergeben, zu Mandanten, in denen sich die jeweiligen Mandanten auf die unter e) formulierte Mandanteninformation für eine Fortführung der Bearbeitung durch den Antragsteller entschieden oder wenn sie nicht darauf geantwortet, der Antragsteller bisher der sachbearbeitende Rechtsanwalt war;Randnummer49 h) dem Antragsteller eine digitale Liste in Form einer Excel-Tabelle, hilfsweise die in Form einer gedruckten Papiertabelle, zu allen laufenden Mandaten der (Außen-) Sozietät „Fachanwaltskanzlei S.“ heraus zu geben und zwar mit:Randnummer50
Randnummer51 und die Vollständigkeit dieser Liste an Eides statt zu versichern;Randnummer52 i) den Antragsteller im Briefkopf der „Fachanwaltskanzlei S. bis zum 31.07.2020 (einschließlich) wieder ohne durch Sternchenzeichen als „angestellter Anwalt“ aufzuführen;Randnummer53 j) es bis zum Ablauf des 31.07.2020 zu unterlassen, den Briefbogen der „Fachanwaltskanzlei S.“ dahingehend zu ändern, dass der Antragsteller darin als „angestellter Anwalt“ aufgeführt wird.Randnummer54 2. Bei den Unterlassungsanträgen zu 1.) Buchstabe a), b), c) und j) wird dem Antragsgegner für jeden einzelnen und zukünftigen Fall der Zuwiderhandlung gegen das jeweilige Unterlassungsgebot ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 Euro oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, Ordnungshaft auch für den Fall, dass Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann, angedroht.Randnummer55 3. Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Verfügung vorläufig aufgegeben,Randnummer56 Es zu unterlassen, solchen Personen, die im Außenverhältnis (auch) mit dem Antragsteller in einem konkreten Mandatsverhältnis stehen, eine Unterrichtung zu erteilen, ganz gleich ob in Schriftform, in Textform, fernmündlich oder unmittelbar persönlich, mit dem Hinweis auf die Möglichkeit der Vertretung im Verkehrsrecht durch den zukünftigen Kooperationspartner Herrn Rechtsanwalt B. und/oder im Sozialrecht durch die zukünftige Kooperationspartnerin Frau Rechtsanwältin G..Randnummer57 Der Verfügungsbeklagte beantragt,Randnummer58 den Antrag abzuweisen sowie widerklagend:Randnummer59 Dem Antragsgegner wird aufgegeben es zu unterlassen, an Mandanten der Kanzlei S. im Zusammenhang der Beendigung der Außensozietät Schreiben mit folgenden Inhalten zu versenden:Randnummer60 „Ohne Ihre Erklärung müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Angelegenheit vom 03. August durch Herrn Rechtsanwalt S. bearbeitet werden wird“Randnummer61 „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihnen durch die weitere Bearbeitung der Sache durch Herrn Rechtsanwalt V. in seiner Fachanwaltskanzlei keine zusätzlichen Kosten entstehen.“Randnummer62 Der Verfügungsbeklagte beantragt,Randnummer63 ihm Vollstreckungsschutz nach § 712 Abs. 12 S. 1 ZPO zu gewähren.Randnummer64 Der Verfügungskläger beantragt,Randnummer65 die Widerklage zurückzuweisen.Randnummer66 Der Verfügungsbeklagte trägt vor, dass der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bereits unzulässig sei, da es an der gesetzlich vorgesehenen Glaubhaftmachung fehle. Er sei darüber hinaus unbegründet.Randnummer67 So sei für den Verfügungsbeklagten noch nicht einmal sicher, dass der Verfügungskläger tatsächlich zum 1. August 2020 eine Rechtsanwaltskanzlei eröffnen werde. Bislang habe er dies lediglich angekündigt. Er sei von dem Verfügungskläger auch nicht aufgefordert worden, die Daten der von ihm bearbeiteten Mandate herauszugeben, damit jener diese anschreiben könne. Er habe auch nicht angekündigt, die Herausgabe von ihm bearbeiteter Akte zu verlangen.Randnummer68 Daher sei es treuwidrig, wenn sich der Verfügungskläger auf das Bestehen einer Außensozietät berufe, wofür er sich auch nicht auf den Inhalt des Zwischenzeugnisses vom 04.03.2020 berufen könne, da der Verfügungskläger dies vorformuliert und er nur unterzeichnet habe.Randnummer69 Die drei von dem Verfügungskläger geführten Fachdezernate hätten in 2019 zu einem Fehlbetrag der Kanzlei in Höhe von 30.000,00 Euro für diese Dezernate geführt, weswegen es dem Verfügungskläger auch nach dem Grundsatz des venire contra factum proprium bzw. Treu und Glauben versagt sei, auf einem Status als Angestellter zu bestehen, auf der anderen Seite sich auf den Status einer Außensozietät zu berufen, um die laufenden Akten ohne Ausgleichszahlungen mitzunehmen, um sich beruflich selbstständig zu machen.Randnummer70 Aber selbst wenn man eine Außensozietät annehmen wollte, habe der Verfügungskläger keinen Anspruch darauf, auf den Briefköpfen der Kanzlei nicht als angestellter Anwalt bezeichnet zu werden, da er genau dies sei.Randnummer71 Auch habe er keinen Anspruch auf Herausgabe einer Liste über alle von der Kanzlei geführten Mandate, da dies zum Einen nicht fällig sei, da das Arbeitsverhältnis bis zum 31.07.2020 fortbestehe, zum Anderen fehle es an einem Rechtsschutzinteresse, erst recht an einem Verfügungsgrund auf Herausgabe. Eine Stattgabe werde im Übrigen die Hauptsache, die noch nicht einmal anhängig sei, vorwegnehmen.Randnummer72 Schließlich könne er auch keine weiteren Auskünfte erteilen. Hinsichtlich des beanstandeten Briefes habe er lediglich an die Mandanten B., R., G. und S. in den benannten Bußgeldverfahren entsprechende Mitteilungen gemacht.Randnummer73 Darüber hinaus fehle es an einem Verfügungsgrund. Eine Stattgabe würde im Übrigen die Hauptsache vorwegnehmen.Randnummer74 Soweit das Gericht von dem Vorliegen der Voraussetzungen nach § 32 BORA ausgehen sollte, werde er weder schriftlich, in persönlichen Gesprächen oder auf sonstige Weise, mit Personen, die im Außenverhältnis mit dem Antragsteller einen konkreten Mandantenverhältnis stünden, Vereinbarungen erzeugen, nach der diese Mandanten nach dem Ausscheiden des Verfügungsklägers die Fortführung des Mandats in der Kanzlei des Verfügungsbeklagten ausdrücklich wünschen, ohne zuvor über die ebenfalls bestehende Möglichkeit der Fortführung des Mandats durch den Verfügungskläger aufzuklären, verbunden mit dem Hinweis, dass er auch bei Fortführung des Mandats durch den Verfügungskläger statt des Verfügungsbeklagten keine zusätzlichen Kosten entstünden, die nicht auch bei Fortführung des Mandats durch den Verfügungsbeklagten entstünden.Randnummer75 Ebenso werde er dem Verfügungskläger diejenigen Akten herausgeben, zu denen sich die jeweiligen Mandanten des Verfügungsklägers auf eine zulässige Mandanteninformation hin für eine Fortführung der Bearbeitung durch den Verfügungskläger entscheiden würden.Randnummer76 Hinsichtlich der Widerklage trägt der Verfügungsbeklagte vor, dass die von dem Verfügungskläger angekündigte Informationen an die Mandanten, dass sie damit rechnen müssten, dass die Angelegenheit durch den Verfügungsbeklagten bearbeitet werden würde, despektierlich und irreführend sei. Auch der Kostenhinweis sei irreführend.Randnummer77 Das Gericht hat – zunächst fernmündlich – von dem Verfügungsbeklagten die Zusage erhalten, bis zu einer Entscheidung in der Sache die von dem Verfügungskläger gerügten konkreten Briefpassagen über die Fortführung von Mandanten nicht mehr zu erklären.Randnummer78 Hinsichtlich des weiteren Vorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze, den Inhalt der Akte und die Ausführungen der Parteien in der mündlichen Verhandlungen Bezug genommen, die sämtlich Gegenstand der Erörterung waren. EntscheidungsgründeDer zulässige Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist nur in dem tenorierten Umfang begründet.Randnummer80 Zunächst soll ausgeführt sein, dass zwischen den Parteien eine (Außen-)Sozietät bestanden hat, so dass, auch soweit die Parteien als Rechtsanwälte im Arbeitsverhältnis verbunden waren/sind, § 32 der Berufsordnung für Rechtsanwälte anzuwenden ist.Randnummer81 So bestimmt § 32 Abs. 3 BORA, dass Absätze 1 und 2 entsprechend gelten, soweit Anwälte eine berufliche Zusammenarbeit in sonstiger Weise beenden, wenn diese nach außen als Sozietät hervorgetreten ist.Randnummer82 Um eine sogenannten Außensozietät handelt es sich immer dann, wenn Rechtsanwälte sich, auf welche Art und Weise auch immer, zusammenschließen und nach außen hin gemeinschaftlich auftreten. Dazu ist es auch nicht erforderlich, dass die Mandate mit Wirkung für und gegen jeden (Außen-)Sozius angenommen werden.Randnummer83 Allerdings haftet jeder Rechtsanwalt aus Rechtsscheingesichtspunkten so, als bestünde eine echte Sozietät (BGH, NJW 2011, 3818). Deswegen haben die Parteien auch in dem Arbeitsvertrag geregelt, dass der Verfügungskläger eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen soll.Randnummer84 Nach ganz allgemeiner Meinung gilt dies auch für den Fall, dass die auf den Briefbögen erscheinenden Außensozien in Wirklichkeit angestellte oder freie Mitarbeiter des Kanzleiinhabers sind, dem die Mandate im Innenverhältnis allein zuzurechnen sind (Römermann in Beck-OK BORA, 28. Edition Stand 1.6.2019, RdNr. 49).Randnummer85 Völlig unzweifelhaft sind die Parteien demnach nach außen hin als Sozien der Rechtsanwaltskanzlei S. aufgetreten.Randnummer86 Daran ändert auch nichts, dass die Kanzlei nach dem Verfügungsbeklagten Inhaber und Arbeitgeber des Verfügungsklägers benannt ist. Beide Rechtsanwälte sind auf dem Briefkopf der Anwaltskanzlei und auch bei sonstigen Auftritten wie etwa Internetauftritt, Kanzleischild oder ähnliches als Rechtsanwälte benannt. Für den außenstehenden Dritten, der ein Mandatsverhältnis begründen will, ist nicht erkennbar, dass der Verfügungskläger angestellter Anwalt ist, so dass nach außen hin der Rechtsschein eines Sozius gesetzt ist. Alleine darauf kommt es an.Randnummer87 Die Kammer geht weiter davon aus, dass es sich bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses zum 31.07.2020 um einen Fall des Ausscheidens eines (Außen-)Sozius aus der Sozietät handelt (§ 32 Abs. 2 BORA) und nicht um den Fall der Auflösung einer Sozietät.Randnummer88 Dem Verfügungskläger ist auch nicht, wie der Verfügungsbeklagte meint, verwehrt sich hierauf aus Treu und Glauben oder dem Grundsatz des venira contra factum proprium zu berufen. So oblag es dem Verfügungsbeklagten, bei der Einstellung des Verfügungsklägers bzw. gegebenenfalls auch im Laufe des Arbeitsverhältnisses, durch einen Zusatz auf dem Briefkopf oder bei anderen werbenden Gelegenheiten wie Kanzleischild, Internetauftritt oder ähnlichem darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Verfügungskläger nicht um einen Sozius der Kanzlei, sondern um einen angestellten Rechtsanwalt handelt. Es hätte dem Verfügungsbeklagten sogar freigestanden, die arbeitsvertraglichen Bedingungen so zu gestalten, dass der Verfügungskläger gar nicht nach außen hin in Erscheinung tritt, damit hätte er die Rechtsfolgen des damals schon geltenden § 32 Abs. 3 BORA bzw. der im wesentlich gleich lautenden Vorgängervorschriften vermeiden können, so er es denn gewollt hätte.Randnummer89 Im Übrigen ist auch nicht erkennbar, inwieweit der Verfügungskläger sich hier widersprüchlich verhalten haben sollte. So ist der Briefkopf nicht etwa durch den Verfügungskläger gestaltet, sondern von dem Verfügungsbeklagten als Arbeitgeber und Inhaber der Kanzlei vorgegeben.Randnummer90 Dass der Verfügungskläger sich nicht an Verlusten bzw. Gewinnen der Kanzlei oder auch nur der von ihm bearbeiteten Mandate beteiligt, liegt ausschließlich an den gemeinsamen Vereinbarungen der Arbeitsvertragsparteien, die ein festes Gehalt sowie die Stellung eines Dienstwagens, nicht etwa aber eine prozentuale Beteiligung an den Umsätzen, Gewinnen oder ähnlichem vorsehen. Soweit aber der Verfügungsbeklagte mit dem Verfügungskläger diese Vereinbarungen getroffen hat und gleichzeitig die Parteien als Sozien nach außen hin auftreten, verhält sich nicht der Verfügungskläger widersprüchlich, sondern beide Parteien vertragstreu.Randnummer91 Die Kammer geht weiter davon aus, dass es sich bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses zum 31.07.2020 um einen Fall des Ausscheidens aus einer Sozietät (§ 32 Abs. 2 BORA) und nicht um die Auflösung der Sozietät selbst handelt.Randnummer92 Zwar waren vorliegend lediglich zwei Rechtsanwälte nach außen hin als Sozien aufgetreten, so dass es nahe läge, eine irgendwie geartete Trennung derselben als Auflösung der (gemeinsamen) Sozietät anzusehen, jedoch kann dies im vorliegenden Falle, in dem der alleinige Inhaber der Firma und nach außen hin auftretenden Sozietät von Rechtsanwälten seine Firma fortführt und der Arbeitnehmer den Betrieb der ansonsten unverändert fortgeführt wird, verlässt, nicht angenommen werden.Randnummer93 Dafür spricht zunächst, dass die Berufsordnung für Rechtsanwälte in § 32 Abs. 3 jede Art der sonstigen Zusammenarbeit von Anwälten und deren Beendigung regelt. Grundsätzlich können damit gemeint sein, das Auflösen von BGB-Gesellschaften, Änderungen nach GmbH-Recht, Umwandlungen, Beendigung freier Mitarbeit, Auflösung von Arbeitsverhältnissen oder ähnlichem. Daraus ergibt sich, dass § 32 Abs. 3 BORA insoweit nicht differenziert und lediglich die entsprechende Anwendung der Absätze 1 und 2 anordnet. Daraus ist zu folgern, dass jeder dieser Fälle nach seinem Sinn und Zweck überprüft werden muss. ob er als Auflösung oder Ausscheiden anzusehen ist.Randnummer94 Soweit (Außen-)Sozietäten aus mehr als nur zwei Personen bestehen, und nur eine Person die Sozietät verlässt, dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass es sich um ein Ausscheiden und nicht um die Auflösung der Sozietät handelt.Randnummer95 Das Arbeitsverhältnis mit lediglich einem angestellten Anwalt stellt sich für den Fall der Fortführung des Betriebes immer und grundsätzlich als Ausscheiden nur des einen Rechtsanwaltes dar, soweit dessen Arbeitsverhältnis beendet wird.Randnummer96 Dies schon deswegen, da, der als Arbeitgeber tätige Rechtsanwalt das gesamte betriebliche Risiko alleine trägt, so hat er die Geschäftsräume angemietet, die weiteren Arbeitsverhältnisse begründet, die Arbeitsmittel angeschafft. Diese sind, soweit der Betrieb fortgeführt wird, von ihm und nicht dem aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidende Sozius auch weiter zu bedienen. Das Mietverhältnis ist fortzusetzen, die Mietverträge und vor allen Dingen die Mietzahlungen sind zu leisten, die Arbeitsmittel bleiben im Eigentum des Arbeitgebers. Gegebenenfalls muss er diese ersetzen, neue anschaffen. Er muss auch die weiteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergüten. Diese sind nur ihm gegenüber zur Arbeit verpflichtet.Randnummer97 Damit besteht auch nach außen hin der Schein, dass die Sozietät zwischen den Rechtsanwälten nunmehr nur von dem als Arbeitgeber fungierendem Rechtsanwalt fortgesetzt wird.Randnummer98 Nach außen hin erscheint es, soweit sich der angestellte Anwalt nun unter zwangsläufig anderer Anschrift und anderem Kanzleinamen selbstständig macht, als wenn dieser die bestehende Sozietät verlassen hätte und damit ausgeschieden ist.Randnummer99 Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn auch der Arbeitgeber-Rechtsanwalt – den Betrieb nicht fortsetzt und seinerseits durch Änderung des Kanzleinamens, Beendigung des Betriebs und gegebenenfalls Gründung eines anderen Betriebes – etwa unter neuer Anschrift – die Sozietät beendet.Randnummer100 Das ist aber nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien nicht der Fall. Der Verfügungsbeklagte wird und will den Betrieb der unter „Fachanwaltskanzlei S.“ firmiert, am gleichen Ort, in gleicher Weise fortführen, mit Ausnahme dessen, dass der Verfügungskläger nicht mehr als Arbeitnehmer für den Verfügungsbeklagten tätig ist.Randnummer101 Dem entsprechend ist es Recht und Pflicht der Parteien, die Mandanten, die der Verfügungskläger mit deren Angelegenheiten laufend oder im Zeitpunkt seines Ausscheidens befasst war, oder für die er vor seinem Ausscheiden regelmäßig tätig war, darüber zu befragen, wer künftig die laufenden Sachen bearbeiten solle. Dazu sollen sich die Parteien über die Art der Befragung einigen. Soweit keine Einigung, die bis zum 31.07.2020 zwischen den Parteien gegebenenfalls noch erzielt werden kann, erfolgt, darf jede der Parteien einseitig die Entscheidung der Mandanten einholen.Randnummer102 Darüber hinaus kann der Verfügungskläger am bisherigen Kanzleisitz und auf der Internetseite der Sozietät einen Hinweis auf seinen Umzug für ein Jahr anbringen. Der Verfügungsbeklagte wird während dieser Zeit auf Anfrage die neue Kanzleiadresse, Telefon- und Faxnummer des Verfügungsklägers bekannt geben müssen.Randnummer103 Dem entsprechend war der Verfügungsbeklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, Mandanten, deren Angelegenheiten bislang von dem Verfügungskläger bearbeitet worden sind, unter Hinweis auf dessen Ausscheiden anzuschreiben, dass er nunmehr die Bearbeitung der Sache übernommen hat.Randnummer104 Zum Einen ist der Verfügungskläger noch nicht aus der Kanzlei und damit Außen-Sozietät ausgeschieden, das Arbeitsverhältnis endet erst am 31.07.2020, und nur hierauf kommt es an. Zum Anderen sind gerade diese Mandanten darüber zu befragen, wer künftig die laufende Sache bearbeiten möge.Randnummer105 Da der Verfügungsbeklagte jedoch mehrere Mandanten in dieser Art anschrieb, steht zu befürchten, dass er dieses auch weiterhin tun wird. Er hat dieses zu unterlassen.Randnummer106 Er darf auch nicht eine Vereinbarung mit solchen Mandanten erzeugen, dass er das Mandat fortführt, ohne zuvor auf die bestehende Möglichkeit der Fortführung des Mandates durch den Verfügungskläger zu unterrichten, da dies in gleichem Maße gegen die Verpflichtung nach § 32 Abs. 3 i.V.m. 2 BORA verstoßen würde, laufenden Mandate, die von dem Verfügungskläger betreut worden sind, über die Fortführung des Mandates zu befragen.Randnummer107 Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist jedoch in den weiteren Fällen unbegründet.Randnummer108 So muss zwar der Verfügungsbeklagte es unterlassen, zu versuchen eine Vereinbarung zu erzeugen, mit solchen Personen, die zu dem Verfügungskläger in einem Mandatsverhältnis stehen bzw. standen, jedoch muss, soweit diesen Personen entsprechend § 32 Abs. 1 BORA über die Fortführung des Mandats befragt wurden, kein Hinweis gegeben werden, dass auch bei Fortführung des Mandates durch den Verfügungskläger statt des Verfügungsbeklagten keine zusätzlichen Kosten entstünden, die nicht auch bei Fortführung des Mandates durch den Verfügungskläger ebenfalls entstehen würden.Randnummer109 Zwar mag es zweckmäßig sein, die Mandanten auch über die verschiedenen Kostenfolgen bei der Fortführung des Mandates oder aber der Beendigung eines Mandates und der Begründung eines neuen Mandates zu unterrichten, jedoch ergibt sich die Pflicht zur Verwendung einer solch konkreten Formulierung, wie sie von dem Verfügungskläger verlangt wird, nicht aus der Vorschrift.Randnummer110 So führt Römermann im Beck-OK BORA, § 32 RdNr. 36 aus, dass, soweit ein Rechtsanwalt einseitig die Entscheidung eines Mandanten einholt, die Frage reichen wird, ob das Mandat von ihm fortgeführt werden soll. Zweckmäßig – und die Kammer würde dies in jedem Fall empfehlen – ist eine entsprechende Erläuterung auch hinsichtlich der Kosten, vorgeschrieben ist diese jedoch nicht.Randnummer111 Soweit der Verfügungskläger Auskunft verlangt, welche Mandanten der Verfügungsbeklagte in der Art angeschrieben hat, dass er ihnen mitteilte, dass der Kläger seinen Jahresurlaub nehme, tatsächlich aber bereits aus der Kanzlei ausgeschieden sei, weshalb die weitere Vertretung des Mandanten nunmehr in seinen Händen liege, ist der entsprechende Auskunftsanspruch durch Benennung der Mandantennamen bereits erfüllt.Randnummer112 Der Verfügungskläger hat keinen Anspruch darauf, dass ihm neben dem Namen, die postalische Anschrift mit Straße und Hausnummer sowie Postleitzahl und Ort, E-Mail-Adresse, soweit bekannt, Telefonnummer, Name und Anschrift des Gegners, bisheriges Kanzleiaktenzeichen sowie, soweit vorhanden, die behördlichen bzw. gerichtlichen Aktenzeichen darüber, etc., mitgeteilt werden, da er diese Informationen aus der laufenden Bearbeitung der Mandate ohnehin kennt, so dass nicht ersichtlich ist, aus welchen Gründen die Auskunft sozusagen doppelt erteilt werden müsste. Im Übrigen könnte eine etwaig im Rahmen der einstweiligen Verfügung erteilte Auskunft nicht rückgängig gemacht werden. Ein etwaiger Anspruch ist ausreichend durch korrespondierende Schadensersatzansprüche gesichert.Randnummer113 Der Verfügungskläger hat auch keinen Anspruch darauf, dass der Verfügungsbeklagte die von ihm unterrichteten Mandanten, dass der Verfügungskläger aus der Kanzlei ausscheide etc., mit dem vom Verfügungskläger vorgegebenen Inhalt neu unterrichtet. Zum Einen haben – wie oben ausgeführt – die Parteien zunächst die Pflicht, sich auf eine gemeinsame Unterrichtung der Mandanten zu einigen, zum Anderen, soweit dies nicht geschieht, das Recht, diese (lediglich die Mandanten, deren Geschäfte der Verfügungskläger bearbeitet) über die Fortführung des Mandates zu befragen.Randnummer114 Weitere Hinweise, wie etwa auf Kosten etc., wie sie in dem begehrten Entwurf des Schreibens enthalten sind, müssen nicht – wie oben ausgeführt – gegeben werden.Randnummer115 Zum Anderen ist auch nicht ersichtlich, woraus sich der Anspruch des Verfügungsklägers ergeben sollte, dass der Verfügungsbeklagte gegenüber den Mandanten richtig stellt, dass der Verfügungskläger sich im Zeitpunkt des Schreibens (Ende Juni) im Urlaub befunden habe, obwohl er rechtlich tatsächlich lediglich freigestellt war und den Urlaub erst zum 13.07.2020 angetreten hat.Randnummer116 Auch fehlt es diesbezüglich an einem Verfügungsgrund, da das Gericht davon ausgeht, dass die Parteien sich auf eine gemeinsame Befragung verständigen werden bzw. soweit diese Verständigung nicht erfolgt, beide Parteien das Recht haben, die entsprechenden Mandanten, deren Angelegenheiten der Verfügungskläger bearbeitet hat, jeweils selbst über die Fortführung des Mandates zu befragen.Randnummer117 Daraus wird für die Mandanten, die der Verfügungsbeklagte bereits angeschrieben haben sollte, hinreichend deutlich, dass sie das Mandatsverhältnis auch mit dem Verfügungskläger fortsetzen können.Randnummer118 Jedoch wird eine solche einseitige Befragung der Mandanten des Verfügungsklägers erst mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu erfolgen haben, da § 32 BORA auf das Ausscheiden aus der Sozietät und damit auf das Datum der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses abstellt. Soweit vereinzelt in der Rechtsprechung (Arbeitsgericht Schwerin, Anwaltsblatt 2002, S. 56) etwas anderes vertreten wird, ist dies unzutreffend. Da das Recht der Bekanntgabe des Ausscheidens und auch das Recht auf alleinige Befragung erst mit dem rechtlichen Ausscheiden begründet wird.Randnummer119 Allenfalls, soweit die Parteien sich auf eine gemeinsame Befragung einigen sollten, könnte diese, ebenso wie eine einvernehmliche Einzel-Befragung, vorher erfolgen.Randnummer120 An dieser Stelle mag die Kammer darauf hinweisen, dass sich auch aus den Erläuterungen der Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg nichts anderes ergibt. Auch diese geht im vorliegenden Fall nach dem von den Parteien der Rechtsanwaltskammer mitgeteilten Sachverhalt davon aus, dass der Verfügungskläger aus der Sozietät zum 31.07.2020 ausscheidet und nicht etwa die Sozietät zu diesem oder einem früheren Zeitpunkt aufgelöst wird.Randnummer121 Da der Verfügungsbeklagte nicht zu verurteilen war, eine erneute schriftliche Auskunft mit dem nach dem Klageantrag bestimmten Inhalt zu erteilen, war er auch nicht zu verurteilen, Auskunft über etwaige Antworten zu erteilen, sowie die Akten zu übergeben, die sich auf diese vorformulierte Auskunft mit dem Wunsch das Mandatsverhältnisses zu dem Verfügungskläger fortzusetzen gemeldet haben.Randnummer122 Schließlich war der Verfügungsbeklagte nicht zu verurteilen, dem Verfügungskläger eine Liste zu allen laufenden Mandaten der Fachanwaltskanzlei S. herauszugeben, da zum Einen – wie ausgeführt – kein Anspruch des Verfügungsklägers besteht, sondern er – soweit er sich bis zum 31.07.2020 nicht mit dem Verfügungsbeklagten auf eine gemeinsame Befragung seiner laufenden Mandate einigen kann, lediglich berechtigt ist, diese selbst zur Fortführung des Mandates zu befragen.Randnummer123 Zum Anderen würde eine Verurteilung zur Herausgabe einer solchen Liste, auch wenn sie eingeschränkt wäre, auf die Mandate, die der Verfügungskläger bearbeitete, jedenfalls im einstweiligen Verfügungsverfahren zu einer Vorwegnahme der Hauptsache. Damit sind die Auskünfte nicht zu erteilen.Randnummer124 So könnte eine entsprechende Auskunft für den Fall, dass sich die Verurteilung insoweit als zu Unrecht erfolgt erweisen sollte, nicht rückgängig gemacht werden. Dem Verfügungsbeklagten würde dadurch gegebenenfalls ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstehen.Randnummer125 Es sei trotzdem an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass, soweit die Parteien sich nicht auf eine gemeinsame Befragung einigen, der Verfügungsbeklagte dem Verfügungskläger die Möglichkeit einräumen muss, die von ihm betreuten Mandanten entsprechend § 32 BORA zur Fortführung des Mandates zu befragen. Dazu wird auch gehören, dass er ihm Vorname, Name, Firma, postalische Anschrift, bisheriges Kanzleiaktenzeichen, Bezeichnung der Sache, behördliche oder gerichtliche Aktenzeichen und Verfahrensstand etc. mitteilt.Randnummer126 Schließlich kann der Verfügungskläger von dem Verfügungsbeklagten nicht verlangen, Mandanten, die (auch) von dem Verfügungskläger betreut worden sind, auf die Möglichkeit der Vertretung im Verkehrsrecht durch die zukünftigen Kooperationspartner Herrn Rechtsanwalt B. und/oder im Sozialrecht durch die Kooperationspartnerin Frau Rechtsanwältin G. zu unterrichten.Randnummer127 So sei noch einmal betont, dass der Verfügungsbeklagte, der Inhaber der Firma „Fachanwaltskanzlei S.“ und Arbeitgeber des Verfügungsklägers jedenfalls bis zum 31.07.2020 ist, selbstverständlich allen Mandanten der Kanzlei Informationen zukommen lassen kann, soweit diese nicht rechtswidrig sind.Randnummer128 Dabei ist für die Kammer nicht erkennbar, inwieweit hier der Verfügungskläger einen Unterlassungsanspruch geltend machenRandnummer129 Zum Einen kann er, da er keine eigene Anwaltskanzlei betreibt, sondern bis zum 31.07.2020 bei dem Verfügungsbeklagten als Arbeitnehmer angestellt ist, keinen eigenen Anspruch ob des Berufsstandes oder sonst rechtlicher Art und Weise haben, dass eine entsprechende Unterrichtung nicht erfolgt. Dies wäre auch nicht von den Arbeitsgerichten zu entscheiden.Randnummer130 Zum Anderen ist nicht ersichtlich, inwieweit durch eine solche Unterrichtung sein Fragerecht zur Fortsetzung der Mandate, soweit sich die Parteien nicht auf eine gemeinsame Befragung der Mandanten, die von dem Verfügungskläger betreut worden sind, einigen, gefährdet sein sollte. Ein etwaiges wegen standeswidrigen und/oder Werbeverbot unrechtmäßiges Verhalten des Verfügungsbeklagten wäre gegebenenfalls durch die zuständigen Stellen in den zuständigen Verfahrenswegen geltend zu machen. Der Verfügungskläger als Arbeitnehmer ist insoweit jedoch nicht antragsbefugt.Randnummer131 Der Verfügungskläger war auf Antrag des Verfügungsbeklagten zu verurteilen es zu unterlassen, Schreiben mit dem Inhalt, dass Mandanten ohne gesonderte Erklärung damit rechnen müssten, dass die Angelegenheit durch Herrn Rechtsanwalt S. bearbeitet werden wird und in seinen Schreiben darauf hinzuweisen, dass durch die weitere Bearbeitung der Sache durch Herrn Rechtsanwalt V. in seiner Fachanwaltskanzlei keine zusätzlichen Kosten entstünden.Randnummer132 Es kann hier auf den zulässigen Inhalt der Befragung und die dazu gemachten Ausführungen oben verwiesen werden. Die von dem Verfügungskläger dem Verfügungsbeklagten angezeigte Formulierung, die er bei der Befragung nach § 32 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 S. 1 BORA verwenden will, nämlich „dass sie damit rechnen müssten, dass die Angelegenheit von Rechtsanwalt S. (dem Verfügungsbeklagten) weiter bearbeitet werden wird“, ist jedenfalls in dieser Art unzulässig.Randnummer133 Die Formulierung ist, wie der Verfügungsbeklagte zu Recht moniert, despektierlich. Alleine aus der Formulierung wird deutlich, dass der Verfasser des Hinweises, Frage oder Informationsschreibens, also der Verfügungskläger, dem Mandanten nahelegt, dass die Fortführung des Mandates mit ihm fachlich und qualitativ besser geleistet würde als durch den Verfügungsbeklagten.Randnummer134 So ist das Schreiben von jedem verständigen Dritten sehr negativ aufzufassen. Allein die Verwendung der Worte „Sie müssen damit rechnen…“ legt dies nahe.Randnummer135 Das Gericht empfiehlt an dieser Stelle nochmals und ausdrücklich, dass die Beteiligten sich auf eine gemeinsame Befragung einigen. Soweit dies nicht gelingt, werden sie die Mandanten, die von dem Verfügungskläger betreut worden sind, nach dem 31.07.2020 neutral und ohne jedes Werturteil zur Fortführung der Mandate befragen dürfen bzw. müssen.Randnummer136 Dabei werden sie gegebenenfalls ihre besondere Fach- und Sachkompetenz betonen dürfen, keinesfalls aber den jeweils anderen herabwürdigen oder die Entscheidung der Mandanten in der einen oder anderen Art zu beeinflussen zu versuchen. Sinn und Zweck der Regelung ist, dass die Mandanten frei entscheiden, wer das Mandat fortführen soll.Randnummer137 Dem Verfügungsbeklagten war auch ein Ordnungsgeld anzudrohen.Randnummer138 Der Antrag des Verfügungsbeklagten auf Vollstreckungsschutz war zurückzuweisen. So ist nicht ersichtlich, dass dem Verfügungsbeklagten wegen der Verurteilung ein nicht zu ersetzender Nachteil droht. Im Übrigen könnte dieser auch nicht durch ein etwaiges Minussaldo zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Konto der Anwaltskanzlei nachgewiesen werden.Randnummer139 Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 92 ZPO und entspricht dem jeweiligen Obsiegen bzw. Unterliegen.Randnummer140 Der Streitwert war für den Klageantrag zu 1 a) auf 9.000,00 Euro (2 Gehälter) festzusetzen, die Klageanträge zu b) und c) sind nicht zu berücksichtigen, da sie vom Streitwert her identisch mit dem Klageantrag zu 1 a) sind. Der Klageantrag zu 1 d) wurde mit 5 % des geschätzten Jahresumsatzes der Kanzlei in Höhe von 25.000,00 Euro berücksichtigt. Für die Klageanträge e), f) g) hat die Kammer jeweils 2.500,00 Euro angesetzt. Der Klageantrag zu h) ist wertidentisch mit dem Klageantrag zu g). Der Klageantrag zu i) ist mit 1.000,00 Euro berücksichtigt worden, j) wegen Streitwertidentität zu i) nicht. Hinsichtlich des Klageantrages zu 3) hat die Kammer einen Wert von 2.500,00 Euro angesetzt, hinsichtlich der Widerklage in Höhe von 9.000,00 Euro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArbG Schwerin, Urteil vom 29. Januar 2003 – 11 Ca 1566/02 | § 823 Abs 1 BGB, § 388 BGB, § 138 ZPO, § 286 ZPO, § 287 ZPO - Gelddiebstahl durch Arbeitnehmer1. Kommen der Arbeitgeber und der der Geldentnahme beschuldigte Arbeitnehmer ihrer Darlegungs- und Beweislast nach § 138 ZPO nicht hinreichend nach, kann das Gericht nach § 287 Abs 1 ZPO die streitige Frage, ob ein Schaden entstanden ist und wie hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse beläuft, nach freier Überzeugung entscheiden. 2. Eine erklärte Aufrechnung des Arbeitgebers mit Schadensersatzansprüchen wegen Entnahme gegenüber der Nettoentgeltforderung des Arbeitnehmers ist zulässig. Tenor
Im übrigen wird die Klage abgewiesen.
Im übrigen wird die Widerklage abgewiesen.
TatbestandDer Kläger begehrt von den Beklagten 1.658,01 € netto abzüglich aufgerechneter 204,52 € netto nebst Zinsen. Die Beklagte begehrt, dabei von einer Aufrechnung in Höhe von 1.664,77 € ausgehend, widerklagend vom Kläger die Zahlung von 5.872,94 € nebst Zinsen wegen unerlaubter Geldentnahmen. Randnummer2 Die Beklagten betreiben eine Kfz-Werkstatt mit zwei Arbeitnehmern. Der Kläger war bei den Beklagten vom 10.04.1995 bis zum 23.10.2001 beschäftigt. Sein Entgelt für September und Oktober wurde mit zumindest 1.658,01 € netto abgerechnet (Blatt 34 f., 84), aber nicht bezahlt. Der weitere Beschäftigte der Beklagten, ... wurde etwa ein bis zwei Jahre nach dem Kläger eingestellt (Blatt 67). In den Jahren 1995 bis 1996 kam es zu Fehlbeträgen in Höhe 20.000,00 DM, auf die die Beklagten durch ihren Steuerberater aufmerksam gemacht wurden (Blatt 67). In den Folgejahren bis einschließlich 18.10.2001 kam es zu Fehlbeträgen in der Größenordnung von 67.000,00 DM einschließlich Zinsen. Die Beklagten wurden von ihrem Steuerberater mehrmals darauf hingewiesen. Die Fehlbeträge wurden als Eigenentnahmen gebucht, wobei die Beklagten damit erst nach einem kontroversen Gespräch mit dem Steuerberater einverstanden waren. Im Jahr 2001 fehlten bis 28.10.2001 15.142,47 DM. Wegen der näheren Einzelheiten des Kassenbuches der Beklagten wird auf Blatt 46 bis 54 der Akte verwiesen. Randnummer3 Die Beklagten hatten im Verkaufsraum eine Registrierkasse. Abends entnahmen sie das Geld bis auf 100,00 DM und Kleingeld und legten es in eine Sammelkasse im Büro. Die Sammelkasse befand sich in einem Koffer und enthielt einen unverschlossenen Blechkasten. Der Inhalt des Blechkastens wurde 10 bis 20 mal im Jahr zur Bank gebracht. In ihm befanden sich manchmal bis zu 30.000,00 DM (Blatt 69). Die Beklagten konnten dem Kläger durch eine Videokamera die Entnahme von insgesamt 400,00 DM am 11.10. und 15.10.2001 nachweisen. Der Kläger entnahm einmal butterbrotkauend das Geld. Am 18.10.2001 stellten die Beklagten den Kläger gegen 17.30 Uhr im Büro zur Rede. Sie stellten eine Fehlsumme von 67.000,00 DM in den Raum. Die Reaktion des Klägers auf die Anschuldigungen ist zwischen den Parteien im Streit. Randnummer4 Der Kläger verfolgt seinen Entgeltanspruch mit am 06. bzw 07.06.2002 zugestellter Klage (Blatt 15 f.), die ursprünglich noch auf den Bruttobetrag gerichtet war. Die Beklagten erheben mit am 09.09.2002 zugestelltem Schreiben vom 30.08.2002 Widerklage wegen der Fehlsummen für 2001 und erklären zugleich die Aufrechnung. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf Blatt 30 bis 34 der Akte verwiesen. Randnummer5 Der Kläger behauptet, er habe in dem Gespräch am 18.10. nicht zugegeben, über die 400,00 DM hinaus Gelder entnommen zu haben. Der Kläger gibt an, sich an seine Reaktion auf die den Vorwurf der Entnahme von 67.000,00 DM nicht mehr genau zu erinnern. Der Kläger behauptet, er habe nur 400,00 DM entnommen. Randnummer6 Der Kläger beantragt, Randnummer7 die Beklagte zu verurteilen, als Gesamtschuldner an ihn 1.658,01 € netto abzüglich aufgerechneter 204,52 € netto nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen sowie die Widerklage abzuweisen. Randnummer8 Die Beklagten beantragen, Randnummer9 die Klage abzuweisen sowie widerklagend den Kläger zu verurteilen, an die Beklagten als Gesamtschuldner 5.872,94 € nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. Randnummer10 Die Beklagten behaupten, der Kläger habe seit Anfang 2001 insgesamt 15.142,47 DM entnommen. Sie sind der Ansicht, es sei nicht anzunehmen, dass eine andere Person das Geld entnommen habe. Sie behaupten, der Kläger habe am 18.10.2001 in Anwesenheit beider Beklagten und nachher noch einmal in zusätzlicher Anwesenheit seiner Frau mitgeteilt, er habe seit Anfang 2001 in unregelmäßigen Abständen Geld entnommen, jedoch nicht 67.000,00 DM. Die Familie habe sich in finanziellen Schwierigkeiten befunden. Randnummer11 Die Beklagten tragen vor, sie selber hätten keine Entnahmen aus der Kasse vorgenommen, die nicht im Kassenbuch dokumentiert seien. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Herr T. Geld entnommen habe. Randnummer12 Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf den Inhalt der Akte bis einschließlich Blatt 87 verwiesen. Das Gericht hat die Parteien zum Wortlaut der Gespräche am 18.10.2001 angehört. Wegen der näheren Einzelheiten des Ergebnisses der Parteianhörung wird auf das Protokoll vom 29.01.2003 (Blatt 83 - 86 der Akte) verwiesen. Die Akte der Staatsanwaltschaft Schwerin 148 JS 31162/01 lag bei Entscheidungsfindung vor. Entscheidungsgründe1. Die Klage ist zum Teil begründet und zum Teil unbegründet. Die Widerklage ist zum Teil begründet und zum Teil unbegründet. Die Beklagten haben einen Schadensersatzanspruch gegen den Kläger in Höhe von 950,00 €, der in Höhe von 504,00 € durch Aufrechnung untergegangen ist. Der Kläger hat gegen die Beklagten einen Entgeltzahlungsanspruch in Höhe von 1.658,01 €, der in Höhe von 504,00 € durch Aufrechnung untergegangen ist. Die zuerkannten Zinsansprüche ergeben sich aus §§ 286 - 291 BGB, Art. 229 § 7 EGBGB. 2. Der Nettoentgeltanspruch des Klägers in Höhe von 1.658.01 € ist zwischen den Parteien nicht im Streit. 3. Die Beklagten haben gegen den Kläger einen Schadensersatzanspruch wegen unerlaubter Entnahme von Geld aus der Geldkassette in Höhe von 950,00 €. Das Gericht ist unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlung, der vorgetragenen Tatsachen sowie der Darlegungs- und Beweislast zu dem Ergebnis gekommen, dass der Kläger 950,00 € entnahm. Der Anspruch ergibt sich aus einer Verletzung des Arbeitsvertrages, aber auch aus §§ 823 BGB, 242 StGB. 3.1. Bei Zugrundelegung des Vortrags der Beklagten hat der Kläger den Beklagten Schadensersatz allein für das Jahr 2001 in Höhe von 14.172,47 DM oder 7.742,22 € zu leisten. Denn nach dem Vortrag der Beklagten hat der Kläger in dieser Größenordnung gestohlen. Dieser Vortrag ist aus den im Folgenden darzulegenden Gründen nicht zugrunde gelegt werden. 3.2. Nach dem Vortrag des Klägers besteht lediglich ein Schadensersatzanspruch in Höhe von 400,00 DM oder 204,52 € netto. Nach dem Vortrag des Klägers fanden die weiteren Entnahmen zwar statt, jedoch durch andere Personen, die der Kläger nicht benennt. Dieser Vortrag des Klägers kann nicht uneingeschränkt zugrunde gelegt werden. 3.3. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung sprechen sowohl Argumente für wie auch gegen die Darstellung sowohl des Klägers wie auch der Beklagten. 3.3.1. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist das Gericht fest davon überzeugt, dass der Kläger bei seiner Anhörung am 18.10. gegen 17.30 Uhr vor Erscheinen seiner Frau zugab, er habe seit Anfang 2001 in unregelmäßigen Abständen Geld entnommen, jedoch deutlich weniger als 67.000,00 DM. Das Gericht glaubt der entsprechenden Darstellung des Beklagten zu 1. am 29.01.2003, und zwar insbesondere deswegen, weil der Kläger auf Nachfrage angab, er könne sich nicht mehr daran erinnern, was er gesagt habe, als man ihm die Summe von 67.000,00 DM nannte. Weiterer Beweis zu dieser Äußerung war nicht zu erheben, da der Kläger nach Anhörung des Beklagten zu 1. und des Klägers auf weitere Anhörungen und Zeugenvernahmen verzichtete. Für die Kammer kommt es nicht darauf an, ob der Kläger die soeben dargestellte Äußerung in Anwesenheit seiner Frau nochmals wiederholte. 3.3.2. Auf Grund der dargestellten Äußerung ist die Kammer fest davon überzeugt, dass der Kläger über 400,00 DM hinaus weitere Summen klaute. Diese Überzeugung der Kammer betrifft den Zeitraum ab dem 01.01.2001. Der Vortrag des Klägers, er habe nicht mehr als 400,00 DM geklaut, ist aus Sicht der Kammer widerlegt. 3.3.3 Das Gericht konnte sich nach Anhörung der Beklagten nicht davon überzeugen, dass im Jahr 2001 keine Entnahmen durch andere Personen als den Kläger stattfanden, denn es kam zu erheblichen Fehlbeträgen auch in den Jahren 1999 und 2000. Sofern diese Fehlbeträge nicht auf den Kläger zurückzuführen sind, besteht eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass der für die Fehlbeträge in den Jahren 1999 und 2000 Verantwortliche auch für einen Teil der Fehlbeträge des Jahres 2001 verantwortlich ist. Hauptverdächtige für die Verantwortlichkeit für diese Fehlbeträge sind die beiden Beklagten. Sie hatten die besten Möglichkeiten, Geld an sich zu nehmen. Weitere Verdächtige sind der Kläger, der andere Mitarbeiter sowie die Mitbewohner in den Wohnungen der Beklagten, mit Ausnahme der Kleinkinder. Randnummer22 Dem Gericht ist das Verhalten der Beklagten vor Sommer 2001 nicht plausibel geworden. Das Gericht hätte erwartet, dass mit Entdeckung der ersten Fehlmengen ab sofort gründlicher mit der Kasse umgegangen wird, z. B. abgeschlossen wird, regelmäßig gezählt wird und gegebenenfalls auch Kassenübergaben stattfinden. Die Tatsache, dass derartige zu erwartende Verhaltensweisen nicht stattfanden, lässt Fragen offen und gibt Raum für Mutmaßungen. Die naheliegendste Erklärung für das Verhalten der Beklagten ist, dass einer oder (wahrscheinlicher) beide Beklagten in erheblichem Umfang selbst Geld entnahmen oder gemutmaßte unerlaubte Entnahmen durch Geschäftspartner oder Lebensgefährten deckten. Randnummer23 Die Darstellung der Beklagten wäre nachvollziehbarer gewesen, wenn feststünde, zu welchem Datum welche Summe fehlte. Die Erklärungen der Beklagten, warum Maßnahmen zur Ermittlung genau dieser Tatsache unterblieben, sind nicht nachvollziehbar. Randnummer24 Das Gericht hält es nach alledem für hochgradig wahrscheinlich, dass auch andere Personen als der Kläger im Jahr 2001 Geld entnahmen. 3.4. Der Kläger ist seiner Darlegungslast nicht nachgekommen. Nach § 138 ZPO hat sich jede Seite zu den von der Gegenseite erklärten Tatsachen zu erklären, wobei Rechtsfolge der Nichterklärung ist, dass die von der Gegenseite vorgetragene Tatsachen als zugestanden anzusehen sind. Randnummer26 Der Kläger hat trotz eigener Geldentnahme über 400,00 DM hinaus nicht dazu vorgetragen, wieviel er entnahm. Das spricht dafür, nach § 138 den Vortrag der Beklagten zur vom Kläger entnommenen Summe als zugestanden anzusehen. Randnummer27 Der Anwendbarkeit der Rechtsfolge nach § 138 ZPO steht nicht entgegen, dass der Kläger sich bei Zugabe weiterer Entnahmen dem Risiko einer weiteren strafrechtlichen Verfolgung aussetzt. Der Kläger hat zwar im Strafprozess ein Aussageverweigerungsrecht und kann auch im Zivilprozess die Aussage verweigern. Dies hat aber aus Gründen der Darlegungs- und Beweislast, wie in § 138 ZPO geregelt, gegebenenfalls Nachteile. 3.5. Die Beklagten sind ebenfalls ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht nachgekommen. Grundsätzlich haben die Beklagten die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruches darzulegen. Die Beklagten haben nicht zu Einzelheiten vorgetragen, aus denen sich der Umfang der Entnahme durch den Kläger sicher abschätzen lässt. Dieser Umstand würde angesichts des bewussten Schweigens des Klägers zu den Entnahmen dann nicht schaden, wenn die Beklagten alles das vortrugen, was von einem Kaufmann nach ordnungsgemäßer Buchführung erwartet werden kann. Insbesondere nach Kenntnisnahme bereits erheblicher Barkassenfehlmengen kann erwartet werden, dass täglich der Soll- und der Istbestand der Barkasse verglichen wird, dass nach Fehlmengen zeitnah recherchiert wird, wenn sie bekannt werden, dass die Barkasse in einem abgeschlossenen Behältnis aufbewahrt wird und eine klare Zuständigkeit für den Schlüssel besteht. Eine Kassenzählung bei Schlüsselübergabe bietet sich an. Randnummer29 Stattdessen wurde noch nicht einmal bei Einzahlung in die Bank verglichen, ob zu diesem Zeitpunkt Soll- und Istbestand annähernd übereinstimmen. Die Kasse war nicht nur nicht abgeschlossen, sondern sie wurde auch in verschiedenen Räumlichkeiten mit Zugriffsmöglichkeiten verschiedenster Personen aufbewahrt, nämlich in der Wohnung des Beklagten zu 1, in der Wohnung des Beklagten zu 2 sowie im Büro. Die Kassenzählung wurde durch die steuerrechtlich nicht zugelassene Führung einer Doppelkasse erschwert. Soweit ersichtlich fand eine vollständige Zählung einschließlich des Kleingeldes grundsätzlich nicht statt. Randnummer30 Das Verhalten der Beklagten stellt sich objektiv gesehen als Spurenverwischung dar, wobei eine bewusste Spurenverwischung wahrscheinlicher erscheint als ein Versehen. Randnummer31 Damit haben die Beklagten gleichzeitig sich nicht hinreichend zu der vom Kläger behaupteten Tatsache erklärt, auch andere Personen hätten Geld entnommen. Das Gericht entnimmt dem Verhalten des Klägers, dass der Kläger, wenn auch im Wortlaut nur angedeutet, behauptet, auch andere Personen hätten geklaut bzw. ohne Dokumentation in den Kassenbüchern Geld entnommen. Dabei können die Beklagten sich nicht auf Unkenntnis der jeweiligen Kassenstände berufen. Es ist ihnen zwar zuzugestehen, dass sie sich mutmaßlich nicht mehr persönlich erinnern. Bei Vorgängen im eigenen Geschäfts- und Verantwortungsbereich kann man sich jedoch nur eingeschränkt auf die schlechte Erinnerung berufen. Man hat vielmehr Erkundigungen anzustellen und muss sich durch Einsichtnahme in Aufzeichnungen kundig machen. Gegebenenfalls hat man den Grund der eigenen Unkenntnis darzulegen (Greger in Zöller, ZPO, 23. Auflage, § 138, Randziffer 14, 16). Dabei ist den Beklagten zuzugestehen, dass sich der Kassenstand zu den verschiedenen Zeitpunkten mutmaßlich inzwischen nur noch sehr eingeschränkt anhand der Daten und Summen der Bankeinzahlungen und der sich nach Kassenbuch für diese Zeiten ungefähr ergebenen Summen rekonstruieren lässt. Auch liegt eine nachträgliche Vernichtung von Beweismitteln nicht vor oder ist zumindest nicht zu erkennen. Das Verhalten der Beklagten stellt sich aber als eine vorweg genommene Beweisvereitelung für eventuelle zukünftige Prozesse dar. Wer keine vernünftige Kassenführung betreibt, kann sich im Prozess später nur sehr eingeschränkt auf die Nichtkenntnis vom jeweiligen Kasseninhalt berufen. Genauso wie ein Bestreiten mit Nichtwissen nicht zulässig ist, wenn man finanzielle Dingen anderen überlässt, genauso ist ein Bestreiten mit Nichtwissen auch nur eingeschränkt möglich, wenn man finanzielle Dinge ganz sich selbst überlässt. Spätestens nach Auftauchen der erheblichen Bargeldfehlbeträge hätte sich eine andere Vorgehensweise angeboten. Randnummer32 Auf Grund des Verhaltens der Beklagten liegt für das Gericht keine sichere Grundlage für eine Schätzung des vom Kläger verursachten Schadens vor. 3.6. Bei der Bewertung des Vortrags der Parteien ist das Gericht von den Regelungen in §§ 138, 286, 287 ZPO ausgegangen. Die Regelung in § 138 ZPO wurde bereits dargestellt. Sie führt nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, weil der nach § 138 ZPO wegen fehlendem Vortrag des Klägers zugrundeliegende Vortrag der Beklagten dem nach § 138 ZPO zugrunde zu legenden Vortrag des Klägers wegen fehlendem Vortrag der Beklagten widerspricht. Nach § 286 ZPO hat das Gericht unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche Behauptung für wahr oder nicht für wahr zu erachten ist. Nach § 287 Abs. 1 Satz 1 ZPO kann das Gericht über eine streitige Frage, ob ein Schaden entstanden ist und wie hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse beläuft, nach Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung entscheiden. Dabei ist eine Schätzung allerdings unzulässig, wenn sie mangels greifbarer, von klagender Seite vorzutragender Anhaltspunkte völlig in der Luft hängen würde (BGHZ 91, Seite 243, 256). Randnummer34 Bei beiderseits nach § 138 ZPO unzureichendem Vortrag entspricht es dem Grundgedanken von § 286 f. ZPO, die vom Gericht für am Wahrscheinlichsten erachtete Tatsache bzw. Schadenshöhe zugrundezulegen. Randnummer35 Angesichts der beiderseitigen Versäumnisse ist der Bereich der vertretbaren Entscheidungen groß. Vertretbar ist es, unter Berücksichtigung des fehlenden Vortrages der Beklagten zu den Entnahmen einen Betrag in der Größenordnung von 600,00 € anzusetzen, so der Vergleichsvorschlag der Kammer vom 29.01.2003. Vertretbar ist es auch, unter stärkerer Berücksichtigung des fehlenden Vortrages auf Klägerseite einen Schaden in der Größenordnung von 1.658,01 € anzusetzen, so der Vergleichsvorschlag des Vorsitzenden vom 11.11.2002. Randnummer36 Das Gericht hält eine Entnahme in der Größenordnung von 950,00 € für am Wahrscheinlichsten und hat daher so entschieden. Dabei kommt es nicht darauf an, dass auf Grund der damals noch geltenden DM-Beträge möglicherweise eine in DM gerade Summe wahrscheinlicher ist als eine in Euro gerade Summe. Auf diese Einzelheiten kommt es nicht an, da nach Angabe der Beklagten auch zum Teil Kleingeldbeträge eingenommen wurden und diese nicht genau gezählt wurden. Der von den Beklagten angegebene Fehlbetrag stellt in DM eine krumme Summe dar. Randnummer37 Die Kammer hat bei ihrer Entscheidung insbesondere folgende Gesichtspunkte betont: Randnummer38 Die Äußerung des Klägers, dass er erst seit 2001 stahl, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Wahrhaftigkeit für sich. Auch bei unterstellter Neigung zum Lügen geht die Kammer davon aus, dass in einer Situation wie der am 18.10. auch eine eher sonst zum Lügen neigende Person tendenziell die Wahrheit sagen würde. Das Gericht geht nicht davon aus, dass der Kläger nur sehr selten oder sehr wenig entnahm. Denn es war bereits eine gewisse Routine bei den Entnahmen erkennbar. Andererseits geht das Gericht auf Grund des Umfangs der Entnahmen in den Vorjahren, bei denen keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Verantwortlichkeit des Klägers besteht, davon aus, dass es noch weitere Personen gibt, die nicht im Kassenbuch dokumentierte Entnahmen vornehmen. Es ist wahrscheinlich, dass die Entnahmen durch andere Personen als den Kläger wie in den Jahren 1995 bis 2000 auch im Jahre 2001 fortgeführt wurden. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die betreffende Person auf Grund eigener Teilnahme an der Videofilmaktion die Entnahmen vor den Filmmaßnahmen beendete. Randnummer39 Der Kläger kann sich nicht auf weniger Entnahmen als 950,00 € berufen. Dazu hätte er vortragen müssen, wieviel Geld er entnahm. Die Beklagten können sich nicht darauf berufen, dass der Kläger mehr als 950,00 € entnahm. Dazu hätten sie den Verdacht sonstiger Entnahmen stärker ausräumen müssen und mehr zu den Daten der Entnahmen und zu eigenen Maßnahmen zur Verhinderung unbefugter Entnahmen vortragen müssen. 4. Die erklärte Aufrechnung der Beklagten mit den Schadensersatzansprüchen wegen Entnahme gegenüber der Nettoentgeltforderung des Klägers ist in Höhe von 446,00 € unzulässig und in Höhe von 504,00 € zulässig. Die Aufrechnungserklärung ist hinreichend bestimmt im Sinne von § 388 BGB. Der Aufrechnung steht aber in Höhe von 446,00 € die Pfändungsfreigrenze nach § 394 BGB in Verbindung mit § 850 c ZPO in Verbindung mit der dazugehörigen Tabelle entgegen, wobei das Gericht von keinen Unterhaltspflichten ausgegangen ist. Zu einer abweichenden Festsetzung des pfändbaren Teils des Arbeitseinkommens wegen einer Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung durch das Vollstreckungsgericht nach § 850 f Absatz 2 ZPO ist es bisher nicht gekommen. 5. In dem Umfang, in dem die Aufrechnung zulässig ist, sind Klagforderung und Widerklagforderung erloschen. 6. Die Kostenverteilung folgt aus §§ 46 Abs. 2 Arbeitsgerichtsgesetz, 92 ZPO und entspricht dem Grad des Obsiegens und Unterliegens. 7. Die Streitwertfestsetzung auf die Summe von Klage und Widerklage entspricht §§ 46 Abs. 2, 61 Abs. 1 Arbeitsgerichtsgesetz, 3 - 5 ZPO. 8. Die Berufungszulassung nach § 64 Arbeitsgerichtsgesetz erfolgt wegen grundsätzlicher Bedeutung der Frage der Darlegungs- und Beweislast bei beiderseits unzureichendem Vortrag. Löffler I www.K1.de I www.gesellschaftsrechtskanzlei.com I Gesellschaftsrecht I unberechtigte Entnahmen I Haftung wegen arbeitsvertraglicher Pflichtverletzung I Erfurt I Thüringen I Sachsen I Sachsen-Anhalt I Hessen I Deutschland 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArbG Wuppertal, Beschluss vom 10.10.2011 - 7 BV 36/11 | DrittelbG1. Anders als die Wahlanfechtung, die gem. § 11 Abs. 1 DrittelbG fristgebunden und gem. § 11 Abs. 2 DrittelbG bestimmten Personenkreis vorbehalten ist, kann die Nichtigkeit der Wahl von jedermann jederzeit geltend gemacht werden, sofern hieran ein rechtliches Interesse besteht (BAG v. 16.4.2008 – 7 ABR 6/07 – Juris; Oetker in Erfurter Kommentar, 11. Aufl. 2011, § 11 DrittelbG Rz. 8; vgl. zur Betriebsratswahl: BAG 21.7.2004 – 7 ABR 57/03 – Juris).2. Das Interesse der Gesellschaft an der Feststellung der Nichtigkeit der Wahl hängt mit ihrem Interesse an einem funktionsfähigen Aufsichtsrat zusammen. War die Wahl der Arbeitnehmervertreter zum Aufsichtsrat nichtig und wird dies durch das ArbG festgestellt, führt dies zu einem rückwirkenden Erlöschen des Amtes der betroffenen Aufsichtsratsmitglieder. Von ihnen in der Vergangenheit ausgeführte Handlungen sind unwirksam. Ebenfalls unwirksam sind infolgedessen Beschlussfassungen des Aufsichtsrats, wenn die unwirksame Stimmabgabe für ihr Zustandekommen ausschlaggebend war (Gach in MünchKomm/AktG, 3. Aufl. 2008, § 22 MitbestG Rz. 17).3. Obwohl sich dies aus dem Wortlaut der zitierten Vorschriften nicht zweifelsfrei ergibt (vgl. Oetker in Erfurter Kommentar, 11. Aufl. 2011, § 2 DrittelbG Rz. 13), wird § 2 Abs. 1 DrittelbG dahingehend ausgelegt, dass er Arbeitnehmern abhängiger Unternehmen das aktive Wahlrecht in gleichem Umfang einräumt wie Arbeitnehmern der Obergesellschaft (Oetker in Erfurter Kommentar, 11. Aufl. 2011, § 2 DrittelbG Rz. 12; Seibt in HWK, 4. Aufl. 2010, § 2 DrittelbG Rz. 9).4. Die Nichtigkeit einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer oder einer Betriebsratswahl ist jedoch nur in ganz besonderen Ausnahmefällen anzunehmen, in denen gegen allgemeine Grundsätze jeder ordnungsgemäßen Wahl in so hohem Maße verstoßen worden ist, dass auch der Anschein einer dem Gesetz entsprechenden Wahl nicht mehr vorliegt. Es muss ein sowohl offensichtlicher als auch besonders grober Verstoß gegen Wahlvorschriften vorliegen (BAG v. 19.11.2003 – 7 ABR 24/03 – Juris; LAG Baden-Württemberg v. 4.7.2007 – 2 TaBV 3/06 – Juris). Dabei ist folgendes zu berücksichtigen: Die Nichtigkeit einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer oder einer Betriebsratswahl ist im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen. Gesetzlich geregelt ist nur die Anfechtung der Wahl bei wesentlichen Verstößen gegen Wahlvorschriften. Diese führen nur zur Unwirksamkeit der Wahl ex nunc, wenn die Anfechtung innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses erfolgt. Andernfalls sind grundsätzlich auch nicht ordnungsgemäß gewählte Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer oder Betriebsräte bis zum Ablauf der regelmäßigen Amtszeit mit allen Befugnissen im Amt. Dies dient der Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrates bzw. des Betriebsrates und schützt das Vertrauen in die Gültigkeit der vom Aufsichtsrat bzw. vom Betriebsrat im Rahmen seiner Geschäftsführung vorgenommenen Handlungen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist nur geboten, wenn bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer bzw. des Betriebsrates so grob und offensichtlich gegen Wahlvorschriften verstoßen wurde, dass auch nur von dem Anschein einer dem Gesetz entsprechenden Wahl nicht mehr gesprochen werden kann und dies jedem mit den betrieblichen Verhältnissen vertrauten Dritten sofort ohne weiteres erkennbar ist. Denn ein auf diese Weise in das Amt berufenes Gremium besitzt weder die Legitimation zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem AktG bzw. Betriebsverfassungsgesetz, noch können das Unternehmen und die Belegschaft darauf vertrauen, dass ein Aufsichtsrat besteht, der rechtswirksam Aufgaben nach dem AktG wahrnehmen kann. Nur in diesem Ausnahmefall, in dem für jeden evident ist, dass wirksam gewählte Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer nicht vorhanden sind, ist die Wahl von Anfang an nichtig (LAG Baden-Württemberg v. 4.7.2007 – 2 TaBV 3/06 – Juris; zur Betriebsratswahl: BAG v. 19.11.2003 – 7 ABR 24/03 – Juris). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgewählte Entscheidungen zum Steuerrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgewählte BGH-Entscheidungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgewählte Entscheidungen sonstiger Gerichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgewählte OLG-Entscheidungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgewählte Themen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgewählte Themen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschluss des Gesellschafters aus der Gesellschaft I Einziehung von Geschäftsanteilen I Abfindung | Ein Gesellschafter kann gegen seinen Willen aus einem Gesellschafterverbund, so z.B. aus einer GmbH, ausgeschlossen werden. Für den zwangsweisen Verlust seiner Beteiligung erhält der Gesellschafter im Regelfall eine Abfindung. Der Grund für einen Ausschluss eines Gesellschafters ist u.a. der Streit zwischen Gesellschaftern. Die Mittel für einen Ausschluss eines Gesellschafters sind Ausschluss des GesellschaftersEinziehung des GeschäftsanteilsAustritt des GesellschaftersKaduzierungPreisgabe AbadonEin ÜberblickAusschluss des Gesellschafters
Einziehung des Geschäftsanteils
Austritt des GesellschaftersKaduzierung
Preisgabe Abadon
Löffler I www.K1.de I www.gesellschaftsrechtskanzlei.com I Gesellschaftsrecht I Ausschluss Gesellschafter I Einziehung Geschäftsanteile I Erfurt I Thüringen I Sachsen I Sachsen-Anhalt I Hessen I Deutschland 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG Urt. v. 8.8.2000 – 9 AZR 517/99 | BGB § 2421. Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ist anwendbar, wenn ein Arbeitgeber Leistungen nach einem bestimmten erkennbaren und generalisierenden Prinzip gewährt sowie bestimmte Voraussetzungen oder einen bestimmten Zweck festlegt (ständige Rechtsprechung BAG 23. August 1995 - 5 AZR 293/94 - BAGE 80, 354, 360 = AP BGB § 242 Gleichbehandlung Nr. 134 = EzA BGB § 242 Gleichbehandlung Nr. 69, zu II 1 der Gründe). a) Die Beklagte hat für das Urlaubsjahr 1997 einem Teil der Belegschaft für die Bestreitung zusätzlicher urlaubsbedingter Aufwendungen eine besondere Leistung gewährt, das sog. Urlaubsgeld. Die Gewährung dieser Leistung hat sie auf die Gruppe der vollbeschäftigten Vertriebsinspektoren beschränkt und die Gruppe der teilzeitbeschäftigten Zeitungszusteller ausgenommen. Damit hat sie das Kollektiv der Belegschaft in zwei Gruppen aufgeteilt, in die Gruppe der Berechtigten und in die Gruppe der Nichtberechtigten. Bei der Aufteilung waren keine individuellen Gesichtspunkte, sondern allein die Zugehörigkeit zur Gruppe der Vertriebsinspektoren oder Zeitungszusteller maßgeblich. b) Unerheblich ist, daß der Aufteilung der Belegschaft in die Gruppe der Vertriebsinspektoren und in die Gruppe der Zeitungszusteller ein Zahlenverhältnis von 4: 180 zugrunde liegt. Der Gleichbehandlungsgrundsatz greift nicht erst dann ein, wenn die Mehrheit der Arbeitnehmer begünstigt wird. Entscheidend ist, ob der Arbeitgeber - wie hier - eine kollektive Regelung trifft (vgl. BAG 19. August 1987 - 5 AZR 222/86 - n.v.). Maßgeblich ist dann auch nicht das quantitative Verhältnis der Gruppen zueinander. Die begünstigte Gruppe kann auch zahlenmäßig kleiner als die benachteiligte Gruppe sein (vgl. BAG 25. Januar 1984 - 5 AZR 89/82 - BAGE 45, 76, 81 = AP BGB § 242 Gleichbehandlung Nr. 67 = EzA BGB § 242 Gleichbehandlung Nr. 38). Daher kann auch die Begünstigung einer kleinen Gruppe von Arbeitnehmern den Arbeitgeber dazu verpflichten, sie mit einer zahlenmäßig größeren Gruppe von Arbeitnehmer gleichzubehandeln. 2. Das Landesarbeitsgericht hat ohne Rechtsfehler verneint, daß die Beklagte gegenüber den Zeitungszustellern offengelegt hat, einen sachlichen Grund für den Ausschluß von der Gewährung des Urlaubsgelds zu haben. a) Der Ausschluß der Gruppe der Zeitungszusteller ist nicht deshalb zulässig, weil es sich bei den Angehörigen dieser Gruppe um gewerbliche Arbeitnehmer und bei der Gruppe der Vertriebsinspektoren um Angestellte handelt. Für die Frage der sachlichen Rechtfertigung des Unterscheidungskriteriums ist auf den Zweck der Leistung und nicht auf die Zugehörigkeit zur Gruppe der Arbeiter oder Angestellten abzustellen (vgl. BAG 25. Januar 1984 - 5 AZR 44/82 - BAGE 45, 66, 70 ff. = AP BGB § 242 Gleichbehandlung Nr. 66 = EzA BGB § 242 Gleichbehandlung Nr. 40, zu I 1, 2 der Gründe; Senat 27. Oktober 1998 - 9 AZR 299/97 - BAGE 90, 85, 89). b) Der Leistungszweck, der der Urlaubsgewährung zugrunde liegt, rechtfertigt keinen Ausschluß der Zeitungszusteller. Auch für Teilzeitbeschäftigte entsteht bei Antritt einer Urlaubsreise ein erhöhter Bedarf. c) Die Besserstellung der Vertriebsinspektoren ist auch nicht durch die Rechtsnormen eines Tarifvertrages gerechtfertigt. Zwar ist es zutreffend, daß ein tarifgebundener Arbeitgeber ohne Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz zwischen tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Arbeitnehmern unterscheiden darf (vgl. BAG 20. Juli 1960 - 4 AZR 199/59 - AP TVG § 4 Nr. 7). Eine derartige Rechtfertigung scheidet für die Beklagte aber schon deshalb aus, weil die Beklagte weder Mitglied der Tarifvertragspartei oder selbst Partei des von ihr herangezogenen § 30 des Manteltarifvertrages für die kaufmännischen Angestellten in den Verlagen von Tageszeitungen im Lande Nordrhein-Westfalen ist. Nach § 4 Abs. 1 TVG gelten die Rechtsnormen eines Tarifvertrages, die den Inhalt von Arbeitsverhältnissen ordnen, nur zwischen den beiderseits Tarifgebundenen. d) Die Beklagte kann sich zur Rechtfertigung der Ungleichbehandlung auch nicht darauf berufen, ein tarifvertraglicher Anspruch der Vertriebsinspektoren auf Urlaubsgeld sei nach dem Teilbetriebsübergang im Jahre 1990 nach § 613 a Abs. 1 Satz 2 BGB Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen ihr als neuer Betriebsinhaberin und den Vertriebsinspektoren geworden. Die Beklagte hat zwar in den Vorinstanzen vorgebracht, die Vertriebsinspektoren hätten vor dem Teilbetriebsübergang „dem MTV unterlegen“. Das Landesarbeitsgericht hat zu Recht beanstandet, es fehle der Vortrag von Tatsachen dafür, ob die Vertriebsinspektoren Mitglieder der tarifvertragsschließenden Gewerkschaft waren. Die Revision der Beklagten verkennt insoweit die Darlegungslast. e) Die Beklagte kann sich für die Besserstellung der Vertriebsinspektoren auch nicht darauf berufen, sie habe einen vertraglichen Besitzstand der Vertriebsinspektoren gem. § 613 a Abs. 1 Satz 1 BGB wahren müssen. Die Wahrung eines arbeitsvertraglichen Besitzstandes kann als Grund für eine unterschiedliche Behandlung verschiedener Arbeitnehmergruppen in Betracht kommen (BAG 25. August 1976 - 5 AZR 788/75 - AP BGB § 242 Gleichbehandlung Nr. 41 = EzA BGB § 242 Gleichbehandlung Nr. 11; 26. Mai 1993 - 4 AZR 461/92 - AP BGB § 612 Diskriminierung Nr. 2 = EzA BeschFG 1985 § 2 Nr. 28, zu B II der Gründe). Das Bundesarbeitsgericht hat die Besitzstandswahrung als sachlichen Differenzierungsgrund für den Fall anerkannt, daß ein Unternehmer zwei bisher selbständige Betriebe übernimmt und in dem neu geschaffenen einheitlichen Betrieb bei der Leistungsgewährung die vor der Betriebsübernahme angewandten Gratifikationsordnungen weiterhin anwendet (BAG 25. August 1976 - 5 AZR 788/75 - a.a.O.). Im Streitfall liegen die Verhältnisse allerdings anders. Die Vertriebsinspektoren und die Zeitungszusteller wurden vor dem Teilbetriebsübergang in ein- und demselben Betrieb beschäftigt. Die Beklagte kann sich daher nicht auf unterschiedliche Urlaubsgeldordnungen berufen. Sie ist mit dem Übergang des Betriebsteils in die gegenüber den Vertriebsinspektoren und Zeitungszustellern bestehenden Pflichten des früheren Arbeitgebers eingetreten. Damit verbunden war auch die Pflicht, die ohne Sachgrund von der Urlaubsgeldgewährung ausgeschlossenen Zeitungszusteller nach Maßgabe der allgemeinen Regelung zu behandeln. f) Die Beklagte kann auch keine sachlich gerechtfertigte Besserstellung der Vertriebsinspektoren aus der sog. Betriebsvereinbarung vom 9. August 1990 herleiten. Diese Vereinbarung ist acht Monate nach dem Übergang des Betriebsteils auf die Beklagte von dem Betriebsrat des Zeitungsverlags abgeschlossen worden. Weder konnte dieser Betriebsrat für die Belegschaft der Beklagten handeln, noch enthält die Nr. 9 der Vereinbarung eine Regelung, die die bei der Beklagten beschäftigten Zeitungszusteller vom Bezug des Urlaubsgelds ausschließt. 3. Liegen somit keine sachlichen Rechtfertigungsgründe für den Ausschluß der Zeitungszusteller von der Urlaubsgeldgewährung vor, so können die Klägerin und die Kläger verlangen, entsprechend der Regelung behandelt zu werden, die für die angestellten Vertriebsinspektoren von der Beklagten angewandt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Beschluss vom 03. Dezember 2014 – 10 AZB 98/14 | § 2 Abs 1 Nr 3 Buchst a ArbGG, § 2 Abs 1 Nr 3 Buchst b ArbGG, § 5 Abs 1 S 1 ArbGG, § 5 Abs 1 S 3 ArbGG, § 17 Abs 1 S 1 GVG, § 17a Abs 3 GVG, § 17a Abs 4 GVG1. Wird ein zum Zeitpunkt der Klageerhebung vor dem Arbeitsgericht noch bestellter Geschäftsführer vor einer rechtskräftigen Entscheidung über die Rechtswegzuständigkeit abberufen, begründet dies in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten die Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen. Gleiches gilt, wenn der Geschäftsführer bis zu diesem Zeitpunkt wirksam sein Amt niederlegt. Damit entfällt die Fiktionswirkung des § 5 Abs 1 S 3 ArbGG.Wird ein zum Zeitpunkt der Klageerhebung vor dem Arbeitsgericht noch bestellter Geschäftsführer vor einer rechtskräftigen Entscheidung über die Rechtswegzuständigkeit abberufen, begründet dies in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten die Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen. Gleiches gilt, wenn der Geschäftsführer bis zu diesem Zeitpunkt wirksam sein Amt niederlegt. Damit entfällt die Fiktionswirkung des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG (BAG 22. Oktober 2014 - 10 AZB 46/14 - Rn. 26 ff.).2. Nachträgliche Veränderungen führen grundsätzlich nicht zum Verlust des einmal gegebenen Rechtswegs. Dieser in § 17 Abs 1 S 1 GVG enthaltene Grundsatz der perpetuatio fori gilt jedoch nur rechtswegerhaltend. Alle bis zur letzten Tatsachenverhandlung eintretenden Umstände, welche die zunächst bestehende Unzulässigkeit des Rechtswegs beseitigenNach allgemeinen zivilprozessualen Grundsätzen richtet sich die Entscheidung über die Zulässigkeit des Rechtswegs zunächst nach den tatsächlichen Umständen zum Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit (MüKoZPO/Zimmermann 4. Aufl. § 17a GVG Rn. 8; Kissel/Mayer GVG 7. Aufl. § 17 Rn. 9 f.). Nachträgliche Veränderungen führen grundsätzlich nicht zum Verlust des einmal gegebenen Rechtswegs. Dieser in § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG enthaltene Grundsatz der perpetuatio fori gilt jedoch nur rechtswegerhaltend. Alle bis zur letzten Tatsachenverhandlung eintretenden Umstände, welche die zunächst bestehende Unzulässigkeit des Rechtswegs beseitigen, sind dagegen zu berücksichtigen, sofern nicht vorher ein (rechtskräftiger) Verweisungsbeschluss ergeht (Kissel NJW 1991, 945, 948 ff.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann ZPO 72. Aufl. § 17 GVG Rn. 3, § 261 ZPO Rn. 31; MüKoZPO/Zimmermann § 17 GVG Rn. 6; Musielak/Wittschier ZPO § 17 GVG Rn. 4; PG/Bitz 5. Aufl. § 17 GVG Rn. 7; Stein/Jonas/Jacobs 22. Aufl. § 17 GVG Rn. 12; Thomas/Putzo/Hüßtege § 17 GVG Rn. 3; Wieczorek/Schütze/Schreiber 3. Aufl. § 17 GVG Rn. 4; Zöller/Lückemann ZPO § 17 GVG Rn. 2). Wird vorab gemäß § 17a Abs. 3 GVG über die Rechtswegzuständigkeit entschieden, sind spätere zuständigkeitsbegründende Veränderungen auch im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nach § 17a Abs. 4 GVG zu berücksichtigen, wenn sie dort zulässigerweise eingeführt werden können (BGH 18. Mai 1995 - I ZB 22/94 - zu II 3 a der Gründe, BGHZ 130, 13; Zöller/Lückemann aaO). Dies dient vor allem der Prozessökonomie (Kissel NJW 1991, 945, 948; Wieczorek/Schütze/Schreiber aaO; Zöller/Lückemann aaO) und soll vermeiden, dass ein Rechtsstreit verwiesen wird, auch wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Zulässigkeit des Rechtswegs die Zuständigkeit des entscheidenden Gerichts begründet ist. Die veränderten zuständigkeitsrelevanten Umstände können damit dazu führen, dass ein ursprünglich begründeter Verweisungsantrag unbegründet wird (MüKoZPO/Becker-Eberhard § 261 Rn. 80; zur Möglichkeit der Erledigungserklärung in einem solchen Fall: BGH 11. Januar 2001 - V ZB 40/99 - zu II 1 der Gründe)., sind dagegen zu berücksichtigen, sofern nicht vorher ein (rechtskräftiger) Verweisungsbeschluss ergeht.3. Bei der Amtsniederlegung eines Geschäftsführers handelt es sich um eine formfreie, einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die grundsätzlich jederzeit und fristlos erfolgen kann. Unbeschadet möglicher abweichender (gesellschafts-)vertraglicher Regelungen genügt es für den Zugang der Amtsniederlegungserklärung, wenn die Erklärung einem der Gesellschafter oder im Fall einer juristischen Person einem der gesetzlichen Vertreter zugeht. Mit dem Zugang der Erklärung über die Amtsniederlegung bei den Gesellschaftern einer GmbH endet das Amt als Geschäftsführer, ohne dass es auf die Eintragung ins Handelsregister ankommt.Bei der Amtsniederlegung handelt es sich um eine formfreie, einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die grundsätzlich jederzeit und fristlos erfolgen kann (Zöllner/Noack in Baumbach/Hueck GmbHG 20. Aufl. § 38 Rn. 86; Altmeppen in Roth/Altmeppen GmbHG 7. Aufl. § 38 Rn. 75). Unbeschadet möglicher abweichender (gesellschafts-)vertraglicher Regelungen genügt es für den Zugang der Amtsniederlegungserklärung, wenn die Erklärung einem der Gesellschafter oder im Fall einer juristischen Person einem der gesetzlichen Vertreter zugeht (BGH 17. September 2001 - II ZR 378/99 - zu 1 der Gründe, BGHZ 149, 28). Ob im Einzelfall ein wichtiger Grund für die Amtsniederlegung objektiv gegeben ist, spielt für deren sofortige Wirksamkeit keine Rolle (BGH 8. Februar 1993 - II ZR 58/92 - zu 2 b bb der Gründe, BGHZ 121, 257). Mit dem Zugang der Erklärung über die Amtsniederlegung bei den Gesellschaftern einer GmbH endet das Amt als Geschäftsführer, ohne dass es auf die Eintragung ins Handelsregister ankommt. Diese wirkt ebenso wie im Fall der Abberufung nur deklaratorisch (Altmeppen in Roth/Altmeppen aaO). Die fehlende Eintragung beeinträchtigt deshalb die Wirksamkeit der Niederlegung nicht (Zöllner/Noack in Baumbach/Hueck aaO und § 39 Rn. 24). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Beschluss vom 04.02.2013 – 10 AZB 78/12 | ArbGG §§ 3, 51. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und b ArbGG sind die Gerichte für Arbeitssachen ausschließlich zuständig für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis und über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses. Wer Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsgerichtsgesetzes ist, bestimmt § 5 ArbGG.2. Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbGG sind Arbeitnehmer Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.3. Nach § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG gelten jedoch in Betrieben einer juristischen Person oder einer Personengesamtheit Personen nicht als Arbeitnehmer, die kraft Gesetzes, Satzung oder Gesellschaftsvertrags allein oder als Mitglieder des Vertretungsorgans zur Vertretung der juristischen Person oder der Personengesamtheit berufen sind. Für einen Rechtsstreit zwischen dem Vertretungsorgan und der juristischen Person sind nach dieser gesetzlichen Fiktion die Gerichte für Arbeitssachen nicht berufen. Die Fiktion der Norm gilt auch für das der Organstellung zugrunde liegende Rechtsverhältnis. Sie greift unabhängig davon ein, ob das der Organstellung zugrunde liegende Rechtsverhältnis materiell-rechtlich als freies Dienstverhältnis oder als Arbeitsverhältnis ausgestaltet ist. Auch wenn ein Anstellungsverhältnis zwischen der juristischen Person und dem Mitglied des Vertretungsorgans wegen dessen starker interner Weisungsabhängigkeit als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren ist und deshalb materielles Arbeitsrecht zur Anwendung kommt, sind zur Entscheidung eines Rechtsstreits aus dieser Rechtsbeziehung die ordentlichen Gerichte berufen (BAG 26. Oktober 2012 - 10 AZB 60/12- Rn. 16, NZA 2013, 54; 15. März 2011 - 10 AZB 32/10- Rn. 11, AP ArbGG 1979 § 2 Nr. 95 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 44; 3. Februar 2009 - 5 AZB 100/08 - Rn. 8, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 66 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 43; 20. August 2003 - 5 AZB 79/02 - zu B I 2 bis 4 der Gründe, BAGE 107, 165). An der Unzuständigkeit der Arbeitsgerichte ändert es nichts, wenn zwischen den Prozessparteien streitig ist, wie das Anstellungsverhältnis zu qualifizieren ist (BAG 6. Mai 1999 - 5 AZB 22/98 - zu II 3 b der Gründe, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 46 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 33). § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG greift sogar ein, wenn objektiv feststeht, dass das Anstellungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis ist. Die Fiktion des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG soll sicherstellen, dass die Mitglieder der Vertretungsorgane mit der juristischen Person selbst dann keinen Rechtsstreit im „Arbeitgeberlager“ vor dem Arbeitsgericht führen, wenn die der Organstellung zugrunde liegende Beziehung als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren ist (BAG 20. August 2003 - 5 AZB 79/02 - zu B I 3 der Gründe, aaO).4. Für Ansprüche der Klagepartei aus dem der Geschäftsführertätigkeit zugrunde liegenden Vertrag sind deshalb die ordentlichen Gerichte ohne Weiteres zuständig (vgl. BAG 20. Mai 1998 - 5 AZB 3/98- zu II 1 der Gründe, NZA 1998, 1247).5. Anders kann es jedoch dann liegen, wenn und soweit der Rechtsstreit nicht das der Organstellung zugrunde liegende Rechtsverhältnis betrifft, sondern eine weitere Rechtsbeziehung besteht. Insoweit greift die Fiktion des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG nicht ein (BAG 23. August 2011 - 10 AZB 51/10- Rn. 13, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 69 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 46; 15. März 2011 - 10 AZB 32/10- Rn. 11, AP ArbGG 1979 § 2 Nr. 95 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 44; 3. Februar 2009 - 5 AZB 100/08 - Rn. 8, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 66 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 43). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Organvertreter Rechte auch mit der Begründung geltend macht, nach der Abberufung als Geschäftsführer habe sich das nicht gekündigte Anstellungsverhältnis - wieder - in ein Arbeitsverhältnis umgewandelt (BAG 6. Mai 1999 - 5 AZB 22/98 - zu II 3 c der Gründe, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 46 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 33).6. Eine Zuständigkeit der Arbeitsgerichte kann ferner dann gegeben sein, wenn die Klagepartei Ansprüche aus einem auch während der Zeit als Geschäftsführer nicht aufgehobenen Arbeitsverhältnis nach Abberufung als Organmitglied geltend macht. Zwar liegt der Berufung eines Arbeitnehmers zum Geschäftsführer einer GmbH eine vertragliche Abrede zugrunde, die regelmäßig als ein Geschäftsführerdienstvertrag zu qualifizieren ist und mit der das Arbeitsverhältnis grundsätzlich aufgehoben wird (vgl. bspw. BAG 3. Februar 2009 - 5 AZB 100/08- Rn. 8, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 66 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 43; 5. Juni 2008 - 2 AZR 754/06- Rn. 23, AP BGB § 626 Nr. 211; 19. Juli 2007 - 6 AZR 774/06 - Rn. 10, BAGE 123, 294). Zwingend ist dies aber nicht. Zum einen kann die Bestellung zum Geschäftsführer einer GmbH auch auf einem Arbeitsvertrag beruhen. Zum anderen bleibt der Arbeitsvertrag bestehen, wenn der Arbeitnehmer aufgrund einer formlosen Abrede zum Geschäftsführer der GmbH bestellt wird, da eine wirksame Aufhebung des früheren Arbeitsverhältnisses die Einhaltung der Schriftform des § 623 BGB voraussetzt (vgl. BAG 15. März 2011 - 10 AZB 32/10 - Rn. 12, AP ArbGG 1979 § 2 Nr. 95 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 44; 3. Februar 2009 - 5 AZB 100/08 - Rn. 8, aaO). Ansprüche aus diesem Arbeitsvertrag können dann nach Abberufung aus der Organschaft und damit nach dem Wegfall der Fiktion des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG vor den Gerichten für Arbeitssachen geltend gemacht werden. Dies gilt auch für die während der Zeit der Geschäftsführerbestellung auf dieser arbeitsvertraglichen Basis entstandenen Ansprüche (BAG 29. Mai 2012 - 10 AZB 3/12 - Rn. 13).7. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat an der organschaftlichen Stellung nichts geändert, die Organstellung des Organs einer juristischen Person bleibt durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens unberührt (BGH 26. Januar 2006 - IX ZR 282/03- Rn. 6, ZInsO 2006, 260; Uhlenbruck in Karsten Schmidt/Uhlenbruck Die GmbH in Krise, Sanierung und Insolvenz 4. Aufl. S. 707). Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens macht aus gesetzlichen Vertretern der Schuldnerin keine Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsgerichtsgesetzes (GMP/Germelmann/Müller-Glöge ArbGG 7. Aufl. § 5 Rn. 45). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Beschluss vom 15.03.2011 - 10 AZB 32/10 | 1. Für eine Klage eines GmbH-Geschäftsführers gegen die Kündigung seines Anstellungsvertrags durch die GmbH scheidet der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen aus. Nur dann, wenn der Rechtsstreit zwischen dem Mitglied des Vertretungsorgans und der juristischen Person nicht das der Organstellung zugrunde liegende Rechtsverhältnis, sondern eine weitere Rechtsbeziehung betrifft, greift die Fiktion des § 5 Abs 1 S 3 ArbGG nicht ein.2. Nach der Bestellung eines Arbeitnehmers zum Geschäftsführer einer GmbH ist eine weitere Rechtsbeziehung regelmäßig zu verneinen. Mit dem Abschluss des Geschäftsführer-Dienstvertrags wird das bisherige Arbeitsverhältnis des angestellten Mitarbeiters im Zweifel aufgehoben.3. Die wirksame Aufhebung des früheren Arbeitsverhältnisses setzt jedoch die Einhaltung des Schriftformerfordernisses nach § 623 BGB voraus. Diese wird regelmäßig durch den Abschluss eines schriftlichen Geschäftsführer-Dienstvertrags gewahrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Beschluss vom 15.12.2011 - 7 ABR 56/10 | AktG §§ 15 ff.; DrittelbG1. Nach § 2 Abs. 1 DrittelbG nehmen an der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer des herrschenden Unternehmens eines Konzerns (§ 18 Abs. 1 AktG) auch die Arbeitnehmer der übrigen Konzernunternehmen teil. Die Verweisung auf § 18 Abs. 1 AktG zeigt, dass kein eigenständiger mitbestimmungsrechtlicher Konzernbegriff gilt. Maßgeblich sind die Regelungen des Aktiengesetzes. Aufgrund der Verweisung auf § 18 Abs. 1 AktG setzt die Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat des herrschenden Unternehmens durch Arbeitnehmer anderer Konzernunternehmen einen sog. Unterordnungskonzern voraus. Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AktG bilden ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen einen Unterordnungskonzern, wenn sie unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst sind.2. Von einem abhängigen Unternehmen wird nach § 18 Abs. 1 Satz 3 AktG vermutet, dass es mit dem herrschenden Unternehmen einen Konzern bildet (vgl. zu § 54 Abs. 1 BetrVG: BAG 9. Februar 2011 - 7 ABR 11/10 - Rn. 24 und 26, EzA BetrVG 2001 § 54 Nr. 5; 27. Oktober 2010 - 7 ABR 85/09 - Rn. 26, EzA BetrVG 2001 § 54 Nr. 4). § 2 Abs. 1 DrittelbG verweist insgesamt auf § 18 Abs. 1 AktG, sodass auch die Konzernvermutung des § 18 Abs. 1 Satz 3 AktG anzuwenden ist (vgl. nur Wlotzke/Wißmann/Koberski/Kleinsorge/Kleinsorge, § 2 DrittelbG Rn. 3).3. Nach § 17 Abs. 1 AktG sind abhängige Unternehmen rechtlich selbständige Unternehmen, auf die ein anderes Unternehmen (herrschendes Unternehmen) unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss hat. Nach § 17 Abs. 2 AktG wird von einem in Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen vermutet, dass es von dem an ihm mit Mehrheit beteiligten Unternehmen abhängig ist. Gehört die Mehrheit der Anteile eines rechtlich selbständigen Unternehmens einem anderen Unternehmen, ist das Unternehmen nach § 16 Abs. 1 AktG ein in Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen. Für die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen der § 17 Abs. 1, § 18 Abs. 1 AktG ist unerheblich, in welcher Rechtsform das herrschende und die abhängigen Unternehmen geführt werden. Der Unternehmensbegriff wird in §§ 15 ff. AktG rechtsformneutral verwendet (vgl. zu § 54 Abs. 1 BetrVG: BAG 9. Februar 2011 - 7 ABR 11/10 - Rn. 26, EzA BetrVG 2001 § 54 Nr. 5; 27. Oktober 2010 - 7 ABR 85/09 - Rn. 26, EzA BetrVG 2001 § 54 Nr. 4). Nach bisher ganz überwiegender Auffassung führt eine Mehrheitsbeteiligung an Personengesellschaften allerdings erst dann zur Abhängigkeit, wenn im Gesellschaftsvertrag in wichtigen Fragen der Geschäftspolitik das Einstimmigkeitsprinzip des § 119 Abs. 1 HGB abbedungen ist (vgl. BAG 22. November 1995 - 7 ABR 9/95 - zu B II 1 b der Gründe m. w. N., AP BetrVG 1972 § 54 Nr. 7 = EzA BetrVG 1972 § 54 Nr. 5; abweichend dagegen für § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EBRG, der anders als § 2 Abs. 1 DrittelbG allerdings keine ausdrückliche Verweisung auf das AktG enthält, BAG 30. März 2004 - 1 ABR 61/01 - zu B IV 2 a bb (2) (c) (bb) der Gründe, BAGE 110, 100).4. Bei einer KG ist die Geschäftsführung aber allein Angelegenheit der persönlich haftenden Gesellschafter. Die Kommanditisten sind hiervon nach § 164 Satz 1 HGB ausgeschlossen. Wird die KG in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG geführt, die nur einen einzigen Komplementär hat, genügt für die Abhängigkeit die mehrheitliche Beteiligung an der Komplementär-GmbH (vgl. BAG 22. November 1995 - 7 ABR 9/95 – a. a. O. m. w. N.).5. Die Konzernvermutung des § 18 Abs. 1 Satz 3 AktG kann widerlegt werden. Die Konzernvermutung ist widerlegt, wenn das herrschende Unternehmen keine einheitliche Leitung ausübt. Um die Konzernvermutung zu widerlegen, müssen ohne Rücksicht auf die Abhängigkeit des untergeordneten Unternehmens Tatsachen festgestellt werden, aus denen sich ergibt, dass herrschendes und abhängiges Unternehmen nicht einheitlich geleitet werden. Dazu muss für alle wesentlichen Bereiche der Unternehmenspolitik nachgewiesen werden, dass die Unternehmensentscheidungen ohne beherrschende Einflussnahme der Mehrheitsgesellschaft getroffen werden (vgl. BAG 16. August 1995 - 7 ABR 57/94 - zu B II 2 a der Gründe, BAGE 80, 322). Um die Konzernvermutung zu widerlegen, muss feststehen, dass das herrschende Unternehmen die Mittel, die die Ausübung einheitlicher Leitung ermöglichen, nicht zu diesem Zweck einsetzt und dass die Bereiche, in denen die einheitliche Leitung üblicherweise sichtbar wird, ausschließlich und nachhaltig entsprechend dem uneingeschränkten Eigeninteresse des abhängigen Unternehmens gesteuert werden. Vereinzelte Einflussnahmen des herrschenden Unternehmens schließen es aber nicht aus, dass die Konzernvermutung widerlegt ist (vgl. zu § 5 Abs. 1 MitbestG: BayObLG 6. März 2002 - 3Z BR 343/00 - zu III 3 b der Gründe, AP MitbestG § 5 Nr. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Beschluss vom 17. September 2014 – 10 AZB 43/14 | § 577 Abs 2 S 3 ZPO, § 576 Abs 3 ZPO, § 547 Nr 1 ZPO, § 575 Abs 2 S 1 ZPO, § 575 Abs 2 S 2 ZPO, § 236 ZPO, § 234 ZPO, § 233 ZPO, § 17a Abs 4 S 4 GVG, § 2 Abs 1 Nr 3 Buchst b ArbGG, § 5 Abs 1 ArbGG, § 48 Abs 1 Nr 2 ArbGG, § 78 S 3 ArbGGVerfügt ein in einer GmbH mitarbeitender Gesellschafter über mehr als 50 % der Stimmrechte, steht er regelmäßig nicht in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft.Auch Gesellschafter können in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft stehen, deren Gesellschafter sie sind (BAG 9. Januar 1990 - 3 AZR 617/88 -; ErfK/Preis § 611 BGB Rn. 140). Dies gilt allerdings dann nicht, wenn ein Gesellschafter als Kapitaleigner einen so großen Einfluss auf die Führung der Gesellschaft hat, dass er über seine Gesellschafterstellung letztlich auch die Leitungsmacht hat. In diesem Fall unterliegt er nicht dem Weisungsrecht des Geschäftsführers. Ob ein solcher Einfluss besteht, richtet sich in erster Linie nach den Stimmrechtsverhältnissen. Dementsprechend kann regelmäßig ein Gesellschafter, dem mehr als 50 % der Stimmrechte zustehen, nicht zugleich Arbeitnehmer dieser Gesellschaft sein. Auch der Minderheitsgesellschafter ist bei Bestehen einer Sperrminorität im Regelfall kein Arbeitnehmer (BAG 6. Mai 1998 - 5 AZR 612/97 - zu I 2 a der Gründe). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Beschluss vom 20.10.2014 - 10 AZB 46/14 | § 2 ArbGG, § 5 ArbGGNachträgliche zuständigkeitsbegründende Umstände sind auch dann zu berücksichtigen, wenn ein zum Zeitpunkt der Klageerhebung vor dem Arbeitsgericht noch nicht abberufener Geschäftsführer vor einer rechtskräftigen Entscheidung über die Rechtswegzuständigkeit abberufen wird; damit entfällt die Fiktionswirkung des § 5 Abs. 1 S. 3 ArbGG mit der Folge, dass der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen zulässig ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Beschluss vom 21. Januar 2019 - 9 AZB 23/18 | § 2 Abs 1 Nr 3 Buchst a ArbGG, § 2 Abs 1 Nr 3 Buchst b ArbGG, § 5 Abs 1 ArbGG, § 611a Abs 1 BGB Der Fremdgeschäftsführer einer GmbH nimmt Arbeitgeberfunktionen wahr und ist deshalb keine arbeitnehmerähnliche, sondern eine arbeitgeberähnliche Person. Tenor 1. Auf die Rechtsbeschwerde der Beklagten wird der Beschluss des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg - Kammern Freiburg - vom 15. Mai 2018 - 9 Ta 16/17 - aufgehoben. Der Rechtsstreit wird an das zuständige Landgericht Waldshut-Tiengen verwiesen. 2. Auf die sofortige Beschwerde der Beklagten wird der Beschluss des Arbeitsgerichts Lörrach vom 30. November 2017 - 3 Ca 350/17 - abgeändert: 3. Die Klägerin hat die Kosten des Beschwerde- und des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu tragen. 4. Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 16.250,00 Euro festgesetzt. Gründe I. Die Parteien streiten über die Zulässigkeit des Rechtswegs zu den Gerichten für Arbeitssachen und in der Hauptsache über die Wirksamkeit einer von der Beklagten ausgesprochenen fristlosen Kündigung. Unternehmensgegenstand der Beklagten ist der Betrieb von Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen. Sie beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter. Ihr jährliches Umsatzvolumen beträgt ca. 55 Mio. Euro. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 7. April 2016 wurde die Klägerin zur Geschäftsführerin der Beklagten gewählt. Zur Regelung der Geschäftsführertätigkeit schlossen die Parteien am 27./29. April 2016 einen „Dienstvertrag“ (DV), in dem es ua. heißt: Darüber hinaus vereinbarten die Parteien im Dienstvertrag ua. als Vergütung der Klägerin ein Jahresgehalt iHv. 175.000,00 Euro brutto sowie eine variable Vergütung iHv. 20.000,00 Euro pro Jahr bei 100-prozentiger Zielerreichung, die Gestellung eines Dienstwagens mit dem Recht der Klägerin zur Privatnutzung, bei einer von der Klägerin nicht zu vertretenden Arbeitsunfähigkeit die Fortzahlung der Vergütung für den Zeitraum von sechs Wochen sowie anschließend weitere Zahlungen, Leistungen der Beklagten zur Alters- und Hinterbliebenenversorgung und die Zahlung eines Sterbegelds an die Erben der Klägerin. Die Klägerin, die mit einem Grad der Behinderung von 50 als schwerbehinderter Mensch anerkannt ist, nahm ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin am 1. November 2016 auf. Am 11. Juli 2017 kündigte sie den Dienstvertrag ordentlich mit Wirkung zum 31. Dezember 2018. Mit Schreiben vom 31. Juli 2017 kündigte die Beklagte das Dienstverhältnis fristlos. Sie behauptet, die Klägerin habe die ihr als Geschäftsführerin obliegenden Pflichten verletzt und sich illoyal verhalten. Ebenfalls am 31. Juli 2017 berief sie die Klägerin mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführerin ab. Mit der am 17. August 2017 beim Arbeitsgericht eingegangenen Klage wendet sich die Klägerin gegen die fristlose Kündigung. Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen sei eröffnet, weil sie Arbeitnehmerin der Beklagten sei. Die Gesellschaft sei nach dem Anstellungsvertrag berechtigt, ihr auch arbeitsbegleitende und verfahrensorientierte Weisungen zu erteilen. Die Gesellschafter hätten auf den Inhalt der von ihr vorzubereitenden Präsentationen und Tischvorlagen einen so großen Einfluss genommen, dass ihr selbst kein Ermessensspielraum mehr zugestanden habe. Ihr seien regelmäßig Termine für politische Gespräche zugewiesen und deren Wahrnehmung von ihr erwartet worden. Zudem werde die Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen allein durch ihre Rechtsansicht begründet, in einem Arbeitsverhältnis zur Beklagten zu stehen. Der Erfolg der Klage sei vom Bestehen eines Arbeitsverhältnisses abhängig. Die fristlose Kündigung sei nicht nur unwirksam, weil es an einem wichtigen Grund fehle, sondern auch wegen fehlender Zustimmung des Integrationsamts. Jedenfalls sei der beschrittene Rechtsweg eröffnet, weil ihre Stellung der einer arbeitnehmerähnlichen Person entspreche. Die Einkünfte bei der Beklagten stellten ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage dar. Sie sei deshalb wie eine Arbeitnehmerin schutzbedürftig. Die Klägerin hat den Antrag angekündigt Die Beklagte hat die Zulässigkeit des Rechtswegs zu den Gerichten für Arbeitssachen gerügt und beantragt, den Rechtsstreit an das Landgericht Waldshut-Tiengen zu verweisen. Sie hat die Auffassung vertreten, die Klägerin stehe als Geschäftsführerin in einem freien Dienstverhältnis. Das Arbeitsgericht hat den Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen für zulässig erklärt. Das Landesarbeitsgericht hat die sofortige Beschwerde der Beklagten zurückgewiesen. Mit der vom Landesarbeitsgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Beklagte weiterhin die Verweisung des Rechtsstreits an das Landgericht Waldshut-Tiengen. II. Die nach § 17a Abs. 4 Satz 4 GVG statthafte und nach § 78 ArbGG, §§ 574 ff. ZPO zulässige Rechtsbeschwerde der Beklagten ist begründet. Das Landesarbeitsgericht hat die sofortige Beschwerde der Beklagten gegen den Beschluss des Arbeitsgerichts zu Unrecht zurückgewiesen. 1. Das Landesarbeitsgericht hat - wie schon das Arbeitsgericht - zur Begründung der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, es könne im Sinne einer Wahlfeststellung dahingestellt bleiben, ob das Vertragsverhältnis der Parteien ein Arbeitsverhältnis sei. Der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen sei nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und Buchst. b iVm. § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG eröffnet, weil die Klägerin im Verhältnis zur Beklagten als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen sei. 2. Dies hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. Der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen ist nicht eröffnet. Es handelt sich nicht um eine Streitigkeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber iSv. § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und Buchst. b ArbGG. a) Die Gerichte für Arbeitssachen sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und Buchst. b ArbGG ausschließlich zuständig für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis und über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses. Wer Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsgerichtsgesetzes ist, bestimmt § 5 ArbGG. aa) Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbGG sind Arbeitnehmer Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer gelten nach § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten sowie sonstige Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind. bb) Auszugehen ist dabei vom allgemeinen nationalen und nicht von einem unionsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff (vgl. zum Status von Geschäftsführern: zur gerichtlichen Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen nach der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 EuGH 10. September 2015 - C-47/14 - [Holterman Ferho Exploitatie ua.] Rn. 41 ff.; zur Massenentlassungsrichtlinie 98/59/EG EuGH 9. Juli 2015 - C-229/14 - [Balkaya] Rn. 34; zur Mutterschutzrichtlinie 92/85/EWG EuGH 11. November 2010 - C-232/09 - [Danosa] Rn. 51). Die Frage des Zugangs zu den Gerichten für Arbeitssachen und der Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche der nationalen Gerichte fällt nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts. Das Arbeitsgerichtsgesetz basiert nicht auf Unionsrecht und setzt dieses nicht um. § 5 ArbGG liegt keine unionsrechtliche Bestimmung zugrunde (vgl. BAG 8. September 2015 - 9 AZB 21/15 - Rn. 13; GMP/Müller-Glöge 9. Aufl. § 5 Rn. 45a; Boemke RdA 2018, 1, 21 mwN; Reinfelder RdA 2016, 87, 89; Vielmeier NZA 2016, 1241; Lunk NJW 2015, 528). Durch dieses Verständnis wird dem Dienstverpflichteten ein ggf. unionsrechtlich vermittelter Schutz nicht versagt. Der unionsrechtliche Arbeitnehmerbegriff ist in Bereichen, in denen Unionsrecht anzuwenden ist, das nicht auf den Arbeitnehmerbegriff des nationalen Rechts verweist, unabhängig davon zu beachten, ob der Rechtsstreit vor den Gerichten für Arbeitssachen oder den ordentlichen Gerichten geführt wird. b) Entgegen den Entscheidungen der Vorinstanzen scheidet vorliegend eine Wahlfeststellung aus, bei der dahingestellt bliebe, ob das Vertragsverhältnis der Parteien ein Arbeitsverhältnis ist. Zwar kann die Rechtswegbestimmung grundsätzlich im Rahmen einer Wahlfeststellung getroffen werden, weil nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und Buchst. b iVm. § 5 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 ArbGG der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen schon dann eröffnet ist, wenn die klagende Partei entweder Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähnliche Person ist (vgl. BAG 21. Dezember 2010 - 10 AZB 14/10 - Rn. 7; 14. Januar 1997 - 5 AZB 22/96 - zu II der Gründe). Eine Wahlfeststellung ist vorliegend jedoch nicht möglich, weil die Klägerin weder Arbeitnehmerin noch arbeitnehmerähnliche Person ist. aa) Der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen ist nicht schon nach § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG ausgeschlossen. Die Klägerin wurde nach den in der Rechtsbeschwerde nicht angegriffenen Feststellungen des Landesarbeitsgerichts von der Beklagten am 31. Juli 2017 mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als Geschäftsführerin abberufen. bb) Der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen ist nicht nach § 5 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 ArbGG eröffnet. Der rechtliche Charakter des Anstellungsverhältnisses eines Organvertreters ändert sich nicht allein dadurch, dass er abberufen wird. Das Anstellungsverhältnis wird durch den Abberufungsakt nicht zum Arbeitsverhältnis (vgl. BAG 15. November 2013 - 10 AZB 28/13 - Rn. 16; 25. Juni 1997 - 5 AZB 41/96 - zu II 1 b aa der Gründe; 21. Februar 1994 - 2 AZB 28/93 - zu II 3 b bb der Gründe) und der Organvertreter nicht zur arbeitnehmerähnlichen Person. Die Gerichte für Arbeitssachen sind deshalb zur Entscheidung des Rechtsstreits nur berufen, wenn es sich um eine arbeitsrechtliche Streitigkeit iSv. § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und Buchst. b ArbGG handelt. Dies ist vorliegend nicht der Fall. (1) Die Rechtswegzuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen ist nicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und Buchst. b iVm. § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbGG gegeben, weil die Klägerin nicht Arbeitnehmerin der Beklagten ist. (a) Wie das Landesarbeitsgericht unter zutreffender Auslegung des Klagebegehrens zu Recht erkannt hat, begründet die bloße Behauptung der Klägerin, das Vertragsverhältnis der Parteien sei als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren, nicht die Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und Buchst. b ArbGG. Es handelt sich bei der Klage nicht um einen sog. Sic-non-Fall. (aa) Die Fallgruppen „sic non“, „aut aut“ und „et et“ hat die Rechtsprechung im Hinblick auf die Frage entwickelt, welche Anforderungen an das klägerische Vorbringen zur Begründung der Rechtswegzuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen in Abgrenzung zu den ordentlichen Gerichten zu stellen sind (vgl. BAG 8. September 2015 - 9 AZB 21/15 - Rn. 18 mwN). Ein sog. Sic-non-Fall liegt vor, wenn die Klage nur dann begründet sein kann, wenn das Rechtsverhältnis als Arbeitsverhältnis einzuordnen ist und nach wirksamer Beendigung der Organstellung als solches fortbestand oder wieder auflebte. In diesem Fall eröffnet bei streitiger Tatsachengrundlage die bloße Rechtsansicht der Klagepartei, es handele sich um ein Arbeitsverhältnis, den Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen (BAG 3. Dezember 2014 - 10 AZB 98/14 - Rn. 17; 15. November 2013 - 10 AZB 28/13 - Rn. 21 mwN). (bb) Die Klägerin greift die fristlose Kündigung der Beklagten vom 31. Juli 2017 - über den engen Wortlaut des Klageantrags hinausgehend - ausweislich der Klagebegründung, die bei der Auslegung des Klageantrags zu berücksichtigen ist (vgl. zu den Auslegungsgrundsätzen BAG 2. August 2018 - 6 AZR 188/17 - Rn. 17 mwN), unabhängig davon an, ob das zwischen den Parteien bestehende Anstellungsverhältnis als Arbeitsverhältnis oder als freies Dienstverhältnis einzuordnen ist. Sie stellt die Wirksamkeit der fristlosen Kündigung unter allen in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten zur Überprüfung. Dieses Auslegungsergebnis wird durch die Erklärungen der Klägerin im Rahmen des Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahrens bestätigt. Der Erfolg der Klage ist damit nicht von ihrer Arbeitnehmerstellung abhängig. Die Klägerin könnte im vorliegenden Rechtsstreit auch dann obsiegen, wenn die Kündigung eines Dienstverhältnisses in Rede stünde und deshalb nicht der vorherigen Zustimmung des Integrationsamts bedurft hätte. Auch bei Bestehen eines freien Dienstverhältnisses wäre die Wirksamkeit der Kündigung am Maßstab des § 626 BGB zu überprüfen. 22(b) Die Voraussetzungen eines Arbeitsverhältnisses mit der Beklagten hat die Klägerin nicht schlüssig dargelegt. (aa) Ein Arbeitsverhältnis unterscheidet sich von einem Dienstverhältnis durch den Grad der persönlichen Abhängigkeit, in der sich der zur Dienstleistung Verpflichtete befindet. Nach § 611a Abs. 1 BGB ist Arbeitnehmer, wer durch den Arbeitsvertrag im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. Die durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze vom 21. Februar 2017 (BGBl. I S. 258, 261) eingefügte, am 1. April 2017 in Kraft getretene Regelung des § 611a BGB entspricht hinsichtlich der Abgrenzung von Arbeitsverhältnis und freiem Dienstverhältnis in Abs. 1 den nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts geltenden, aus § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 HGB abgeleiteten Grundsätzen (vgl. hierzu BAG 17. Oktober 2017 - 9 AZR 792/16 - Rn. 12; 11. August 2015 - 9 AZR 98/14 - Rn. 16). (bb) Der Geschäftsführer einer GmbH wird für diese in aller Regel auf der Grundlage eines freien Dienstvertrags, nicht eines Arbeitsvertrags tätig. Sein Dienstvertrag ist auf eine Geschäftsbesorgung durch Ausübung des Geschäftsführeramts gerichtet (vgl. BAG 24. November 2005 - 2 AZR 614/04 - Rn. 18, BAGE 116, 254; BGH 10. Mai 2010 - II ZR 70/09 - Rn. 7). Dies gilt unabhängig davon, ob der (Fremd-)Geschäftsführer einen starken Anteilseigner oder einen weiteren Geschäftsführer neben sich hat, der die konkrete Geschäftstätigkeit bestimmend mitgestaltet. Es kommt insoweit nicht entscheidend darauf an, welchen Gebrauch der GmbH-Geschäftsführer im Innenverhältnis nach § 37 Abs. 1 GmbHG von seiner im Außenverhältnis wegen §§ 35, 37 Abs. 2 GmbHG unbeschränkten Vertretungsbefugnis machen darf. § 37 Abs. 1 GmbHG ist eine Norm zur Abgrenzung der Kompetenzen der Gesellschaftsorgane untereinander. Auch gegenüber einem Geschäftsführer als freiem Dienstnehmer steht der Gesellschaft ein unternehmerisches Weisungsrecht zu. Berücksichtigt man dies, kann eine Weisungsgebundenheit des GmbH-Geschäftsführers, die so stark ist, dass sie darüber hinaus auf einen Status des betroffenen GmbH-Geschäftsführers als Arbeitnehmer schließen lässt, allenfalls in extremen Ausnahmefällen in Betracht kommen (vgl. BAG 24. November 2005 - 2 AZR 614/04 - aaO). Ein Arbeitsverhältnis setzt voraus, dass die Gesellschaft eine - über ihr gesellschaftsrechtliches Weisungsrecht hinausgehende - Weisungsbefugnis auch bezüglich der Umstände hat, unter denen der Geschäftsführer seine Leistung zu erbringen hat, und die konkreten Modalitäten der Leistungserbringung durch arbeitsbegleitende und verfahrensorientierte Weisungen bestimmen kann (vgl. BAG 26. Mai 1999 - 5 AZR 664/98 - zu III 2 b der Gründe). (cc) Die Voraussetzungen eines solchen Ausnahmefalls sind im Streitfall nicht erfüllt. Weder der Dienstvertrag noch die von der Klägerin behauptete tatsächliche Vertragsdurchführung lässt den Schluss zu, die Klägerin sei intern Weisungen der Beklagten unterlegen, die es rechtfertigten, das Anstellungsverhältnis als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren. (aaa) Die Regelungen des Dienstvertrags weisen das Vertragsverhältnis nicht als Arbeitsverhältnis aus und begründen kein Weisungsrecht der Beklagten, das über ein gesellschaftsrechtliches hinausgeht. Die Bestimmung von Zeit und Ort der Dienstleistung bleibt der Geschäftsführerin vorbehalten. Soweit sich nach § 2 Nr. 2 DV die Rechte und Pflichten und der Umfang der Entscheidungsbefugnisse der Geschäftsführerin aus dem für die Gesellschaft bestehenden Gesellschaftsvertrag und den dazu erlassenen Dienstanweisungen und ggf. aus der zusätzlich erlassenen Geschäftsordnung für die Geschäftsführerin ergeben, werden allein die nach § 37 Abs. 1 GmbHG möglichen internen Beschränkungen der Befugnisse eines Geschäftsführers wiedergegeben. Die in § 2 Nr. 3 DV vorgesehene Auskunfts- und Berichtspflicht dient allein der Information der Gesellschafter und ist notwendige Grundlage der von den Gesellschaftern zu treffenden Entscheidungen. Sie geht nicht über gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen eines Geschäftsführers hinaus. Auch die aus § 2 Nr. 1 DV resultierenden Verpflichtungen, die Dienstleistung persönlich zu erbringen und die volle Arbeitskraft den ihr übertragenen Aufgaben zu widmen, sind kein Indiz für das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses, sondern Folge der Organstellung als Geschäftsführerin, die dem Vertragsverhältnis zugrunde liegt. Gleiches gilt für die Verpflichtung, die Einbringung des Urlaubs mit den betrieblichen Belangen abzustimmen (§ 12 Nr. 1 DV). § 11 DV sieht entgegen der Ansicht der Klägerin kein Nebentätigkeitsverbot vor, das als Indiz gegen die Selbstständigkeit der Klägerin sprechen könnte (vgl. BAG 15. Dezember 1999 - 5 AZR 770/98 - zu II 2 i der Gründe). Die Bestimmung stellt die Aufnahme der dort aufgeführten Tätigkeiten außerhalb des Vertragsverhältnisses mit der Beklagten unter Erlaubnisvorbehalt. Ein solcher Erlaubnisvorbehalt berechtigt den Dienstgeber nicht, die Aufnahme einer Nebentätigkeit willkürlich zu verwehren. Daraus folgt, dass die Klägerin als Dienstverpflichtete einen Anspruch auf Zustimmung bzw. Einwilligung hat, wenn die Aufnahme der Nebentätigkeit berechtigte Interessen der Beklagten nicht beeinträchtigt. Ein Erlaubnisvorbehalt ist somit nicht einem Nebentätigkeitsverbot gleichzusetzen. Er dient nur dazu, dem Dienstgeber bereits vor Aufnahme der Nebentätigkeit die Überprüfung zu ermöglichen, ob seine Interessen beeinträchtigt werden. Im Ergebnis wird der Klägerin mit § 11 DV lediglich aufgegeben, die Beklagte vor Aufnahme einer Nebentätigkeit zu unterrichten (vgl. zur Nebentätigkeit im Arbeitsverhältnis BAG 11. Dezember 2001 - 9 AZR 464/00 - zu II 2 a bb der Gründe, BAGE 100, 70). (bbb) Aus § 1 Nr. 1 Satz 3 DV, dem zufolge die Klägerin „als Organvertreterin ‚Leitende Angestellte‘ im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes (§ 14 Abs. 1 KSchG)“ sei, kann nicht geschlossen werden, die Parteien hätten ein Arbeitsverhältnis vereinbart. § 14 Abs. 1 Nr. 1 KSchG enthält für die darin bezeichneten Organvertreter eine negative Fiktion, die unabhängig davon eingreift, ob das der Organstellung zugrunde liegende schuldrechtliche Anstellungsverhältnis materiell-rechtlich als Arbeitsverhältnis oder als freies Dienstverhältnis zu qualifizieren ist (vgl. BAG 21. September 2017 - 2 AZR 865/16 - Rn. 12 ff.; 25. Oktober 2007 - 6 AZR 1045/06 - Rn. 22). (ccc) Dass die Klägerin als GmbH-Geschäftsführerin, die nicht am Gesellschaftskapital beteiligt ist (sog. Fremdgeschäftsführerin), abhängig beschäftigt iSv. § 7 Abs. 1 SGB IV ist (vgl. BSG 14. März 2018 - B 12 KR 13/17 R - Rn. 18), steht einem freien Dienstverhältnis nicht entgegen. Der Begriff des Arbeitnehmers iSv. § 5 ArbGG und der des sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses sind nicht deckungsgleich (vgl. BAG 8. Mai 2018 - 9 AZR 531/17 - Rn. 20; GMP/Müller-Glöge 9. Aufl. § 5 Rn. 14; Reinfelder RdA 2016, 87, 89). (ddd) Die Vertragsdurchführung lässt nicht den Schluss zu, die Parteien hätten abweichend von den Bestimmungen des Dienstvertrags ein Arbeitsverhältnis begründen wollen. Die Vorgaben bezüglich der Gestaltung und Abstimmung von Vorlagen für die Gesellschafterversammlung gehen nicht über unternehmerische Weisungen hinaus. Soweit sich die Klägerin im Rechtsbeschwerdeverfahren auf eine Einflussnahme der Gesellschafter auf die Einstellung von Chef- und Oberärzten und die Personalplanung sowie die Aufforderung bezieht, Gespräche mit dem Oberarzt Dr. T zu führen, ist ihr Vortrag unsubstanziiert. Gleiches gilt für die von der Klägerin behaupteten Weisungen, politische Gesprächstermine wahrzunehmen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass einzelne Vorgänge der Vertragsabwicklung zur Feststellung eines vom Vertragswortlaut abweichenden Geschäftsinhalts nur geeignet sind, wenn es sich dabei nicht um untypische Einzelfälle, sondern um beispielhafte Erscheinungsformen einer durchgehend geübten Vertragspraxis handelt (BAG 27. Juni 2017 - 9 AZR 133/16 - Rn. 29 mwN). Dies ergibt sich aus dem Vorbringen der Klägerin nicht. Es ist deshalb nicht entscheidungserheblich, dass der von der Beklagten bestrittene Vortrag der Klägerin, soweit er neue Tatsachen betrifft, die nicht Gegenstand des angegriffenen Beschlusses des Landesarbeitsgerichts sind, in der Rechtsbeschwerdeinstanz gemäß § 577 Abs. 2 Satz 4 iVm. § 559 ZPO nicht berücksichtigungsfähig ist (vgl. BAG 18. November 2015 - 10 AZB 43/15 - Rn. 11 f., BAGE 153, 261). (2) Der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen ist auch nicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und Buchst. b iVm. § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG eröffnet. Die Klägerin ist nicht arbeitnehmerähnliche Person iSv. § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG. (a) Arbeitnehmerähnliche Personen sind Selbstständige, die nach § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG als Arbeitnehmer gelten. Sie unterscheiden sich von Arbeitnehmern durch den Grad der persönlichen Abhängigkeit. Arbeitnehmerähnliche Personen sind - in der Regel wegen ihrer fehlenden oder gegenüber Arbeitnehmern geringeren Weisungsgebundenheit, oft auch wegen fehlender oder geringerer Eingliederung in eine betriebliche Organisation - in wesentlich geringerem Maße persönlich abhängig als Arbeitnehmer. An die Stelle der persönlichen Abhängigkeit tritt das Merkmal der wirtschaftlichen Abhängigkeit bzw. wirtschaftlichen Unselbstständigkeit. Außerdem muss die wirtschaftlich abhängige Person ihrer gesamten sozialen Stellung nach einem Arbeitnehmer vergleichbar sozial schutzbedürftig sein (st. Rspr., vgl. nur BAG 17. Januar 2006 - 9 AZR 61/05 - Rn. 14; 30. August 2000 - 5 AZB 12/00 - zu II 2 b der Gründe; 22. Februar 1999 - 5 AZB 56/98 - zu B II der Gründe; 2. Oktober 1990 - 4 AZR 106/90 - BAGE 66, 95; BGH 21. Oktober 1998 - VIII ZB 54/97 - zu II 3 der Gründe). (b) Bei dem Begriff der „arbeitnehmerähnlichen Person“ iSv. § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, bei dessen Anwendung dem Tatsachengericht ein Beurteilungsspielraum zukommt. Die Würdigung des Beschwerdegerichts, ob ein Selbstständiger eine arbeitnehmerähnliche Person ist, ist nur daraufhin überprüfbar, ob das Beschwerdegericht den Rechtsbegriff der arbeitnehmerähnlichen Person selbst verkannt, Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verletzt, bei der Subsumtion den Rechtsbegriff wieder aufgegeben oder wesentliche Umstände außer Betracht gelassen hat (vgl. BAG 17. Oktober 2017 - 9 AZR 792/16 - Rn. 15; 27. Juni 2017 - 9 AZR 851/16 - Rn. 20 mwN). (c) Diesem eingeschränkten Prüfungsmaßstab hält die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts nicht stand. Das Landesarbeitsgericht ist zunächst zutreffend von den Rechtssätzen ausgegangen, die das Bundesarbeitsgericht aufgestellt hat. Es hat diese jedoch im Hinblick auf die Frage der sozialen Schutzbedürftigkeit der Klägerin rechtsfehlerhaft angewandt. (aa) Das Landesarbeitsgericht hat zu Recht angenommen, dass in Bezug auf die Klägerin die Voraussetzungen einer wirtschaftlichen Abhängigkeit erfüllt sind. Sie ist regelmäßig gegeben, wenn der Selbstständige auf die Verwertung seiner Arbeitskraft und die Einkünfte aus der Tätigkeit für den Vertragspartner zur Sicherung seiner Existenzgrundlage angewiesen ist (vgl. BAG 21. Februar 2007 - 5 AZB 52/06 - Rn. 11, BAGE 121, 304). (bb) Das Beschwerdegericht hat jedoch rechtsfehlerhaft eine mit einem Arbeitnehmer vergleichbare soziale Schutzbedürftigkeit der Klägerin bejaht, indem es zur Begründung erneut auf die wirtschaftliche Abhängigkeit der Klägerin abgestellt und zudem die Besonderheiten der Organstellung einer Geschäftsführerin nicht genügend beachtet hat. (aaa) Soziale Schutzbedürftigkeit ist anzunehmen, wenn unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des Einzelfalls und der Verkehrsanschauung das Maß der Abhängigkeit einen solchen Grad erreicht, wie er im Allgemeinen nur in einem Arbeitsverhältnis vorkommt, und die geleisteten Dienste nach ihrer sozialen Typik mit denen eines Arbeitnehmers vergleichbar sind (st. Rspr., vgl. nur BAG 17. Januar 2006 - 9 AZR 61/05 - Rn. 14; 30. August 2000 - 5 AZB 12/00 - zu II 2 b der Gründe; 2. Oktober 1990 - 4 AZR 106/90 - BAGE 66, 95; BGH 16. Oktober 2002 - VIII ZB 27/02 - zu II 2 b bb der Gründe, BGHZ 152, 213; 21. Oktober 1998 - VIII ZB 54/97 - zu II 3 c der Gründe). (bbb) Die Klägerin ist ihrer gesamten sozialen Stellung nach nicht mit einem Arbeitnehmer vergleichbar. (aaaa) Das Fehlen einer eigenen Betriebsorganisation und eigener Produktionsmittel kann zwar im Einzelfall eine einem Arbeitnehmer vergleichbare soziale Schutzbedürftigkeit begründen (vgl. BAG 16. Juli 1997 - 5 AZB 29/96 - zu II 5 c der Gründe, BAGE 86, 178). Hierbei können jedoch entgegen der Annahme des Landesarbeitsgerichts die soziale Stellung des Selbstständigen im Übrigen und die Besonderheiten des jeweiligen Vertragsverhältnisses nicht außer Betracht bleiben. (bbbb) Die von der Klägerin als Geschäftsführerin geleisteten Dienste sind nach ihrer sozialen Typik nicht mit denen eines Arbeitnehmers vergleichbar. Dies ergibt sich aus der mit ihrem Amt verbundenen Rechtsstellung. Der Geschäftsführer einer GmbH verkörpert als gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft (§ 35 Abs. 1 GmbHG) den Arbeitgeber. Er nimmt Arbeitgeberfunktionen wahr und ist deshalb keine arbeitnehmerähnliche, sondern eine arbeitgebergleiche Person (vgl. BAG 20. August 2003 - 5 AZB 79/02 - zu B I 6 d der Gründe, BAGE 107, 165; BVerwG 26. September 2002 - 5 C 53.01 -), im Fall des Fremdgeschäftsführers jedenfalls aber eine arbeitgeberähnliche Person. Durch die gesetzlichen und nach außen nicht beschränkbaren Vertretungsbefugnisse unterscheidet sich der Geschäftsführer einer GmbH grundlegend von anderen leitenden oder nicht leitenden Arbeitnehmern (vgl. BAG 21. September 2017 - 2 AZR 865/16 - Rn. 34). (cccc) Der arbeitgeberähnlichen Stellung der Klägerin entsprechen die Regelungen des ihrer Organstellung zugrunde liegenden Dienstvertrags. Sie wiesen die Klägerin uneingeschränkt als Vertreterin der Arbeitgeberin und zugleich als soziale Gegenspielerin der Arbeitnehmerschaft aus (vgl. dazu Schaub ArbR-HdB/Vogelsang 17. Aufl. § 14 Rn. 3), indem ihr die Führung der laufenden Geschäfte der Gesellschaft, deren alleinige gerichtliche und außergerichtliche Vertretung (§ 1 Nr. 2 DV), die verantwortliche Leitung des gesamten Geschäftsbetriebs der Gesellschaft sowie der Tochtergesellschaft S GmbH (§ 1 Nr. 4 DV) zugewiesen war. Zudem hatte die Klägerin die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers im Sinne der arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften wahrzunehmen und war Vorgesetzte aller Mitarbeiter der Gesellschaft und der von den Gesellschaftern gestellten Mitarbeiter und diesen weisungsbefugt (§ 2 Nr. 5 DV). III. Es handelt sich demnach um eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit, für die nach § 13 GVG der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten gegeben ist. Der Rechtsstreit ist daher an das zuständige Landgericht (§ 23 Nr. 1, § 71 Abs. 1 GVG) zu verweisen. Die Klägerin ist der von der Beklagten beantragten Verweisung an das nach § 17 Abs. 1 ZPO örtlich zuständige Landgericht Waldshut-Tiengen nicht entgegengetreten. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Beschluss vom 22. Februar 2005 – 3 AZR 499/03 (A) | § 22 UmwG, § 123 UmwG, § 126 UmwG, § 131 UmwG, § 133 UmwG, § 134 UmwG, § 135 Abs 1 UmwG, § 136 UmwG, § 136 UmwG, § 157 UmwG, § 168 UmwG, § 171 UmwG, § 172 UmwG, § 173 UmwG, § 324 UmwG, § 414 BGB, § 415 BGB, § 613a BGB, § 4 BetrAVG, Art 3 Abs 1 GG, § 91a ZPODer Übergang einer Versorgungsverbindlichkeit durch Spaltungsplan im Rahmen einer Umwandlung ist nicht von einer Zustimmung des Versorgungsberechtigten und/oder des Pensions-Sicherungs-Vereins abhängig. Er wird auch nicht durch einen ausdrücklichen Widerspruch des Berechtigten verhindert. Das gilt auch im Falle der Privatisierung kommunaler Einrichtungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Beschluss vom 23.08.2011 - 10 AZB 51/10 | ArbGG §§ 2, 5; GmbHG § 35; BGB § 6231. Nach § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG gelten in Betrieben einer juristischen Person oder einer Personengesamtheit Personen nicht als Arbeitnehmer, die kraft Gesetzes, Satzung oder Gesellschaftsvertrag allein oder als Mitglieder des Vertretungsorgans zur Vertretung der juristischen Person oder der Personengesamtheit berufen sind. Für einen Rechtsstreit zwischen dem Vertretungsorgan und der juristischen Person sind nach dieser gesetzlichen Fiktion die Gerichte für Arbeitssachen nicht berufen.2. Die Fiktion der Norm gilt auch für das der Organstellung zugrunde liegende Rechtsverhältnis. Sie greift unabhängig davon ein, ob das der Organstellung zugrunde liegende Rechtsverhältnis materiell-rechtlich als freies Dienstverhältnis oder als Arbeitsverhältnis ausgestaltet ist. Auch wenn ein Anstellungsverhältnis zwischen der juristischen Person und dem Mitglied des Vertretungsorgans wegen dessen starker interner Weisungsabhängigkeit als ein Arbeitsverhältnis zu qualifizieren ist und deshalb materielles Arbeitsrecht zur Anwendung kommt, sind zur Entscheidung eines Rechtsstreits aus dieser Rechtsbeziehung die ordentlichen Gerichte berufen (BAG 15. März 2011 - 10 AZB 32/10 - Rn. 11, NZA 2011, 874; 3. Februar 2009 - 5 AZB 100/08 - Rn. 8, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 66 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 43; 20. August 2003 - 5 AZB 79/02 - zu B I 2 bis 4 der Gründe, BAGE 107, 165; 23. August 2001 - 5 AZB 9/01 - zu II 1 der Gründe, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 54 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 36; 6. Mai 1999 - 5 AZB 22/98 - zu II 3 b der Gründe, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 46 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 33). An der Unzuständigkeit der Arbeitsgerichte ändert es nichts, dass zwischen den Prozessparteien streitig ist, wie das Anstellungsverhältnis zu qualifizieren ist (BAG 6. Mai 1999 - 5 AZB 22/98 - zu II 3 b der Gründe, aaO).3. § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG greift sogar ein, wenn objektiv feststeht, dass das Anstellungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis ist. Die Fiktion des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG soll sicherstellen, dass die Mitglieder der Vertretungsorgane mit der juristischen Person selbst dann keinen Rechtsstreit im „Arbeitgeberlager“ vor dem Arbeitsgericht führen, wenn die der Organstellung zugrunde liegende Beziehung als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren ist (BAG 20. August 2003 - 5 AZB 79/02 - zu B I 3 der Gründe, aaO).4. Dies gilt auch dann, wenn der Geschäftsführer geltend macht, er sei wegen seiner eingeschränkten Kompetenz in Wirklichkeit Arbeitnehmer gewesen (BAG 14. Juni 2006 - 5 AZR 592/05 - Rn. 16, BAGE 118, 278; 6. Mai 1999 - 5 AZB 22/98 - zu II 3 bB I 2 der Gründe, aaO; Schwab/Weth/Kliemt ArbGG 3. Aufl. § 5 Rn. 271).5. Für Ansprüche, die während der Zeit als Geschäftsführer entstanden sind, sind deshalb die ordentlichen Gerichte ohne Weiteres immer dann zuständig, wenn sie noch während der Geschäftsführerbestellung gerichtlich geltend gemacht werden (vgl. BAG 20. Mai 1998 - 5 AZB 3/98 - zu II 1 der Gründe, NZA 1998, 1247). Nur so kann dem Zweck der gesetzlichen Fiktion des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG entsprochen und ein Arbeitsgerichtsprozess im „Arbeitgeberlager“ vermieden werden.6. Etwas anderes kann sich jedoch dann ergeben, wenn dem Rechtsstreit zwischen dem Mitglied des Vertretungsorgans und der juristischen Person nicht das der Organstellung zugrunde liegende Rechtsverhältnis, sondern eine weitere Rechtsbeziehung zugrunde liegt. In diesem Fall greift die Fiktion des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG nicht ein (BAG 15. März 2011 - 10 AZB 32/10 - Rn. 11, NZA 2011, 874; 3. Februar 2009 - 5 AZB 100/08 - Rn. 8, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 66 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 43;10. Juni 2006 - 5 AZR 592/05 - Rn. 16, BAGE 118, 278, aaO; 20. August 2003 - 5 AZB 79/02 - zu B I 2 der Gründe, BAGE 107, 165; 23. August 2001 - 5 AZB 9/01 - zu II 1 der Gründe, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 54 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 36; 11. Mai 1999 - 5 AZB 22/98 - zu II 3 c der Gründe, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 46 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 33). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Organvertreter Rechte mit der Begründung geltend macht, nach der Abberufung als Geschäftsführer habe sich das nicht gekündigte Anstellungsverhältnis - wieder - in ein Arbeitsverhältnis umgewandelt (BAG 6. Mai 1999 - 5 AZB 22/98 - zu II 3 c der Gründe, aaO).7. Eine Zuständigkeit der Arbeitsgerichte kann ferner dann gegeben sein, wenn der Kläger Ansprüche aus einem auch während der Zeit als Geschäftsführer nicht aufgehobenen Arbeitsverhältnis nach Abberufung als Organmitglied geltend macht. Zwar liegt der Berufung eines Arbeitnehmers zum Geschäftsführer einer GmbH eine vertragliche Abrede zugrunde, die regelmäßig als ein Geschäftsführer-Dienstvertrag zu qualifizieren ist und mit der das Arbeitsverhältnis grundsätzlich aufgehoben wird (vgl. bspw. BAG 3. Februar 2009 - 5 AZB 100/08 - Rn. 8, AP ArbGG 1979 § 5 Nr. 66 = EzA ArbGG 1979 § 5 Nr. 43; 5. Juni 2008 - 2 AZR 754/06 - Rn. 23, AP BGB § 626 Nr. 211; 19. Juli 2007 - 6 AZR 774/06 - Rn. 10, BAGE 123, 294). Zwingend ist dies aber nicht. Zum einen kann die Bestellung zum Geschäftsführer einer GmbH auch auf einem Arbeitsvertrag beruhen. Zum anderen bleibt der Arbeitsvertrag bestehen, wenn der Arbeitnehmer aufgrund einer formlosen Abrede zum Geschäftsführer der GmbH bestellt wird, da eine wirksame Aufhebung des früheren Arbeitsverhältnisses die Einhaltung der Schriftform des § 623 BGB voraussetzt (vgl. BAG 15. März 2011 - 10 AZB 32/10 - Rn. 12, NZA 2011, 874; 3. Februar 2009 - 5 AZB 100/08 - Rn. 8, aaO).8. Ansprüche aus diesem Arbeitsvertrag können dann nach Abberufung aus der Organschaft und damit nach dem Wegfall der anwendbaren Fiktion des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG vor den Gerichten für Arbeitssachen geltend gemacht werden. Dies gilt auch für die während der Zeit der Geschäftsführerbestellung auf dieser arbeitsvertraglichen Basis entstandenen Ansprüche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Urteil vom 03. Dezember 2008 – 5 AZR 74/08 | § 611 BGB, § 242 BGB, § 75 Abs 1 BetrVG, § 256 ZPODer arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz findet jedenfalls dann unternehmensweit Anwendung, wenn die verteilende Entscheidung des Arbeitgebers nicht auf einen einzelnen Betrieb beschränkt ist, sondern sich auf alle oder mehrere Betriebe des Unternehmens bezieht. Eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Betrieben ist nur zulässig, wenn es hierfür sachliche Gründe gibt.Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz verpflichtet den Arbeitgeber in Bezug auf seine Arbeitnehmer. Jedenfalls dann, wenn eine verteilende Entscheidung des Arbeitgebers nicht auf einen einzelnen Betrieb beschränkt ist, sondern sich auf alle oder mehrere Betriebe des Unternehmens bezieht, ist auch die Gleichbehandlung betriebsübergreifend zu gewährleisten. Eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Betrieben ist nur zulässig, wenn es hierfür sachliche Gründe gibt (vgl. Senat 8. November 2006 - 5 AZR 5/06 - mwN, BAGE 120, 97, 102; BAG 2. August 2006 - 10 AZR 572/05 - Rn. 34 ff., EzA BetrVG 2001 § 75 Nr. 3; Senat 14. Juni 2006 - 5 AZR 584/05 - BAGE 118, 268, 272 ff.; wenn BAG 12. Oktober 2005 - 10 AZR 640/04 - BAGE 116, 136, 139 an den Betrieb anknüpft, stellt das keine Abweichung dar, da die dortige Beklagte nur einen Betrieb hatte und allein innerhalb des Betriebs differenzierte) . Dabei sind die Besonderheiten des Unternehmens und der Betriebe zu berücksichtigen. Der Unternehmensbezug des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist mittlerweile auch im arbeitsrechtlichen Schrifttum weitgehend anerkannt (vgl. nur ErfK/Preis 9. Aufl. § 611 BGB Rn. 574 ff., 583 ff.; HWK/Thüsing 3. Aufl. § 611 BGB Rn. 199; Schaub/Linck Arbeitsrechts-Handbuch 12. Aufl. § 112 Rn. 15, 27; Joussen in Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching Arbeitsrecht Kommentar § 611 BGB Rn. 267 ff., 273 alle mwN) . Auch § 1b Abs. 1 Satz 4 BetrAVG als gesetzliche Ausprägung enthält keine Einschränkung (vgl. BAG 27. Juni 2006 - 3 AZR 352/05 (A) - BAGE 118, 340, 342 f.) . Der Gleichbehandlungsgrundsatz des § 75 Abs. 1 BetrVG wirkt für Gesamtbetriebsrat und Arbeitgeber ebenfalls überbetrieblich (vgl. BAG 18. September 2007 - 3 AZR 639/06 - Rn. 19 ff., AP BetrVG 1972 § 77 Betriebsvereinbarung Nr. 33 = EzA BetrAVG § 1 Gleichbehandlung Nr. 30) . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Urteil vom 03. Mai 2006 - 10 AZR 319/05 | BGB § 611I. Soweit der Kläger von der Beklagten die Zahlung von 2, 1 Millionen Euro verlangt und insoweit sein Klageziel weiterverfolgt, ist die Revision zulässig, aber unbegründet. Für den Zahlungsanspruch besteht keine Anspruchsgrundlage.1. Ein Anspruch des Klägers auf Zahlung von Carried Interest ergibt sich nicht aus § 611 Abs. 1 BGB iVm. dem Arbeitsvertrag.a) Es kann offen bleiben, ob es sich bei den Erklärungen im Arbeitsvertrag um typische oder nichttypische Willenserklärungen handelt. Die Auslegung nichttypischer Vertragserklärungen durch die Tatsachengerichte ist in der Revisionsinstanz nur daraufhin überprüfbar, ob sie gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, Denkgesetze, Erfahrungssätze oder Verfahrensvorschriften verstößt oder wesentliche Umstände unberücksichtigt lässt und ob sie rechtlich möglich ist (st. Rspr., vgl. BAG 16. November 2005 – 10 AZR 108/05 –; 13. März 2003 – 6 AZR 585/01 – BAGE 105, 205, 208; 5. Juni 2002 – 7 AZR 241/01 – BAGE 101, 262; 15. November 2000 – 5 AZR 296/99 – BAGE 96, 237, 241 mwN). Die Auslegung sog. typischer Willenserklärungen durch das Berufungsgericht ist dagegen in der Revisionsinstanz in vollem Umfang nachprüfbar (st. Rspr., vgl. BAG 13. März 2003 – 6 AZR 698/01 –, zu 1 der Gründe; 19. Januar 2000 – 5 AZR 637/98 – BAGE 93, 212, 215; 16. Februar 2000 – 4 AZR 14/99 – BAGE 93, 328, 338, jeweils mwN). Die Auslegung des Arbeitsvertrages durch das Landesarbeitsgericht hielte auch dieser uneingeschränkten Überprüfung stand.b) Gemäß § 157 BGB sind Verträge so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Dabei ist nach § 133 BGB der wirkliche Wille des Erklärenden zu erforschen und nicht am buchstäblichen Sinn des Ausdrucks zu haften. Bei der Auslegung sind alle tatsächlichen Begleitumstände der Erklärung zu berücksichtigen, die für die Frage von Bedeutung sein können, welchen Willen der Erklärende bei seiner Erklärung gehabt hat und wie die Erklärung von ihrem Empfänger zu verstehen war (BAG 26. September 2002 – 6 AZR 434/00 – AP BBiG § 10 Nr. 10 = EzA BBiG § 10 Nr. 6, zu I 3 der Gründe; 12. Juni 2002 – 10 AZR 323/01 – EzA BetrVG 1972 § 112 Nr. 110, zu II 1 b der Gründe). Danach hat die Tochtergesellschaft der Beklagten DB Industrial Holdings AG dem Kläger im Arbeitsvertrag weder ausdrücklich noch konkludent eine Carried-Interest-Zahlung zugesagt, so dass die Beklagte nach ihrem Eintritt in das Arbeitsverhältnis keine Zahlungszusage ihrer Tochtergesellschaft zu erfüllen hat.c) Das folgt bereits aus dem insoweit eindeutigen Wortlaut des Arbeitsvertrages. In diesem hat die DB Industrial Holdings AG dem Kläger als freiwillige variable Vergütung einen auf das Geschäftsjahr bezogenen Bonus zugesagt, wobei sich die Höhe der Bonuszahlung auf der Grundlage von Zielvereinbarungen an der Leistung des Klägers sowie am Geschäftsergebnis zu orientieren hatte. Für das erste Jahr seiner Tätigkeit hat die Beklagte dem Kläger einen Bonus in Höhe von 102.260,00 Euro garantiert. Für eine Carried-Interest-Zahlung fehlt eine rechtsverbindliche Zusicherung. Mit der Formulierung "Es ist vorgesehen, … die Bonuszahlung im Verlauf des Jahres 2001 durch ein Carried Interest Modell zu ersetzen" hat sich die DB Industrial Holdings AG entgegen der Auffassung des Klägers weder dem Grunde geschweige denn der Höhe nach zu einer Carried-Interest-Zahlung verpflichtet. "Vorsehen" bedeutet vom Wortsinn her "in Aussicht nehmen" (Wahrig Deutsches Wörterbuch 7. Aufl.), "beabsichtigen" (Duden Das große Wörterbuch der deutschen Sprache 3. Aufl.). Mit der von ihnen bekundeten Absicht, die Bonuszahlung durch ein Carried-Interest-Modell zu ersetzen, haben die DB Industrial Holdings AG und der Kläger noch keinen Anspruch des Klägers auf Zahlung von Carried Interest begründet.2. Auch in dem am 10. Dezember 2001 mit dem Kläger geführten Personalgespräch hat die Beklagte dem Kläger nach ihrem Eintritt in das Arbeitsverhältnis eine Beteiligung an einem Carried-Interest-Modell nicht zugesagt. Der Kläger hat zwar behauptet, sein Vorgesetzter F habe ihm an diesem Tag im Rahmen eines persönlichen Personal- und Gehaltsgespräches mitgeteilt, dass für das Jahr 2002 und die Folgejahre ein jährliches Investitionskapital von 500 Millionen Euro zur Verfügung stehe, sein persönlicher Anteil 0, 30 % an allen aus diesem Kapital erzielten Gewinnen betrage und dieser Anteil auf der Basis der in der Vergangenheit erzielten Renditen einem Betrag iHv. 2, 1 Millionen Euro entspreche. Auch wenn zu Gunsten des Klägers unterstellt würde, dass sein Vorgesetzter F die Beklagte nach § 164 Abs. 1 Satz 1 BGB an sich zur Zahlung von Carried Interest verpflichten konnte, folgte daraus kein arbeitsvertraglicher Anspruch des Klägers auf eine Carried-Interest-Zahlung der Beklagten. Eine Vergütung des Klägers nach einem Carried-Interest-Modell ist in dem nachfolgenden, vom Vorgesetzten des Klägers F mitunterzeichneten Schreiben der Beklagten vom 20. Dezember 2001 weder vorgesehen noch auch nur erwähnt. Die Beklagte hat dem Kläger in diesem Schreiben nur die Erhöhung seines Gehalts zum 1. Januar 2002 sowie die Bonusregelung für das Geschäftsjahr 2002 mitgeteilt. Das Landesarbeitsgericht hat nicht festgestellt, dass der Kläger gegenüber der Beklagten Einwände bezüglich dieser Vergütungsmitteilung erhoben und auf Grund des Gesprächs mit seinem Vorgesetzten F am 10. Dezember 2001 seinen Anspruch auf eine Carried-Interest-Zahlung angemeldet hat. Der Kläger hatte dies auch nicht behauptet. Er vertritt in der Revisionsbegründung vielmehr selbst die Auffassung, seine Vergütung nach dem Carried-Interest-Modell sei zunächst noch offen und ungeregelt geblieben.3. Gegen die Annahme des Landesarbeitsgerichts, aus dem Schreiben der Beklagten vom 1. Juli 2002, in dem diese dem Kläger seine Teilnahme am Carried-Interest-Plan der DB Capital Partners Europe Group und seinen Anteil am Carried Interest bestätigt habe, ergebe sich keine Zahlungsverpflichtung der Beklagten, richtet sich kein Angriff der Revision. Der Kläger leitet aus dem Inhalt des Schreibens die beanspruchte Zahlung von Carried Interest nicht ab. Er rügt nur, das Landesarbeitsgericht habe den bloßen Informationscharakter des Schreibens verkannt, und vertritt die Auffassung, das Schreiben könne schon nach seinem Wortlaut nicht als vertragsändernde, konstitutive Regelung akzeptiert werden. Die Beklagte habe in dem Schreiben kein Vertragsangebot abgegeben, das er hätte annehmen können, sondern nur bestätigt, was für ihn und jeden vernünftigen Dritten sowieso klar gewesen sei, nämlich die Ablösung der bisher einseitig von der Beklagten festgesetzten, traditionellen Bonuszahlung durch ein Carried-Interest-Modell.4. Ohne Erfolg beansprucht der Kläger die Zahlung von Erfolgbeteiligung iHv. 2, 1 Millionen Euro für das Kalenderjahr 2002 als im Bereich Private Equity übliche Vergütung.a) Der Anspruch ergibt sich nicht aus § 612 Abs. 1 BGB. Nach dieser Vorschrift gilt eine Vergütung als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Das betrifft Fälle, in denen weder durch Gesetz, Tarifvertrag oder einzelvertragliche Vereinbarung noch auf sonstiger Grundlage eine Vergütung festgelegt ist (BAG 28. Januar 2004 – 5 AZR 530/02 – BAGE 109, 254, 263). § 612 Abs. 1 BGB greift auch dann ein, wenn über die vertraglich geschuldete Tätigkeit hinaus eine Sonderleistung erbracht wird, die durch die vereinbarte Vergütung nicht abgegolten ist und weder einzelvertraglich noch tarifvertraglich geregelt ist, wie diese Dienste zu vergüten sind (BAG 29. Januar 2003 – 5 AZR 703/01 – AP BGB § 612 Nr. 66; 21. März 2002 – 6 AZR 456/01 – AP TVG § 1 Tarifverträge: Musiker Nr. 17 = EzA TVG § 4 Musiker Nr. 2). Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Der Arbeitsvertrag enthält eine Vergütungsregelung. Er regelt die Grundvergütung des Klägers und den als freiwillige variable Vergütung auf das Geschäftsjahr bezogenen Bonus. Der Kläger hat nur die von ihm geschuldete Tätigkeit ausgeübt und keine Sonderleistungen erbracht. Ein Rückgriff auf § 612 Abs. 1 BGB scheidet damit aus.b) Auch aus § 612 Abs. 2 BGB folgt der Anspruch nicht. Nach dieser Bestimmung ist in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen, wenn die Höhe der Vergütung nicht bestimmt ist. Diese Vorschrift ist auch anwendbar, wenn die Vergütungsvereinbarung unwirksam ist (BAG 28. September 1994 – 4 AZR 619/93 – AP BeschFG 1985 § 2 Nr. 38 = EzA BGB § 612 Nr. 17). Daran fehlt es. Die im Arbeitsvertrag getroffene Vergütungsabrede ist wirksam.5. Die Teilnahme des Klägers am Carried-Interest-Plan der DB Capital Partners Europe Group im Jahr 2002 hat keine Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung von Carried Interest begründet.a) Die Beklagte hat dem Kläger nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts, die weder der Kläger mit Rügen noch die Beklagte mit Gegenrügen angegriffen hat und die den Senat damit binden, die Teilnahme am Carried-Interest-Plan im Jahr 2002 ermöglicht. Ende des Jahres 2002 wurde der Kläger Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaft DB Capital Partners (Europe) 2002 Founder Partner LP mit Sitz in Delaware (USA). Mit Recht hat das Landesarbeitsgericht erkannt, dass aus der Teilnahme des Klägers am Carried-Interest-Plan mangels entsprechender Absprachen der Parteien keine Zahlungsverpflichtung der Beklagten folgt.b) Ohne Erfolg rügt der Kläger, die Beklagte habe seinen Anspruch auf die Carried-Interest-Zahlung selbst zu erfüllen und ihre Zahlungsverpflichtung nicht wirksam auf einen Dritten überleiten können, insbesondere nicht auf eine Konzerngesellschaft ausländischen Rechts. Der Kläger verkennt, dass weder die DB Industrial Holdings AG noch die Beklagte selbst nach den vertraglichen Abmachungen jemals zu einer Carried-Interest-Zahlung verpflichtet waren und die von ihm behauptete Überleitung einer Zahlungspflicht auf einen Dritten damit nicht vorliegt.aa) Die im Arbeitsvertrag festgehaltene Absicht, im Zusammenhang mit der Neuordnung der variablen Vergütung die Bonuszahlung im Verlauf des Jahres 2001 durch ein Carried-Interest-Modell zu ersetzen, zwingt nicht zu der Annahme, die Zahlung des Carried Interest hätte durch die Beklagte selbst zu erfolgen. Dies bleibt im Arbeitsvertrag offen. Dieser enthält keine näheren Angaben zu dem vorgesehenen Carried-Interest-Modell. Im Übrigen fällt das gewählte Modell des Carried Interest unter Einschaltung einer Drittgesellschaft unter die vom Kläger selbst als mögliche Varianten der Carried-Interest-Modelle genannten Gestaltungen. Die Teilnahme im Bereich Private Equity tätiger Angestellter an einem Carried-Interest-Plan ist auch keine Vergütung im engeren Sinn. Sie ist ein Anreiz für besondere Anstrengungen, entwicklungsfähige Unternehmen zu identifizieren und sie nach der Akquisition in ihrer strategischen Weiterentwicklung so zu unterstützen, dass sie später, gegebenenfalls nach ihrer Umstrukturierung, Reorganisation oder Aufteilung, nach einer deutlichen Erhöhung ihres Wertes mit möglichst hohem Gewinn veräußert werden können. In Bezug auf diese Anreizfunktion unterscheidet sich die Teilnahme an einem Carried-Interest-Plan nicht grundlegend von einem Aktienoptionsplan als Anreiz für das leitende Konzernpersonal, durch besondere Anstrengungen den Wert der Aktie zu steigern. Eine rechtliche Verpflichtung, Aktienoptionen als Teil der arbeitsvertraglich geschuldeten Vergütung zu vereinbaren, besteht nicht (BAG 12. Februar 2003 – 10 AZR 299/02 – BAGE 104, 324, 332). Ebenso wenig besteht eine rechtliche Verpflichtung, Carried-Interest-Modelle so zu gestalten, dass die Zahlung des Carried Interest durch den Arbeitgeber zu erfolgen hat.bb) Auch die steuerliche Einordnung einer Carried-Interest-Zahlung führt entgegen der Auffassung des Klägers nicht zu einer Zahlungsverpflichtung der Beklagten. Zwischen den schuldrechtlichen Beziehungen und den steuerrechtlichen Konsequenzen ist zu differenzieren. Die steuerrechtliche Qualifizierung einer Erfolgbeteiligung ersetzt nicht den schuldrechtlichen Verpflichtungsgrund und verschafft dem Arbeitnehmer keinen weiteren Schuldner (BAG 12. Februar 2003 – 10 AZR 299/02 – BAGE 104, 324, 333).c) Allerdings trifft es zu, dass die Beklagte auf Grund des Inhaltsschutzes des Arbeitsverhältnisses nach § 2 KSchG eine zugesagte Bonuszahlung nicht ohne Zustimmung des Klägers durch ein Carried-Interest-Modell hätte ersetzen können. Dies würde auch dann gelten, wenn die Beklagte selbst die Carried-Interest-Zahlung zu leisten hätte. Die im Arbeitsvertrag als freiwillige variable Vergütung bezeichnete Bonuszahlung ist jedoch entgegen der Behauptung des Klägers nicht durch ein Carried-Interest-Modell ersetzt worden. Die Beklagte hat dem Kläger den im Schreiben vom 20. Dezember 2001 für das Geschäftsjahr 2002 genannten und vom Kläger ausdrücklich beanspruchten "Discretionary Bonus" iHv. 247.000,00 Euro gezahlt. Darüber besteht kein Streit. Die vom Kläger behauptete Entlassung der Beklagten aus einer Zahlungsverpflichtung liegt damit nicht vor. Eine Neuregelung der variablen Vergütung des Klägers ist – anders, als im Arbeitsvertrag vorgesehen – nur insoweit erfolgt, als die Beklagte dem Kläger zusätzlich, nicht an Stelle der Bonuszahlung, die Teilnahme am Carried-Interest-Plan im Jahr 2002 ermöglicht hat. Dies berührt den Inhaltsschutz des Arbeitsverhältnisses nach § 2 KSchG nicht. Schließlich hätte der Kläger das Angebot, Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaft DB Capital Partners (Europe) 2002 Founder Partner LP mit Sitz in Delaware zu werden, auch nicht annehmen müssen.6. Mit Recht hat das Landesarbeitsgericht erkannt, dass die Beklagte nicht wegen Verletzung von Pflichten zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet ist.a) Da das Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 2002 begründet wurde, war § 280 Abs. 1 BGB nF gemäß Art. 229 § 5 EGBGB im Kalenderjahr 2002 noch nicht anwendbar, so dass auf den ungeschriebenen Tatbestand der positiven Vertragsverletzung zurückzugreifen ist. Dieser Tatbestand hat alle schuldhaften Pflichtverletzungen im Rahmen eines bestehenden Schuldverhältnisses erfasst, die weder Unmöglichkeit noch Verzug herbeiführten und deren Folgen im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften nicht geregelt waren. Der Tatbestand der positiven Vertragsverletzung ist jedoch nicht erfüllt. b) Ein die Leistung von Schadensersatz auslösender schuldhafter Pflichtenverstoß der Beklagten liegt entgegen der Auffassung des Klägers nicht deshalb vor, weil die Beklagte die unternehmerische Entscheidung getroffen hat, ihre Aktivitäten im Bereich Private Equity im September 2002 einzustellen. Der Kläger hatte nach dem Arbeitsvertrag keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte ungeachtet der Identifizierung werthaltiger Investitionsobjekte und des mit dem Einsatz ihres Investitionskapitals verbundenen Wagnisses Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen erwirbt. Mangels eines solchen Anspruchs des Klägers fehlt es bereits an einer Pflichtverletzung der Beklagten. aa) Der Kläger hatte im Bereich Private Equity die Aufgabe, geeignete Unternehmen zu identifizieren, die Akquisition vorzubereiten und ggf. das Engagement bis zur Veräußerung zu begleiten. Selbst wenn die Beklagte den Kläger ab September 2002 nach der Einstellung ihrer Aktivitäten im Bereich Private Equity nicht mehr vertragsgemäß beschäftigt hätte, folgte daraus noch nicht der vom Kläger beanspruchte Schadensersatz. Die Entscheidung, ob und ggf. zu welchen Bedingungen Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen erworben und wann und zu welchen Bedingungen diese wieder veräußert wurden, oblag allein der Beklagten. Diese trug auch ausschließlich das Risiko des Fehlschlagens ihrer Investitionen. Auch bei einer Fortführung ihrer Aktivitäten im Bereich Private Equity wäre die Beklagte nicht gegenüber dem Kläger verpflichtet gewesen, innerhalb bestimmter Investitionsperioden Wagniskapital in bestimmter Höhe zu investieren und Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu erwerben oder innerhalb bestimmter Zeiträume wieder zu veräußern. Stellt ein Arbeitgeber seine Aktivitäten im Bereich Private Equity mangels gewinnträchtiger Investitionsmöglichkeiten ein, kommt ein pflichtwidriges, Schadensersatzansprüche auslösendes schuldhaftes Verhalten von vornherein nicht in Betracht, wenn er den an einem Carried-Interest-Plan teilnehmenden Arbeitnehmern den Einsatz von Investitionskapital zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen nicht garantiert hat. [46] bb) Die Erfolgsbeteiligung im Rahmen des Carried-Interest-Modells der Beklagten unterscheidet sich auch deutlich von anderen Vergütungsformen. (1) Sie ist keine Provision. Bei dieser unmittelbar leistungsbezogenen Vergütungsform werden im Gegensatz zum Private-Equity-Geschäft in der Regel standardisierte Geschäfte abgewickelt, deren Zustandekommen der Provisionsberechtigte weitgehend in der Hand hat und die nicht oder doch jedenfalls nicht in so hohem Maße wie beim Private-Equity-Geschäft mit dem Einsatz von Wagniskapital des Arbeitgebers verbunden sind. Deshalb begründet § 87a Abs. 3 Satz 1 HGB auch dann einen Anspruch des Handelsvertreters auf Provision, wenn der Unternehmer das Geschäft ganz oder teilweise nicht oder nicht so ausführt, wie es abgeschlossen worden ist. Auch setzt eine Erfolgsbeteiligung nach dem Carried-Interest-Plan der Beklagten im Gegensatz zu einem Provisionsanspruch voraus, dass nach der Verrechnung der Transaktionen einer Investmentperiode ausschüttungsfähige Gewinne verbleiben. Allerdings entfällt nach § 87a Abs. 3 Satz 2 HGB auch ein Provisionsanspruch, wenn und soweit die Nichtausführung des Geschäfts auf Umständen beruht, die vom Unternehmer nicht zu vertreten sind. [48] (2) Die Erfolgsbeteiligung im Rahmen des Carried-Interest-Modells der Beklagten ist entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts auch keine Tantieme. Eine Tantieme ist eine Gewinnbeteiligung als zusätzliche Vergütung, die prozentual nach dem Jahresgewinn des Unternehmens berechnet wird (ErfK/Preis 6. Aufl. § 611 BGB Rn. 617). Sie gehört zu den Vergütungsbestandteilen, die in das Austauschverhältnis "Arbeit gegen Lohn" einbezogen sind (BAG 8. September 1998 – 9 AZR 273/97 – AP BGB § 611 Tantieme Nr. 2 = EzA BGB § 611 Tantieme Nr. 2). Der Angestellte hat deshalb grundsätzlich keinen Anspruch auf Tantieme, wenn er während des gesamten Geschäftsjahres arbeitsunfähig erkrankt war und keine Entgeltfortzahlung beanspruchen konnte (BAG 8. September 1998 – 9 AZR 273/97 – aaO). Demgegenüber knüpft das Carried-Interest-Modell der Beklagten im Gegensatz zur im Arbeitsvertrag geregelten Bonuszahlung weder an das Geschäftsergebnis der Beklagten an noch orientiert es sich hinsichtlich der Höhe des Carried Interest auf der Grundlage von Zielvereinbarungen an den jeweiligen Leistungen der teilnahmeberechtigten Arbeitnehmer. Die Gesellschafterstellung in der Beteiligungsgesellschaft DB Capital Partners (Europe) 2002 Founder Partner LP ist keine zusätzliche Vergütung, die prozentual nach dem Jahresgewinn der Beklagten berechnet wird. Es ist denkbar, dass trotz eines hohen Jahresgewinns der Beklagten die Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaft keinen Anspruch auf Zahlung von Carried Interest haben, weil nach der Verrechnung der Ergebnisse sämtlicher Investments in der maßgeblichen Investmentperiode und nach Abzug der Kosten kein ausschüttungsfähiger Gewinn erzielt worden ist. Umgekehrt können die am Carried-Interest-Plan der Beklagten teilnehmenden Arbeitnehmer Anspruch auf eine Carried-Interest-Zahlung haben, obwohl die Beklagte keinen oder keinen dieser Erfolgsbeteiligung entsprechenden Gewinn erzielt hat. Wenn allerdings ein in das Austauschverhältnis "Arbeit gegen Lohn" einbezogener Tantiemeanspruch dem Arbeitnehmer grundsätzlich nicht das Recht gibt, auf die unternehmerischen Entscheidungen des Arbeitgebers dann Einfluss zu nehmen, wenn diese den Unternehmensgewinn kürzen (BAG 13. April 1978 – 3 AZR 844/76 – AP BGB § 611 Tantieme Nr. 1 = EzA BGB § 611 Tantieme Nr. 1), dann kann eine nicht in das Austauschverhältnis "Arbeit gegen Lohn" einbezogene Erfolgsbeteiligung in Form eines Carried-Interest-Modells keinen weitergehenden Anspruch des Arbeitnehmers auf Einsatz von Wagniskapital durch den Arbeitgeber im Bereich Private Equity begründen. c) Ohne Erfolg macht der Kläger geltend, die Beklagte habe ihre Pflichten dadurch verletzt, dass sie ihm zu Beginn des Jahres 2002 keine Vorgabe für die Umsetzung seiner ihm zustehenden variablen Vergütung gegeben habe. Die Parteien haben die Teilnahme des Klägers am Carried-Interest-Plan anders als die im Arbeitsvertrag geregelte Bonuszahlung nicht an das Erreichen bestimmter Ziele durch den Kläger geknüpft. Mangels einer Zielvereinbarung war die Beklagte nicht gehalten, dem Kläger für eine Carried-Interest-Zahlung Ziele vorzugeben. d) Der Kläger hat in Bezug auf die Höhe und Fälligkeit des von ihm beanspruchten Schadensersatzes nicht hinreichend substantiiert dargelegt, dass ein Gewinn erzielt worden wäre, der zu einer Carried-Interest-Zahlung an ihn iHv. 2, 1 Millionen Euro für das Jahr 2002 geführt hätte, wenn die Beklagte ihre Aktivitäten im Bereich Private Equity im September 2002 nicht eingestellt hätte. Nach den vom Kläger nicht angegriffenen Feststellungen des Landesarbeitsgerichts investierte die Beklagte im Kalenderjahr 2002 bis Anfang September in dem Geschäftsbereich DB Capital Partners Private Equity Europe Kapital iHv. insgesamt "nur" 75 Millionen Euro, wobei diese Investition ausschließlich eine Beteiligung an dem Unternehmen irischen Rechts J betraf. Der Berechnung seines Zahlungsanspruchs hat der Kläger dagegen ein Investitionskapital iHv. 500 Millionen Euro im Kalenderjahr 2002 und einen Gewinn von 700 Millionen Euro zu Grunde gelegt. Der Kläger hat auch nicht schlüssig dargetan, dass bei einer Fortführung der Aktivitäten der Beklagten im Bereich Private Equity der behauptete Gewinn auf Grund der Veräußerung von im Jahr 2002 erworbener Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen bereits realisiert werden hätte können. Das setzt die Erfolgsbeteiligung nach dem Carried-Interest-Plan der Beklagten aber voraus. II. Die Verfahrensrügen des Klägers haben keinen Erfolg. ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Urteil vom 04. Oktober 2005 – 9 AZR 598/04 | § 57 AktG, § 71 AktG, § 1 Abs 1 Nr 1 HTürGG, § 133 BGB, § 157 BGB, § 241 BGB, § 242 BGB, § 249 BGB, § 611 BGB, § 488 BGB, § 20 UmwG 1995, Art 229 BGBEG, § 126a BGBEin Arbeitgeber, der den Erwerb noch nicht börsennotierter Aktien der Muttergesellschaft durch die Gewährung von zweckgebundenen Arbeitgeberdarlehen fördert, ist verpflichtet, die Arbeitnehmer über die besonderen Risiken aufzuklären, die mit einem möglichen Scheitern des angestrebten Börsengangs verbunden sind. Die schuldhafte Verletzung der Aufklärungspflicht führt zu einem Anspruch des Arbeitnehmers auf Befreiung von der Rückzahlung des Darlehens Zug um Zug gegen Rückgabe der Aktien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Urteil vom 06. Juli 1972 - 2 AZR 386/71 | Hemmung bei Ermittlungen über den Kündigungssachverhalt BGB § 626 1. Der Senat bestätigt folgende Grundsätze seiner bisherigen Rechtsprechung zur Ausschlußfrist des § 626 Abs. 2 Satz 1 und 2 BGB: a) Die Fristenregelung ist mit dem Grundgesetz vereinbar. b) Die Frist ist eine materiell-rechtliche Ausschlußfrist. Ihre Versäumung führt zur Unwirksamkeit der außerordentlichen Kündigung wegen Fehlens des wichtigen Grundes. Die Unwirksamkeit muß unter der Geltung des Kündigungsschutzgesetzes gemäß § 13 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 KSchG durch fristgerechte Feststellungsklage geltend gemacht werden. c) Die Frist beginnt, sobald der Kündigungsberechtigte eine zuverlässige und möglichst vollständige positive Kenntnis der für die Kündigung maßgebenden Tatsachen, des sog. Kündigungssachverhalts hat, die ihm die Entscheidung ermöglicht, ob die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zumutbar ist oder nicht. Zu den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen gehören sowohl die für als auch die gegen die Kündigung sprechenden Umstände. d) Im Falle der Arbeitgeberkündigung beginnt die Frist In der Regel erst, nachdem der Arbeitnehmer über den Vorfall angehört ist, der zur Kündigung führen soll. Das gilt insbesondere bei der sog. Verdachtskündigung. Welches Ergebnis die Anhörung hat, ist für den Lauf der Frist ohne Bedeutung. e) Für die Einhaltung der Frist ist derjenige darlegungs- und beweispflichtig, der die Kündigung erklärt. 2. Die Grundsätze zu 1c-d werden dahin ergänzt, daß die Ausschlußfrist jedenfalls so lange gehemmt ist, wie der Kündigungsberechtigte aus verständigen Gründen mit der gebotenen Eile noch Ermittlungen über den Kündigungssachverhalt anstellt und der Kündigungsgegner dies erkennen kann. 3. Das gilt gerade auch für den Fall, daß der Arbeitgeber vor Ausspruch der außerordentlichen Kündigung den Arbeitnehmer anhört. Diese Anhörung wirkt allerdings nur dann fristhemmend, wenn sie innerhalb kurzer Zeit, die im allgemeinen nicht über eine Woche hinausgehen darf, stattfindet, nachdem der Arbeitgeber den Vorgang kennt, der zur außerordentlichen Kündigung führen könnte. SachverhaltDer Kl. war seit 1966 als Kraftfahrer einer Bundeswehreinheit im Dienst der bekl. BR beschäftigt. Am 9. 6. 1970 war er mit einem anderen Kraftfahrer zur Wagenpflege eingeteilt. Im Laufe des frühen Nachmittags wurden beide von Offizieren und Beamten ihrer Einheit in der Nähe ihres Arbeitsplatzes im Freien schlafend angetroffen. Sie behaupteten, nicht geschlafen, sondern nur eine Pause eingelegt zu haben, weil der zuvor ausgeführte Farbanstrich erst habe trocknen müssen, bis ein zweiter Anstrich mögl. gewesen sei. Die Meldung der Beschäftigungsdienststelle über diesen Vorfall ging am 11. 6. 1970 bei der Standortverwaltung ein, die nach innerdienstl. Vorschriften als "personalbearbeitende Dienststelle" allein befugt war, dem Kl. zu kündigen. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts wurde der Kl. für Dienstag, den 16. 6. 1970, zur Standortverwaltung gebeten und angehört. Dabei brachte er vor, daß er zur Zeit, als er ohne zu arbeiten angetroffen worden war, weitere Arbeiten nicht habe verrichten können. Das veranlaßte die Standortverwaltung zur Überprüfung dieser Angaben. Dabei stellte sich heraus, daß dem Kl. damals doch Arbeiten aufgetragen waren, die während des Trocknens des Farbanstrichs hätten ausgeführt werden können. Am 30. 6. 1970 ging dem Kl. das Schreiben der Bekl. von diesem Tage zu, mit der sie ihm wegen des Vorfalls vom 9. 6. 1970 fristlos kündigte, nachdem - worauf sie zusätzl. hinwies - bereits in den vergangenen 2 Jahren sein dienstl. Verhalten zu wiederholten Abmahnungen, Mißbilligungen und Androhung der außerordentl. Künd. Anlaß gegeben habe; überdies habe sein Vorbringen bei der Anhörung vom 16. 6. 1970 in den entscheidenden Punkten nicht gestimmt. Der Kl. hält die außerordentl. Künd. für rechtsunwirksam, weil die Bekl. die Zweiwochenfrist des § BGB § 626 Abs. BGB § 626 Absatz 2 BGB versäumt habe. Die hiernach erforderl. "Kenntnis der für die Künd. maßgebenden Tatsachen" habe die Bekl. bereits am Tage des Vorfalls, dem 9. 6. 1970, in der Person des Einheitsführers des Kl. gehabt, der selbst den Vorfall beobachtet habe. Auf die Organisation der Bundeswehr in der Frage der Kündigungsbefugnis komme es für den Fristbeginn nicht an. Der Kl. begehrt die Feststellung, daß das ArbVerh. durch die Künd. vom 30. 6. 1970 nicht aufgelöst worden ist. Seiner Klage blieb in beiden Vorinstanzen der Erfolg versagt. Die Rev., die allein die Verletzung des § BGB § 626 Abs. BGB § 626 Absatz 2 BGB rügt, blieb erfolglos. Aus den Gründen:Entgegen der Ansicht der Rev. hat das LAG zutreffend angenommenen, daß die Bekl. die in § BGB § 626 Abs. BGB § 626 Absatz 2 BGB bestimmte Frist zur Erklärung der außerordentl. Künd. nicht versäumt hat. Die Ausführungen des LAG zum wichtigen Grund (§ BGB § 626 Abs. BGB § 626 Absatz 1 BGB) sind nicht angegriffen. Auch sind insoweit Rechtsfehler des angef. Urt. nicht ersichtl. I. Der Senat hat zur Auslegung der mit Wirkung vom 1. 9. 1969 eingeführten Fristenregelung des § BGB § 626 Abs. BGB § 626 Absatz 2 Satz 1 und 2 BGB inzwischen in mehreren Entscheidungen Stellung genommen. Da die Rev. diese Rechtspr. im grundsätzl. angegriffen hat, erscheint es angezeigt, die bisher entwickelten Leitsätze noch einmal anzuführen und, soweit es die Entsch. dieses Rechtsstreits erfordert, zu der inzwischen bekannt gewordenen Kritik Stellung zu nehmen: 1. Die Fristenregelung ist mit dem Grundgesetz vereinbar (Urt. vom 28. 10. 1971 - 2 AZR 32/71 - AP Nr. AP BGB § 626 1 zu § 626 BGB Ausschlußfrist (zu II), auch zur Veröffentl. in der Amtl.Samml. des BAG vorgesehen). Dem hat Herschel (Anm. ArbRBlattei "Künd. VIII" Entsch. 31) uneingeschränkt zugestimmt, während Küchenhoff (Anm. AP a.a.O.), der zunächst die gegenteilige These aufgestellt hatte, seine Bedenken angesichts der Auslegung, die der Senat der Vorschrift im übrigen gegeben hat, nicht mehr aufrechterhält. Damit kann angenommen werden, daß die Verfassungsmäßigkeit der Bestimmung nicht mehr in Frage gestellt wird. 2. Die Zweiwochenfrist ist eine materiellrechtl. Ausschlußfrist. Das Ges. schreibt vor, daß der wichtige Grund zur außerordentl. Künd. wegen des reinen Zeitablaufs verwirkt sei. Es gilt die unwiderlegl. Vermutung, daß bei Versäumung der Frist - mag der Kündigungsgrund auch noch so schwerwiegend gewesen sein - die Fortsetzung des ArbVerh. nicht unzumutbar, die außerordentl. Künd. unwirksam ist, weil es so angesehen wird, als ob der wichtige Grund fehle. Demgemäß muß nach § KSCHG § 13 Abs. KSCHG § 13 Absatz 1 i. Verb. m. § KSCHG § 4 KSchG auch bei Versäumung der Zweiwochenfrist durch den ArbGeb. die Unwirksamkeit der außerordentl. Künd. durch fristgerechte Feststellungsklage geltend gemacht werden. § KSCHG § 13 Abs. KSCHG § 13 Absatz 3 KSchG gilt hier nicht (Urt. vom 8. 6. 1972 - 2 AZR 336/71 - AP Nr. AP KSCHG1969 § 1 zu § 13 KSchG 1969 [zu 1 der Gründe] zur Veröffentl. in der Amtl. Samml. vorgesehen.) Die Frage spielt in diesem Rechtsstreit keine Rolle. Der Kl. hat überdies rechtzeitig Feststellungsklage erhoben. 3. Der Begriff des "Kündigungsberechtigten " (§ BGB § 626 Abs. BGB § 626 Absatz 2 Satz 2 BGB) kennzeichnet - entgegen der Auffassung der Rev. - nicht nur die Parteirolle im ArbVerh., d.h. diejenige Arbeitsvertragspartei, die die Künd. ausspricht, im Falle der ArbGebKünd. beispielsweise die juristische Person, als welche der ArbGeb. im Rechtsverkehr auftritt. Vielmehr ist KündBerechtigter auf der insoweit allein interessierenden ArbGebSeite grundsätzl. diejenige (natürl.) Person, der selbst im gegebenen Fall das Recht zur außerordentl. Künd. eingeräumt ist. Ausnahmsweise kann hinsichtl. der "Kenntnis von den für die Künd. maßgebenden Tatsachen" auch eine andere Person in Betracht kommen, etwa dann, wenn diese eine ähnl. selbständige Stellung wie ein gesetzl. oder rechtsgeschäftl. Vertreter des ArbGeb. hat und nicht nur zur Meldung, sondern vorab auch zur Feststellung der für eine außerordentl. Künd. maßgebenden Tatsachen verpflichtet ist. Groben Unbilligkeiten kann mit der Mißbrauchsregel begegnet werden. (Urt. vom 28. 10. 1971 - 2 AZR 32/71 - AP Nr. AP BGB § 626 1 zu § 626 BGB Ausschlußfrist [zu III]). Diese Auslegung ist von Küchenhof (Anm. AP a.a.O.) bejaht und weiter ausgebaut, von Herschel (Anm. ArbR-Blattei a.a.O.) wohl als zu eng gekennzeichnet und von der Rev. völlig abgelehnt worden. Der Streitfall bietet keinen Anlaß, die Problematik erneut zu erörtern. Darauf wird noch näher einzugehen sein. 4. Die den Fristbeginn auslösende "Kenntnis " des KündBerechtigten muß eine sichere, positive Kenntnis der für die Künd. maßgebenden Tatsachen sein; selbst grob fahrlässige Unkenntnis genügt nicht. Die innerhalb der Zweiwochenfrist anzustellenden Überlegung, ob eine außerordentl. Künd. ausgesprochen werden soll, soll auf der Grundlage einer zuverlässigen und möglichst vollständigen Kenntnis des Kündigungssachverhalts angestellt werden. Die Überlegungsfrist soll dem Kündigungsberechtigten von da an voll zur Verfügung stehen, wo er sich anhand seiner Kenntnis der für und gegen die Künd. sprechenden Umstände entscheiden kann, ob die Fortsetzung des ArbVerh. zumutbar ist oder nicht (Urteil vom 28. 10. 1971 - 2 AZR 32/71 - AP Nr. AP BGB § 626 1 zu § 626 BGB Ausschlußfrist [zu III]). 5. Unter den Tatsachen, die für die Kündigung maßgebend sind, sind i.S. der Zumutbarkeitserwägungen sowohl die für, als auch die gegen die Künd. sprechenden Umstände zu verstehen (so schon zu einer vergleichbaren Tarifregelung BAG AP Nr. AP BGB § 52 zu § 626 BGB [zu 2a]). Die (im Falle der Arbeitgeberkündigung nötige) Kenntnis auch der für den ArbN und gegen die Künd. anzuführenden Tatsachen wird der ArbGeb. in aller Regel erst dann haben, wenn er dem ArbN Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat (Urt. vom 9. 12. 1971 - 2 AZR 118/71 - AP Nr. AP ZA-NATO-TRUPPENSTATUT Artikel 3 zu Art. 56 ZA - Nato-Truppenstatut [zu 3b], auch zur Veröffentl. in der Amtl. Samml. des Gerichts vorgesehen). Das gilt gerade auch für die sog. Verdachtskündigung (Urt. vom 27. 1. 1972 - 2 AZR 157/71 AP Nr. AP BGB § 626 2 zu § 626 BGB Ausschlußfrist [zu 3], auch zur Veröffentl. in der Amtl. Samml. des Gerichts vorgesehen). Solange der KündBerechtigte die zur Aufklärung des Sachverhalts nach pflichtmäßigem Ermessen notwendig erscheinenden Maßnahmen durchführt, insbes. dem Künd.-Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme gibt, kann die Zweiwochenfrist nicht beginnen. Das gilt auch dann, wenn die Maßnahme rückblickend zur Feststellung des Sachverhalts nicht beigetragen hat oder überflüssig gewesen sein sollte (Urt. vom 27. 1. 1972 - 2 AZR 157/71 - AP Nr. AP BGB § 626 2 zu § 626 BGB Ausschlußfrist [zu 3]). In diesem Zusammenhang bemerkt Beitzke (Anm. AP Nr. AP ZA-NATO-TRUPPENSTATUT Artikel 3 zu Art. 56 ZA - Nato-Truppenstatut [zu 3]), die Zweiwochenfrist könne erst dann von einer Anhörung des ArbN an zu laufen beginnen, wenn die Anhörung auch innerhalb angemessener Frist erfolgt sei; der ArbGeb. dürfe durch eine ungebührl. Hinauszögerung der Anhörung die Ausschlußfrist nicht beliebig hinausschieben. 6. Wer die außerordentl. Künd. ausgesprochen hat, muß - wie der Senat inzwischen entschieden hat - im Rechts-streit über die Wirksamkeit der Künd. darlegen und ggf. beweisen, daß er von den für die Künd. maßgebenden Tatsachen erst innerhalb der letzten zwei Wochen vor der KündErklärung Kenntnis erlangt hat (Urt. vom 17. 8. 1972 - 2 AZR 359/71 - AP Nr. AP BGB § 626 4 zu § 626 BGB Ausschlußfrist [zu III 3a der Gründe] zur Veröffentl. in der Amtl. Samml. des Gerichts vorgesehen). II. Der vorl. Streitfall, bei dem über eine ArbGebKünd. zu befinden ist, gibt dem Senat keinen Anlaß, von den vorgenannten Richtlinien seiner Rechtspr. zu § BGB § 626 Abs. BGB § 626 Absatz 2 BGB grundsätzl. abzuweichen. Ledigl. die Frage, ob an dem oben zu I 3 gekennzeichneten Begriff des "Kündigungsberechtigten" festzuhalten ist, soll jetzt offenbleiben, weil es für die Entsch. dieses Rechtsstreits darauf nicht ankommt. 1. Die Künd. ist dem Kl. am 30. 6. 1970 zugegangen. Die Ausschlußfrist des § BGB § 626 Abs. BGB § 626 Absatz 2 BGB ist demnach nur dann eingehalten, wenn die Bekl. erst innerhalb der davor liegenden zwei Wochen, also nicht vor dem 16. 6. 1970, von den für die Künd. maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt hat. Am 16. 6. 1970 war der Kl. zu dem Vorfall vom 9. 6. 1970 bei der Standortverwaltung gehört worden. Bis dahin war - entgegen der Auffassung der Rev. - der Beginn der Ausschlußfrist hinausgeschoben. 2. Nach der Ansicht der Rev., wie sie sich in der mündl. Verhandlung dargestellt hat, liegt der Sinn der Fristenregelung darin, ein unzumutbar gewordenes ArbVerh. schnell, nämlich innerhalb von 2 Wochen nach Eintritt des KündGrundes und Kenntniserlangung des KündBerechtigten hiervon, zu beenden. Das ist jedoch in dieser Allgemeinheit nicht richtig. Der eigentl. Grund für die Neuregelung ist viel äußerl.: Die nach allgemeinen Grundsätzen (schon früher) mögl. Verwirkung des KündRechts wird zeitl. fixiert (vgl. das Urt. vom 8. 6. 1972, AP Nr. AP KSCHG1969 § 1 zu § 13 KSchG 1969). Diese zeitl. Begrenzung aber wird gebunden an die Kenntnis nicht etwa des KündGrundes, worunter man möglicherweise den bestimmten Anlaß verstehen könnte, der die Künd. auslöst, sondern an die Kenntnis "von den für die Künd. maßgebenden Tatsachen. "Maßgebende Tatsachen" wiederum sind nicht nur die Tatumstände, die für, sondern auch diejenigen, die gegen die Künd. sprechen. Wollte man den Begriff anders verstehen, nämlich nur den konkreten KündAnlaß, den "Vorfall" darunter bringen, der einen wichtigen Grund darstellen könnte, dann wäre der KündBerechtigte oft genug gezwungen, nur zur Wahrung der Ausschlußfrist die außerordentl. Künd. auszusprechen, deren Stichhaltigkeit er nicht hat prüfen können. Überflüssige Rechtsstreite - von der Störung im ArbVerh. ganz abgesehen - wären die Folge. Es ist deshalb daran festzuhalten (vgl. die Urt. vom 28. 10. und 9. 12. 1971, AP Nr. AP BGB § 626 1 zu § 626 BGB Ausschlußfrist und AP Nr. AP ZA-NATO-TRUPPENSTATUT Artikel 3 zu Art. 56 ZA-Nato-Truppenstatut), daß die Frist erst dann läuft, wenn der KündBerechtigte den Sachverhalt so weit kennt, daß er eine Gesamtwürdigung nach Zumutbarkeitsgesichtspunkten vornehmen kann. Sonst muß er gewärtig sein, den Rechtsstreit um die Wirksamkeit der außerordentl. Künd. zu verlieren, nachdem der KündGegner sich zu dem nicht gerade angenehmen Klageweg entschlossen hat. Ob sich die Kenntnis des KündBerechtigten auf alle Einzelheiten erstrecken muß, die vielleicht erst nach umfangreichen Ermittlungen geklärt werden können, bedarf im vorl. Fall keiner Entscheidung. Sicher nicht zu beanstanden ist es, wenn wie hier der ArbGeb. vor Ausspruch der außerordentl. Künd. die "für die Künd. maßgebenden Tatsachen" im oben umschriebenen Sinne wenigstens dadurch zu klären versucht, daß er dem ArbN Gelegenheit gibt, zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen. 3. Nach erneuter Prüfung ist der Senat der Auffassung, daß die aus Rechtsgründen nicht immer erforderl., im Einzelfall tatsächl. aber durchgeführte Anhörung des KündGegners (vgl. zur Notwendigkeit der Anhörung das Urt. des Senats vom 23. 3. 1972 - 2 AZR 226/71 - AP Nr. AP BGB § 63 zu § 626 BGB) in der Regel geeignet ist, den Lauf der Ausschlußfrist zu hemmen. Wenigstens muß hier der Satz gelten, daß die Frist so lange noch nicht zu laufen beginnt, wie der KündBerechtigte aus verständigen Gründen mit der gebotenen Eile noch Ermittlungen über den KündSachverhalt anstellt und der KündGegner dies erkennen kann. Gibt der KündBerechtigte dem anderen Vertragspartner Gelegenheit zur Stellungnahme, so verwirklicht er den rechtsstaatl. Grundsatz des rechtl. Gehörs (vgl. Art. GG Artikel 101 Abs. GG Artikel 101 Absatz 1 GG); sein insoweit rechtmäßiges Verhalten darf nicht zum Rechtsverlust allein wegen des Fristablaufs führen. Überdies kann die Anhörung durch die Fürsorgepflicht geboten sein (vgl. BAG AP Nr. AP BGB § 13 zu § 123 BGB [zu IV 6b]). Dabei muß allerdings - darin ist den unter I 5 angeführten Überlegungen von Beitzke zu folgen - der KündGegner innerhalb einer kurz bemessenen Frist - im allgemeinen wird diese nicht länger als eine Woche sein dürfen - angehört werden, nachdem der KündBerechtigte das Ereignis kennt, das er möglicherweise zum Anlaß der außerordentl. Künd. nehmen will. Das folgt aus der zeitl. Begrenzung des KündRechts durch die Vorschrift des § BGB § 626 Abs. BGB § 626 Absatz 2 BGB. a) Im vorl. Fall war die Anhörung des Kl. geeignet, den Sachverhalt zu klären. Er hatte nämlich am 9. 6. 1970, als er während der Arbeitszeit schlafend angetroffen wurde, denspäter festgestellten Sachverhalt (Untätigkeit trotz ArbAuftrags) nicht zugegeben, sondern sich herauszureden versucht. Selbst bei der Anhörung durch die Standortverwaltung am 16. 6. 1970 bestritt er noch eine Verletzung seiner ArbPflicht, so daß die Bekl. weitere Ermittlungen anstellte. In diesem Zusammenhang kann sich der Kl. nicht darauf berufen, schon der Dienstvorgesetzte seiner Einheit habe sogleich am 9. 6. 1970 alle erforderl. Klarstellungen herbeiführen können; deshalb sei schon an diesem Tag die Ausschlußfrist angelaufen. Nachdem sich durch das Verhalten des Kl. die Notwendigkeit ergeben hatte, die Tatumstände näher aufzuklären und festzustellen - es mußten darüber hinaus auch die bereits früher entstandenen Personalvorgänge, die den Kl. betreffen, herangezogen werden -, kann es für den Fristablauf nicht entscheidend sein, welchen ihrer Mitarbeiter die Bekl. mit der Aufklärung beauftragt hat. Es muß ihr überlassen bleiben, die geeignet erscheinende Person auszuwählen. Wenn sie sich dabei eines Mitarbeiters der für solche Angelegenheiten eingerichteten Standortverwaltung jedenfalls - wie der Sachverhalt zeigt - mit der gebotenen Beschleunigung bedient hat, dann fehlt jeder Anhalt dafür, die Bekl. habe den Beginn der Ausschlußfrist rechtswidrig hinausgezögert. Im übrigen ist im Anschluß an das Urt. vom 27. 1. 1972 gegen die Angriffe der Rev. noch einmal darauf hinzuweisen, daß das Ergebnis der Anhörung ohne Einfluß auf den Beginn der Ausschlußfrist ist. Auch wenn durch die Anhörung der KündSachverhalt sich nicht ändert, kann ein solches negatives Ergebnis die Entscheidung über die Künd. beeinflussen, ganz abgesehen davon, daß ein solches Ergebnis nicht vorhergesehen werden kann. Nicht das Ergebnis der Anhörung wirkt sich auf den Fristbeginn aus, sondern der Grund für die Anhörung kann im Einzelfall Bedeutung erlangen. Die Anhörung muß aus verständigen Gründen veranlaßt worden sein. Fehlt es daran, wird die gleichwohl durchgeführte Anhörung willkürl. sein, was aber wohl nur in seltenen Ausnahmefällen zutreffen wird; nur dann ist der Lauf der Frist durch die Anhörung nicht hinausgeschoben worden. b) Ferner war dem Kl. innerhalb weniger Tage nach dem Vorfall vom 9. 6. 1970 bekannt, daß der ArbGeb. sein Verhalten an diesem Tag nicht hinnehmen wolle; er forderte ihn für den 16. 6. 1970, also innerhalb einer nicht zu lang bemessenen Frist von noch nicht einer Woche, zur Rücksprache bei der Standortverwaltung auf. Der Kl. hat deshalb nie im Zweifel sein können, daß der Vorfall nachgeprüft werde, und hat auch nicht nach zwei Wochen, vom 9. 6. 1970 an gerechnet, davon ausgehen können, jetzt sei sein Fehlverhalten vergeben und vergessen. Von einem - wie die Rev. es ausgedrückt hat - Schwelzustand, der den Kl. psychisch habe belasten können, kann daher nicht die Rede sein. c) Da die Bekl. am 30. 6. 1970 und damit innerhalb von 2 Wochen nach der Anhörung des Kl. die außerordentl. Künd. ausgesprochen hat, ist die Frist des § BGB § 626 Abs. BGB § 626 Absatz 2 BGB eingehalten. Die Wirksamkeit der Künd. scheitert nicht an der Fristenregelung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Urteil vom 07. September 1995 – 8 AZR 828/93 | § 242 BGB, Art 33 Abs 2 GG, IAOÜbk 111, § 24 BPersVGAnwG, § 53 Abs 1 BPersVGAnwG, § 75 Abs 3 Ziff 8 BPersVGAnwG, § 82 Abs 1 BPersVGAnwG, § 82 Abs 6 BPersVGAnwG, § 116b Abs 2 Nr 5 BPersVGAnwG, § 1 Abs 4 S 4 KSchG, § 256 Abs 1 ZPO, Anlage I Kap XIX A III EinigVtr, Anlage I Kap XIX A III Nr 1 Abs 4 EinigVtr, Anlage I Kap XIX A III Nr 1 Abs 5 EinigVtr, Anlage I Kap II B II Nr 2b § 2 Abs 1 S 3 Ziff 2 EinigVtr 1. Der Arbeitnehmer ist auch nach seiner Einstellung verpflichtet, Fragen des Arbeitgebers zu seiner Vor- und Ausbildung zu beantworten, wenn davon auszugehen ist, daß die bei der Einstellung abgegebenen Erklärungen und danach erfolgte Ergänzungen nicht mehr vollständig vorhanden sind. 2. Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, außergerichtliche Erklärungen zu möglichen Kündigungsgründen abzugeben, soweit nicht besondere rechtliche Grundlagen hierfür bestehen. 3. Der öffentliche Arbeitgeber darf nach dem Grundgesetz nur solche Lehrer einsetzen, die zu den Werten der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes stehen. Zur Sicherstellung dieser Aufgabe sind solche Fragen gegenüber dem Lehrer zulässig, die Zweifel an dessen Eignung im Zusammenhang mit einer früheren Tätigkeit betreffen. Hierzu gehören Fragen nach der Tätigkeit für das frühere Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und nach Funktionen in politischen Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (im Anschluß an Senatsurteil vom 26. August 1993 - 8 AZR 561/92 - AP Nr 8 zu Art 20 Einigungsvertrag, auch zur Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung vorgesehen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Urteil vom 08.06.2000 - 2 AZR 207/99 | § 5 ArbGG, § 611 BGBWird ein in leitender Position beschäftigter Arbeitnehmer zum Geschäftsführer einer neu gegründeten GmbH bestellt, die wesentliche Teilaufgaben des Betriebes seines bisherigen Arbeitgebers übernimmt (Ausgliederung einer Bauträger-GmbH aus einem Architekturbüro), so wird im Zweifel mit Abschluß des Geschäftsführerdienstvertrages das bisherige Arbeitsverhältnis aufgehoben (teilweise Korrektur der Rechtsprechung im Senatsurteil vom 9. Mai 1985 - 2 AZR 330/84 - BAGE 49, 81). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG, Urteil vom 10. Oktober 1990 – 5 AZR 404/89 | § 138 Abs 1 BGBEine Verlustbeteiligung des Arbeitnehmers ist jedenfalls dann sittenwidrig und damit nichtig (§ 138 Abs 1 BGB), wenn dafür kein angemessener Ausgleich erfolgt.1. Eine arbeitsvertragliche Vergütungsregelung verstößt dann gegen die guten Sitten im Sinne des § 138 Abs. 1 BGB, wenn der Arbeitnehmer mit dem Betriebs- oder Wirtschaftsrisiko des Arbeitgebers belastet wird. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Vergütungsabrede eine Verlustbeteiligung des Arbeitnehmers vorsieht (unveröffentlichtes Senatsurteil vom 21. März 1984 - 5 AZR 462/82 -, zu II 1 der Gründe).2. Davon ist hier ebenfalls auszugehen. Der Beklagte hat sich seine Weiterbeschäftigung für ein Jahr dadurch "erkauft", daß er sich im Gegenzuge verpflichtete, für die während seiner Tätigkeit eintretenden Verluste einzustehen. Damit finanzierte er seine Weiterbeschäftigung selbst, nachdem die erwarteten Spenden ausblieben.Zwar meint die Revision, der Beklagte hätte es in der Hand gehabt, die Verluste zu vermeiden, weil er die Abteilung selbst leiten und über den Einsatz seiner Mitarbeiter allein entscheiden konnte. Dabei verkennt die Revision jedoch, daß durch die Gehaltsansprüche des Beklagten und der ihm unterstellten Mitarbeiter ebenso wie aus dem Einsatz des wissenschaftlichen Apparates unvermeidbare Kosten entstanden. Ebensowenig ist der Gehaltsanstieg des Beklagten von der VergGr. I b BAT nach VergGr. I a BAT eine Gegenleistung der Klägerin, weil der Beklagte dafür im Rahmen seiner Verpflichtung zur Kostenerstattung im Ergebnis selbst aufkommen mußte.3. Da der Beklagte sich hiernach ohne nennenswerte Gegenleistung der Klägerin zur Deckung der Verluste des Instituts verpflichtet hat, ist diese Vereinbarung nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig, weil sie nach ihrem aus der Zusammenfassung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu entnehmenden Gesamtcharakter mit den guten Sitten nicht mehr zu vereinbaren ist (BGHZ 107, 92, 97, m.w.N.). Für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit ist allerdings auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts abzustellen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn das Rechtsgeschäft nachträglich geändert oder durch Zusatzvereinbarungen ergänzt wird (BGHZ 100, 353, 359, m.w.N.). Zwar hat der Beklagte noch nach seinem Ausscheiden mit einer "Vereinbarungsbestätigung" vom 29. September/3. Oktober 1984 bekräftigt, für die Verluste der von ihm geleiteten Abteilung aufzukommen. Damit ist er aber keine neue Verpflichtung eingegangen, sondern er hat die bereits im Zusatzvertrag vom 14. Januar 1983 im Zusammenhang mit der Begründung des Arbeitsverhältnisses eingegangenen Zusagen bestätigt. Allerdings ging die Anregung zum Abschluß dieses Vertrages von dem Beklagten selbst aus. Dabei mag er unüberlegt und unverständlich gehandelt haben. Das ändert aber letztlich nichts daran, daß die Voraussetzungen des § 138 Abs. 1 BGB erfüllt sind, denn insoweit kommt es allein darauf an, daß die begünstigte Klägerin aus der schwächeren Lage des Beklagten übermäßig Vorteile ziehen will (vgl. BGH Urteil vom 10. Juli 1987 - V ZR 284/85 - NJW 1988, 130, 131, m.w.N.). Das ist jedoch, wie schon dargelegt, der Fall, weil der Beklagte ohne nennenswerte Gegenleistung die Verpflichtung zur Deckung der in seiner Abteilung entstehenden unvermeidbaren Verluste übernommen hatte. In subjektiver Hinsicht ist nur erforderlich, daß die Handelnden diese Umstände kennen, aus denen sich die Sittenwidrigkeit ergibt; es ist demgegenüber nicht maßgebend, daß sie ihr Handeln für sittenwidrig halten. Es kommt insoweit nicht auf die eigene Beurteilung der Vertragspartner an, sondern auf die tatsächlichen Umstände und auf den Zwang der Verhältnisse, unter denen sie handeln. |